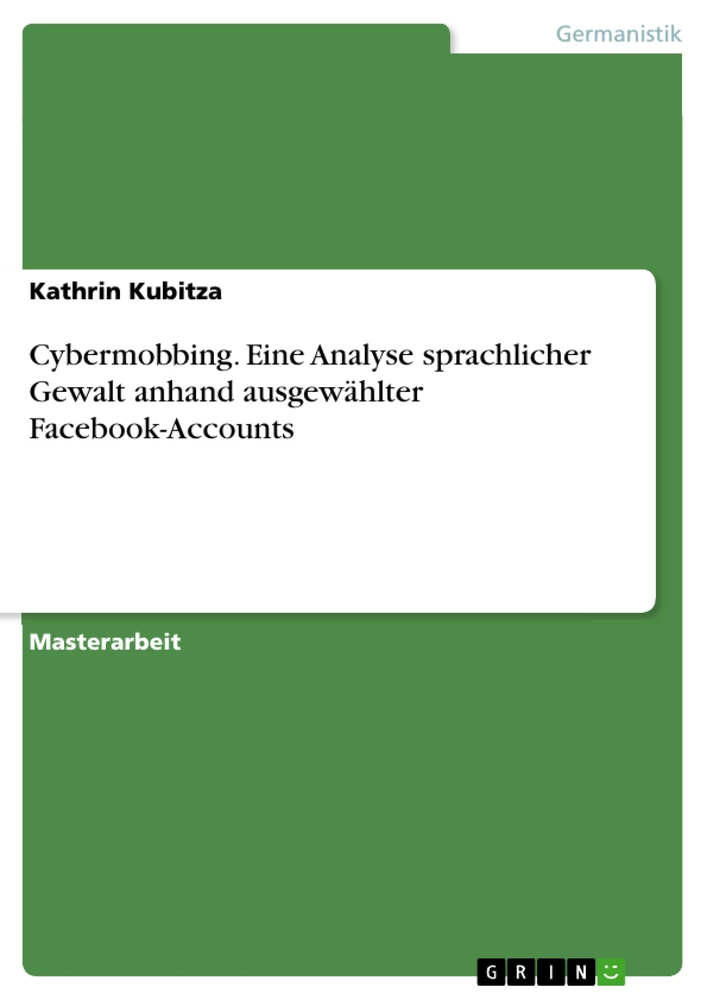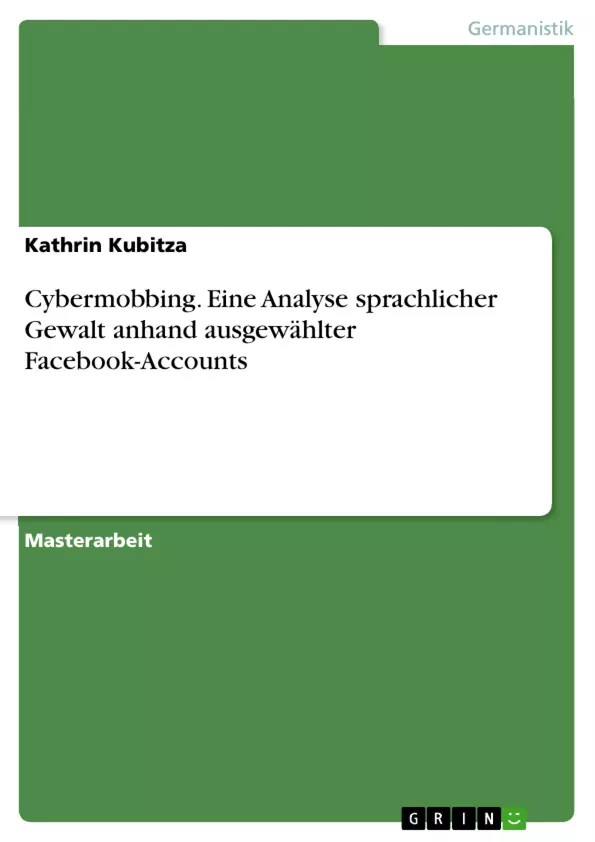Da die Zahl der Cybermobbing-Opfer stetig zunimmt, ist es dringend notwendig, Forschungen über Cybermobbing in Angriff zu nehmen, um hieraus Präventionen herauszuarbeiten sowie jene letztlich auch erfolgreich anzuwenden. Unumgänglich ist dabei, sich mit dem Thema ausführlich zu befassen und auseinanderzusetzen. Zumal Cybermobbing ein sehr komplexes sowie vielschichtiges Phänomen ist, sind Untersuchungen aus differenten Wissenschaftsbereichen erforderlich. Dies bedeutet, dass Cybermobbing u. a. aus dem soziologischen, pädagogischen, medizinischen und psychologischen Blickwinkel untersucht werden sollte, um ein sachkundiges Verständnis hiervon zu erhalten. Aus diesem Grund verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, durch die linguistische Analyse der Gewaltsprache beim Cybermobbing einen Beitrag zum Verständnis jenes facettenreichen Phänomens zu leisten. Erst auf der Grundlage des Verständnisses, d. h. wie sprachliche Gewalt konstruiert ist und welche Effekte jene hervorrufen kann, können Einsicht und Kenntnis erfolgen, welche für die Präventionsentwicklung essentiell sind (vgl. Groeben, 2009, S. 121; Schwarz-Friesel, 2013, S. 234). Marx und Weidacher (2014, S. 170) werden konkreter und erklären den Nutzen einer linguistischen Analyse von Cybermobbing so: „[Eine linguistische Analyse] kann nicht verhindern, dass sich das Opfer zutiefst verletzt fühlt, aber sie kann helfen offen zu legen, warum eine Äußerung so bedrohlich, verletzend oder beängstigend wirkt. […] Wenn die Strategien und sprachlichen Mittel die ein Täter anwendet >>enttarnt<< werden können, gelingt es dem Opfer möglicherweise, die sprachliche Gewalttat für sich einzuordnen und zu relativieren.“
Aufgrund dessen soll analysiert werden, wie sich Gewalt gegen eine Person in dem heutigen ‚Netzjargon‘ äußert. Folglich sollen Textpassagen aus Beiträgen der sozialen Plattform ‚Facebook‘ herangenommen und auf ihre sprachliche Gewalt hin untersucht werden. An dieser Stelle soll noch einmal erwähnt werden, dass speziell nur sprachliche Gewalt analysiert wird, welche sich in diesem Fall konkret gegen Personen richtet und in schriftlicher Form vorliegt. Neben der im Vordergrund stehenden Analyse der sprachlichen Gewalt beider Facebook-Accounts wird zudem untersucht, ob Unterschiede im Kontext der Gewaltintensität zwischen diesen zu finden sind. Hierbei wird versucht, die These zu stützen, dass eine prominente, bewusst provokative Person eine gewaltreichere Sprache erfährt als ein Alltagsmensch.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Beispiele von Cybermobbing
- 1.2 Relevanz und Ziel der Arbeit
- 1.3 Forschungsstand
- 1.4 Verwendetes Korpus
- 1.5 Aufbau und Struktur der Arbeit
- 2. Cybermobbing
- 2.1 Was ist Cybermobbing?
- 2.2 Das Prekäre an Cybermobbing
- 2.3 Verletzungspotential und Auswirkungen von Cybermobbing
- 3. Gewaltsprache
- 3.1 Gewalt und Sprache - Gegensätze?
- 3.1.1 Gewalt
- 3.1.2 Sprache und ihr Handlungspotenzial
- 3.2 Was ist Gewaltsprache?
- 3.3 Warum kann Sprache verletzen?
- 4. Strategien verbaler Gewalt
- 4.1 Pejoration des Eigennamens
- 4.1.1 Schimpfwörter
- 4.1.2 Metaphern und Vergleiche
- 4.1.3 Kategorisierung und Stereotypisierung
- 4.1.4 Pronominale Anrede
- 4.2 Grammatik verbaler Gewalt
- 4.2.1 Komparativ und Diminuitiv
- 4.2.2 Partikeln
- 4.3 Gewaltpotenzial bestimmter Sprechakte
- 4.3.1 Sprechakt, Beschimpfen, Beleidigen
- 4.3.2 Sprechakt, Auslachen
- 4.3.3 Sprechakt, aggressives Kritisieren
- 4.3.4 Sprechakt, aggressives Auffordern
- 4.3.5 Sprechakt, Drohen
- 4.3.6 Sprechakt, Widersprechen
- 4.4 Kurzes Resümee der herausgearbeiteten Strategien
- 5. Analyse der sprachlichen Gewalt zweier Facebook-Accounts
- 5.1 Hat die Gewaltsprache ihre Wirkung erzielt?
- 5.2 Das Gewaltpotenzial einiger Kommunikationsbedingungen
- 5.2.1 Physische Nähe bzw. Distanz und Vertraut- bzw. Fremdheit
- 5.2.2 Privatheit bzw. Öffentlichkeit und Endgültigkeit
- 5.2.3 Dialogizität bzw. Monologizität
- 5.2.4 Synchronität bzw. Asynchronität
- 5.2.5 Spontanität und freie Themenentwicklung
- 5.2.6 Emotion
- 5.2.7 Gewaltpotenzial der Oraliteralität der Facebook-Sprache
- 5.3 Verwendete Strategien verbaler Gewalt bei Melisa Omeragic
- 5.3.1 Sprechakt, Beschimpfen, Beleidigen
- 5.3.2 Sprechakt, Auslachen
- 5.3.3 Sprechakt, aggressives Kritisieren
- 5.3.4 Sprechakt, aggressives Auffordern
- 5.3.5 Sprechakt, Drohen
- 5.3.6 Sprechakt, Widersprechen
- 5.4 Verwendete Strategien verbaler Gewalt bei Conchita Wurst
- 5.4.1 Sprechakt, Beschimpfen, Beleidigen
- 5.4.2 Sprechakt, Auslachen
- Definition und Charakteristika von Cybermobbing
- Analyse der sprachlichen Strategien, die zur Vermittlung von Gewalt eingesetzt werden
- Die Rolle von Kommunikationsbedingungen im Kontext von Cybermobbing
- Die Auswirkungen von verbaler Gewalt im digitalen Raum
- Eine empirische Analyse von Facebook-Accounts als Fallbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Master-Thesis untersucht das Phänomen des Cybermobbings und analysiert die sprachliche Gewalt, die in ausgewählten Facebook-Accounts zum Einsatz kommt. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Mechanismen sprachlicher Gewalt im digitalen Raum zu entwickeln und aufzuzeigen, wie Sprache im Kontext von Cybermobbing verwendet wird, um andere zu verletzen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema Cybermobbing ein, beleuchtet seine Relevanz und das Ziel der Arbeit. Sie stellt den Forschungsstand dar, beschreibt das verwendete Korpus und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff Cybermobbing, definiert ihn und erläutert seine spezifischen Merkmale. Das dritte Kapitel widmet sich der Gewaltsprache und untersucht die Beziehung zwischen Gewalt und Sprache sowie die Mechanismen, durch die Sprache verletzend wirken kann. Das vierte Kapitel präsentiert verschiedene Strategien verbaler Gewalt, die im Kontext von Cybermobbing eingesetzt werden, darunter die Pejoration des Eigennamens, grammatische Mittel und die Gewaltpotenziale bestimmter Sprechakte. Das fünfte Kapitel analysiert die sprachliche Gewalt in zwei ausgewählten Facebook-Accounts. Es untersucht die Wirkung der Gewaltsprache, das Gewaltpotenzial der Kommunikationsbedingungen und die spezifischen Strategien, die von den Akteuren verwendet werden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Cybermobbing, Gewaltsprache, Facebook, Sprechakte, Kommunikationsbedingungen, Verletzungspotenzial, Analyse, Facebook-Accounts, empirische Forschung, digitale Gewalt, Soziale Medien, Online-Kommunikation.
- Quote paper
- Kathrin Kubitza (Author), 2014, Cybermobbing. Eine Analyse sprachlicher Gewalt anhand ausgewählter Facebook-Accounts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321674