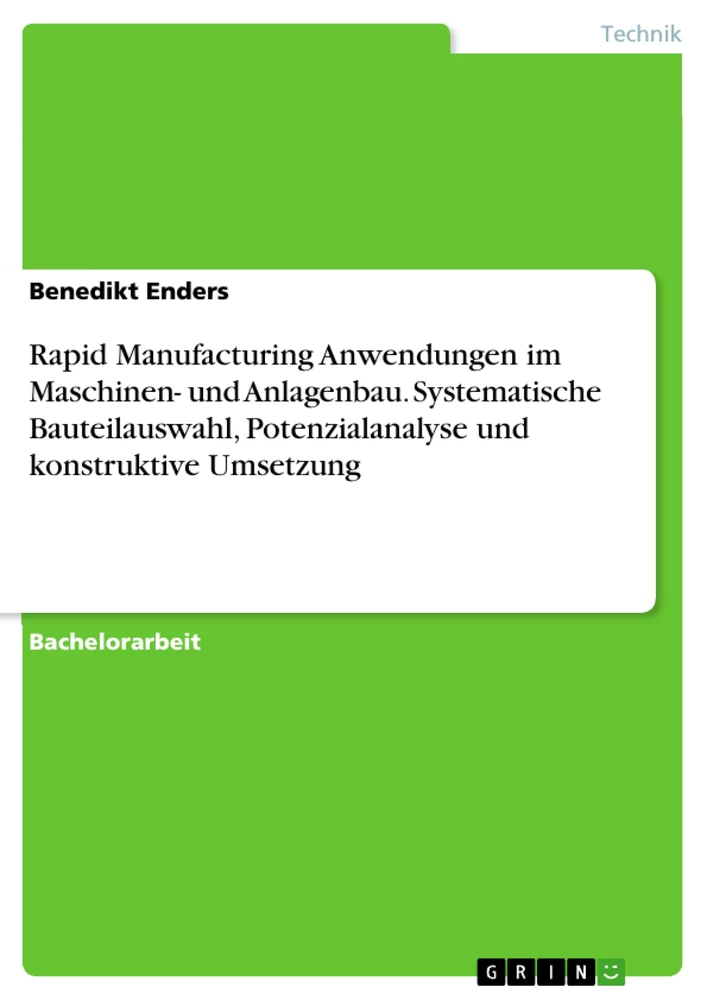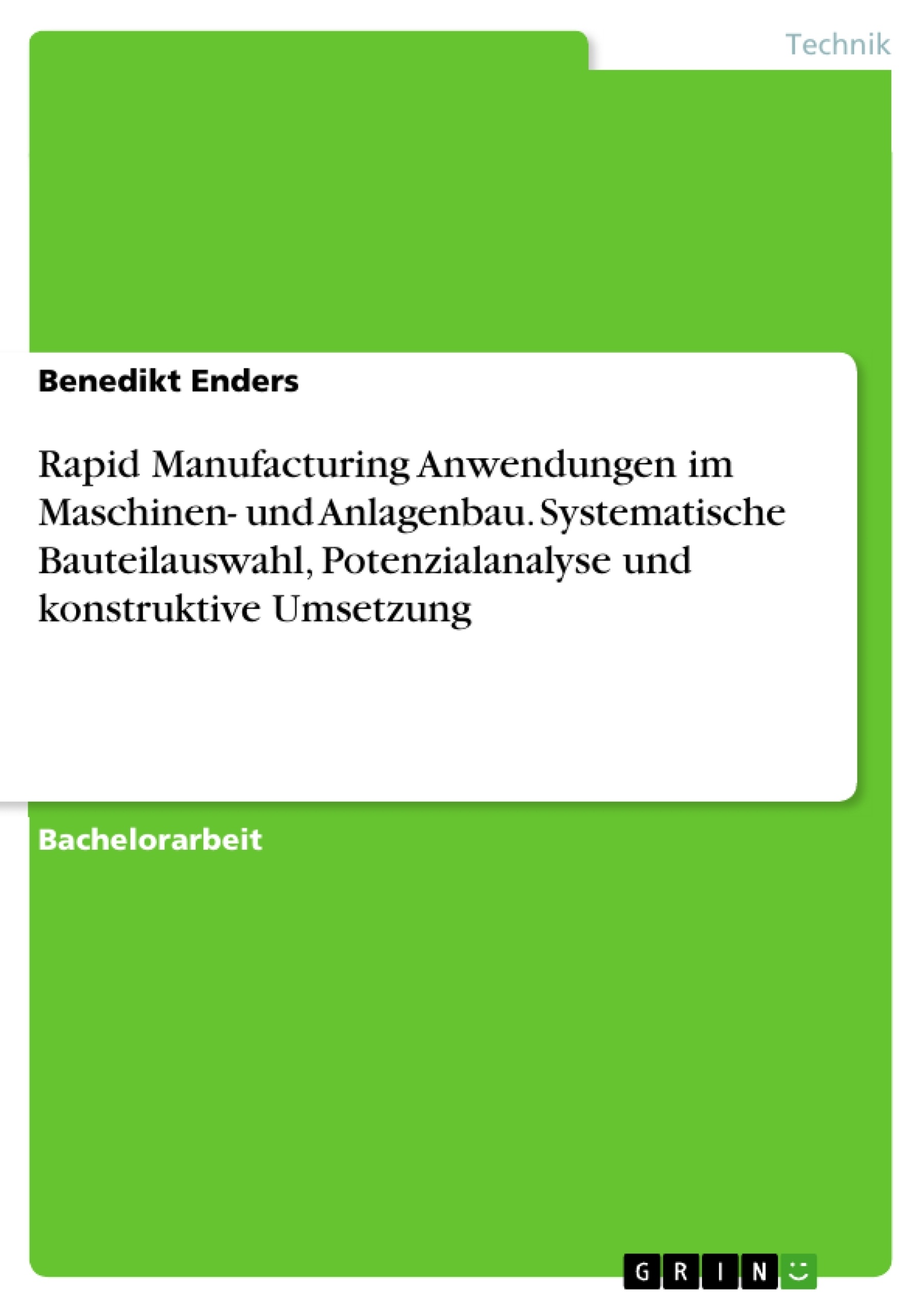Generative Fertigungsverfahren, teilweise umgangssprachlich auch 3D-Druck genannt, halten in den letzten Jahren in vielen Branchen Einzug. In der Prototypenherstellung sind sie bereits ein etabliertes Fertigungsverfahren. Bei der Herstellung von Endprodukten sind sie in der Medizintechnik und in der Luft- und Raumfahrt auf dem besten Weg dazu. In der vorliegenden Arbeit wird die aktuelle Eignung dieser Verfahren für Maschinenbauunternehmen untersucht.
Als Referenzunternehmen steht hierfür die mittelständische Firma Schmitt Werke GmbH aus dem unterfränkischen Bischofsheim zur Verfügung. Das Hauptthema dieser Arbeit ist die systematische Bauteilauswahl. Hier stellt sich die Kernfrage: Welche Eigenschaften und Merkmale müssen Bauteile aufweisen um sie wirtschaftlich sinnvoll generativ herstellen zu können und wie kann man diese Bauteile zuverlässig identifizieren?
Die Arbeit gliedert sich in eine kurze Beschreibung der generativen Fertigungsverfahren mit deren Grenzen und Potenzialen, systematische Bauteilauswahl bestehend aus Grob – und Feinauswahl, Potenzialanalyse sowie die konstruktive Umgestaltung und zuletzt ein Vergleich von konventioneller, subtraktiver und formativer Herstellung zur generativen Herstellung. Verglichen werden sowohl die Kostenstruktur, die Prozesskette wie auch die Gestaltung der Bauteile.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Formelverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel der Arbeit und Einschränkungen
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4 Kurzprofil Schmitt Werke GmbH
- 1.4.1 MSB GmbH & Co. KG
- 1.4.2 IBS GmbH
- 1.4.3 Cleanscrape GmbH
- 2 Generative Fertigungsverfahren
- 2.1 Einteilung der Technologien
- 2.2 Beschreibung der Technologien
- 2.2.1 Pulverbett-basierte Technologien
- 2.2.1.1 Lasersintern (LS)
- 2.2.1.2 Selektives Laserschmelzen SLM
- 2.2.1.3 Elektronenstrahlschmelzen EBM
- 2.2.2 Laserauftragsschweißen mit Pulver
- 2.2.3 Draht-basierte Technologie
- 2.2.3.1 Laserauftragsschweißen
- 2.2.4 Pulverstrahl-basierte Technologien
- 2.3 Potenziale und Chancen
- 2.3.1 Erhöhte Gestaltungsfreiheit
- 2.3.1.1 Umsetzung komplexer Strukturen
- 2.3.1.2 Funktionsintegration und Bauteilverschmelzung
- 2.3.1.3 Neue Verbindungselemente
- 2.3.2 Entkopplung der Bauteilkosten und der Komplexität
- 2.3.3 Individualisierung von Bauteilen
- 2.3.4 Realisierung neuer Fertigungsstrategien
- 2.3.5 Umsetzung der Industrie 4.0
- 2.3.6 Realisierung neuer Werkstoffe
- 2.3.7 Steigerung der Nachhaltigkeit
- 2.4 Grenzen generativer Fertigungsverfahren
- 2.4.1 Bauteilgröße
- 2.4.2 Bauteilqualität
- 2.4.3 Maßgenauigkeit und Oberflächenrauigkeit im Bauprozess
- 2.4.4 Baugeschwindigkeit
- 2.4.5 Notwendigkeit von Stützstrukturen im Bauprozess
- 2.4.6 Folgeprozesse
- 2.4.7 Automatisierung
- 2.4.8 Prozesssicherheit und Qualitätsmanagement
- 3 Systematische Bauteilauswahl
- 3.1 Methodenauswahl
- 3.2 Grobauswahl
- 3.2.1 Stage-Gate-Methode
- 3.2.2 Stage 1 - Bauteilgröße
- 3.2.3 Stage 2 - geometrische Bauteilkomplexität
- 3.2.4 Stage 3 Bauteilvarianten
- 3.3 Eignungsanalyse TOPSIS-Verfahren
- 3.3.1 Kriterienauswahl
- 3.3.1.1 Bauteilform
- 3.3.1.2 Losgröße
- 3.3.1.3 Bauteilkomplexität
- 3.3.1.4 Zerspanungsverhältnis
- 3.3.1.5 Werkstoffkosten
- 3.3.1.6 Zerspanbarkeit
- 3.3.1.7 Komplexität der Herstellung
- 3.3.1.8 Anzahl der Schnittstellen
- 3.3.1.9 Variantenanzahl
- 3.3.1.10 Anzahl der Passungsflächen
- 3.3.2 Ermittlung der Entscheidungsmatrix
- 3.3.3 Ermittlung der Gewichtungsmatrix mittels AHP
- 3.3.3.1 Paarweiser Vergleich der Kriterien
- 3.3.3.2 Aggregation der Paarvergleichsurteile zu Bedeutungsurteilen
- 3.3.3.3 Überprüfung der Gewichtungsmatrix
- 3.3.3.4 Konsistenzprüfung
- 3.3.4 Berechnung der gewichteten Entscheidungsmatrix
- 3.3.5 Bestimmung virtueller Alternativen und deren Abstandsmaße
- 3.3.6 Berechnung des Eignungsindexes
- 3.4 Ergebnisse
- 3.5 Ausgewählte Bauteile
- 3.6 Potenzialuntersuchung
- 3.7 Sensitivitätsanalyse der Auswahlmethodik
- 4 Konstruktive Überarbeitung der Bauteile
- 4.1 Doppelkammersprührohr - Wasser-Nebel-Bedüsung
- 4.1.1 Beschreibung
- 4.1.2 Funktionen des Bauteils
- 4.1.3 Anforderungen
- 4.1.4 Konstruktive Überarbeitung
- 4.1.5 Generative Herstellung
- 4.1.6 Nachbearbeitung
- 4.1.7 Kostenermittlung
- 4.1.7.1 Ermittlung der Bauzeit
- 4.1.7.2 Ermittlung des Maschinenstundensatzes
- 4.1.7.3 Ermittlung der Fertigungskosten
- 4.1.7.4 Ermittlung der Materialkosten
- 4.1.7.5 Ermittlung der Herstellkosten
- 4.2 Pumpengehäuse Schrämgetriebe
- 4.2.1 Beschreibung
- 4.2.2 Funktionen des Bauteils
- 4.2.3 Anforderungen
- 4.2.4 Konstruktive Überarbeitung
- 4.2.5 Generative Herstellung
- 4.2.6 Nachbearbeitung
- 4.2.7 Kostenermittlung
- 5 Vergleich der Herstellungsverfahren
- 5.1 Vergleich der Prozessketten
- 5.1.1 Prozesskette des Doppelkammersprührohrs – Wasser-Nebel-Bedüsung
- 5.1.2 Prozesskette des Pumpengehäuses - Ölumlaufpumpe
- 5.2 Vergleich der Herstellzeiten
- 5.3 Vergleich der Herstellkosten
- 6 Zusammenfassung
- 7 Ausblick
- 7.1 Weiterentwicklung der Auswahlmethodik
- 7.1.1 Unschärfe-Logik
- 7.1.2 Softwareentwicklung
- 7.2 Zukunft der Bauteile
- 7.2.1 Wasser-Nebel-Bedüsung
- 7.2.2 Pumpengehäuse
- 7.3 Zukunft der Fertigungsverfahren
- 7.3.1 Allgemeine Zukunftsaussichten der Technologien
- 7.3.2 Generative Fertigung bei den Schmitt Werken GmbH
- Literaturverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Eignung generativer Fertigungsverfahren für Maschinenbauunternehmen und analysiert deren Potenziale und Grenzen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der systematischen Bauteilauswahl, um zu identifizieren, welche Bauteile sich wirtschaftlich sinnvoll generativ herstellen lassen. Die Arbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten dieser Verfahren am Beispiel der Schmitt Werke GmbH, einem mittelständischen Unternehmen.
- Systematische Bauteilauswahl: Entwicklung und Anwendung einer Methodik zur Identifizierung geeigneter Bauteile für die generative Fertigung.
- Potenzialanalyse: Bewertung der Vorteile und Chancen generativer Fertigungsverfahren im Maschinenbau.
- Konstruktive Überarbeitung: Anpassung von Bauteilen für die generative Fertigung und Optimierung der Konstruktion.
- Vergleich der Herstellungsverfahren: Gegenüberstellung von konventionellen und generativen Herstellungsverfahren hinsichtlich Prozesskette, Herstellzeiten und Kosten.
- Zukunftsaussichten: Analyse der zukünftigen Entwicklung generativer Fertigungsverfahren und deren Bedeutung für den Maschinenbau.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik generativer Fertigungsverfahren und stellt die Schmitt Werke GmbH als Referenzunternehmen vor. Kapitel 2 beschreibt die verschiedenen generativen Fertigungsverfahren, deren Potenziale und Grenzen. Kapitel 3 befasst sich mit der systematischen Bauteilauswahl, wobei eine Methodik zur Identifizierung geeigneter Bauteile entwickelt und angewendet wird. Kapitel 4 untersucht die konstruktive Überarbeitung ausgewählter Bauteile für die generative Fertigung. Kapitel 5 vergleicht die Herstellungsverfahren und die Kostenstruktur von konventionellen und generativen Verfahren. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Generative Fertigungsverfahren, 3D-Druck, Additive Manufacturing, Bauteilauswahl, Potenzialanalyse, Konstruktive Überarbeitung, Prozesskette, Kostenvergleich, Maschinenbau, Schmitt Werke GmbH.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Rapid Manufacturing?
Rapid Manufacturing bezeichnet die Verwendung von generativen Fertigungsverfahren (3D-Druck) zur Herstellung von Endprodukten, nicht nur von Prototypen.
Welche Kriterien entscheiden über die Eignung eines Bauteils für den 3D-Druck?
Wichtige Kriterien sind die geometrische Komplexität, die Losgröße, das Zerspanungsverhältnis, die Notwendigkeit von Funktionsintegration und die Bauteilgröße.
Was sind die Vorteile generativer Fertigung im Maschinenbau?
Vorteile sind erhöhte Gestaltungsfreiheit, die Möglichkeit zur Gewichtsreduktion durch Leichtbaustrukturen, Funktionsintegration und die wirtschaftliche Herstellung kleiner Losgrößen.
Wo liegen die Grenzen des 3D-Drucks in der Industrie?
Grenzen sind oft die Baugeschwindigkeit, die begrenzte Bauteilgröße, die Oberflächenrauheit und die Notwendigkeit aufwendiger Nachbearbeitungsprozesse.
Was ist das TOPSIS-Verfahren in diesem Kontext?
TOPSIS ist eine mathematische Methode zur Entscheidungsunterstützung, die hier genutzt wird, um aus einer Vielzahl von Bauteilen diejenigen mit der höchsten Eignung für die generative Fertigung herauszufiltern.
- Citation du texte
- Benedikt Enders (Auteur), 2016, Rapid Manufacturing Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Systematische Bauteilauswahl, Potenzialanalyse und konstruktive Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321837