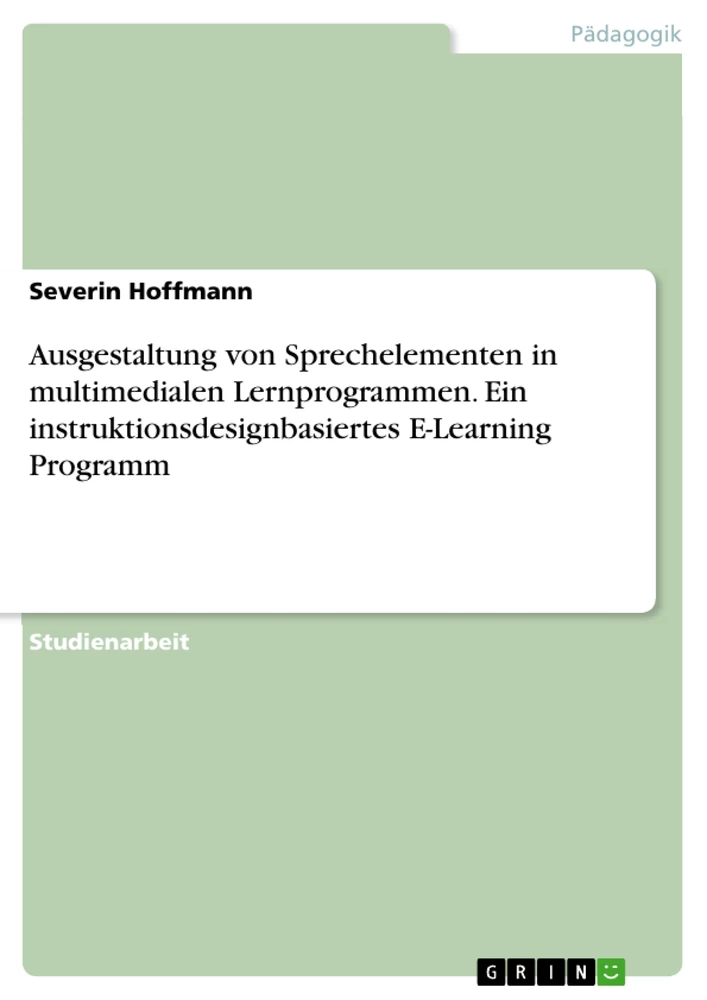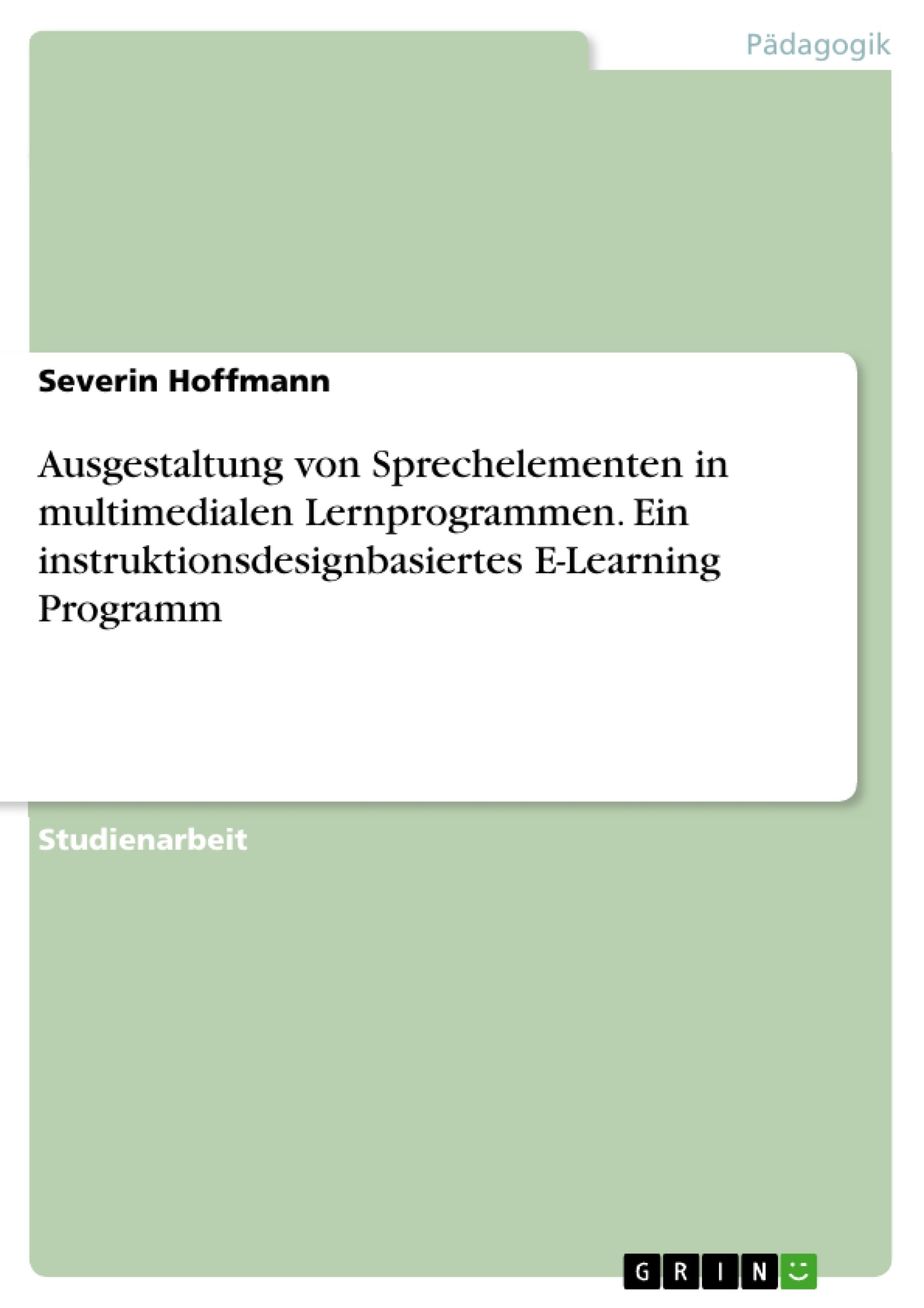In dieser Arbeit werden ausschließlich die Umsetzung und Anwendung des auditiven Texts auf ein konkretes Beispiel betrachtet. Für die Emittierung und Rezeption des „multimedialen E-Learning Programms“ wird vorausgesetzt, dass der auditiven Nachricht, oder deren psychischer und physischer Verarbeitung grundsätzlich nichts entgegensteht. In dieser Arbeit wird zudem der Fokus auf die Kriterien selbst, nicht aber deren Ausgestaltungsspektren liegen, oder deren Zusammenhang mit Lernqualität zwischen visuellem. und auditivem Text. Einschränkend kann dadurch eine Aussage bzgl. dieses Beispiels getroffen werden, allerdings nicht auf eine Allgemeingültigkeit abgestellt werden, da keine empirische Untersuchung durchgeführt wird. Die Auswertung erfolgt auf Basis subjektiver Auffassungen des Autors und kann von der Sichtweise dritter abweichen.
Multimediale Inhalte begegnen uns inzwischen in sehr vielen Lebenslagen. Gerade durch die in der Gesellschaft breite Verbreitung von Endgeräten wird es uns ermöglicht, mobil und ohne viele Umstände über einfach händelbare Programme (Apps) auf das Internet zuzugreifen oder multimediale Inhalte zu nutzen. Dabei spielt der Wissenstransfer, ob nun direkt oder indirekt eine primäre Rolle. Sollen Inhalte gezielt durch sog. E-Learning Programme vermittelt werden, so fällt auf, dass hierbei zum einen die wahrgenommene Professionalität von visuellen und auditiven Ausgestaltungen in ihrer methodischen und didaktischen Qualität in vielen Fällen eklatante Unterschiede aufweisen. Dabei sind für die erfolgreiche Vermittlung von Wissen beide Modalitäten von Bedeutung.
Führt man eine Recherche zu Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit E-Learning aus der Erwachsenenbildung, Kommunikationswissenschaft, Sprecherziehung, Sprach- und Sprechwissenschaften und Psychologie durch, so sind primär visuelle Inhalte wie visueller Text (im Folgenden = v.T.), Bilder, Grafiken, Bewegtbilder Kern von Untersuchungen. Auditive Inhalte, insb. dem auditiven Text (a.T.) finden inhaltlich Erwähnung aber eine tiefgreifender methodischer und didaktischer Analyse in Bezug auf die Wirkung von Sprechelementen und deren gezielter Ausgestaltung für die Verwendung in E-Learning Programmen sucht man vergeblich. So sind in Forschungsarbeiten zu bimodalen Lerninhalten und deren Auswirkungen auf die Lernquantität, mit identischen v.T. und a.T, wenige Erkenntnisse hinsichtlich spezieller Kriterien bzgl. der Ausgestaltung von a.T. gewonnen worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- HAUPTTEIL I – THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Multimediale E-Learning Programme (m.E.P.)
- E-Learning Typus
- Technische und Technologische Kriterien eines m.E.P.
- Fachliche Grundlagen der Kommunikation
- 4-Seiten-Modell der Nachricht (Schulz von Thun)
- Hörverstehen
- Cognitive-Load-Theorie (CLT)
- Kognitive Theorie multimedialen Lernens (CTML)
- Die menschliche Sprache
- Funktionen von auditiven Texten
- Gestaltung von auditiven Texten
- HAUPTTEIL II – METHODIK
- Theorie-Praxis-Transfer
- Typusbestimmung
- Beschreibung des Lernprogramms
- Methodisches Vorgehen
- HAUPTTEIL III – AUSWERTUNG
- Technische und technologische Umsetzung
- Fachliche Auswertung
- Denkstil
- Sprachstil
- Sprechstil
- REFLEXION AUF DEN THEORIETEIL
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Ausgestaltung von Sprechelementen in multimedialen Lernprogrammen. Sie analysiert ein instruktionsdesignbasiertes E-Learning Programm einer Softwareschulung und untersucht, welche Kriterien für eine wirksame Gestaltung von auditiven Texten in diesem Kontext relevant sind.
- Analyse der Rolle von auditiven Texten in multimedialen Lernprogrammen
- Bedeutung von Sprechelementen für die Wissensvermittlung
- Anwendung der Cognitive-Load-Theorie und der Kognitiven Theorie multimedialen Lernens
- Entwicklung von Kriterien für die Ausgestaltung von auditiven Texten
- Empfängerbezogene Orientierung und didaktische Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz von auditiven Texten in multimedialen Lernprogrammen. Der erste Hauptteil behandelt die theoretischen Grundlagen, beleuchtet verschiedene E-Learning Typen und analysiert die Kommunikationstheorie von Schulz von Thun. Der zweite Hauptteil widmet sich der Methodik der Untersuchung, beschreibt das Lernprogramm und das methodische Vorgehen. Der dritte Hauptteil präsentiert die Auswertung der technischen und fachlichen Aspekte des Lernprogramms, wobei der Fokus auf Denkstil, Sprachstil und Sprechstil liegt.
Schlüsselwörter
Multimediale Lernprogramme, E-Learning, Auditive Texte, Sprechelemente, Instruktionsdesign, Cognitive-Load-Theorie, Kognitive Theorie multimedialen Lernens, Kommunikationstheorie, Schulz von Thun, Hörverstehen, Wissensvermittlung, Didaktik, Methodische Gestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind auditive Texte im E-Learning wichtig?
Für eine erfolgreiche Wissensvermittlung sind sowohl visuelle als auch auditive Modalitäten entscheidend, da sie die kognitive Verarbeitung unterstützen.
Was besagt die Cognitive-Load-Theorie (CLT) für das Lernen?
Die CLT befasst sich mit der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und wie die Gestaltung von Lerninhalten diese Belastung optimieren kann.
Welche fachlichen Kriterien werden für die Auswertung von Sprechelementen genutzt?
Die Auswertung erfolgt anhand der Kriterien Denkstil, Sprachstil und Sprechstil.
Was ist das 4-Seiten-Modell von Schulz von Thun?
Es ist ein Kommunikationsmodell, das besagt, dass jede Nachricht vier Ebenen hat: Sachinhalt, Selbstkundgabe, Beziehung und Appell.
Wie hängen visuelle und auditive Inhalte beim multimedialen Lernen zusammen?
Die kognitive Theorie multimedialen Lernens (CTML) untersucht, wie die Kombination beider Kanäle die Lernqualität und Wissensaufnahme beeinflusst.
- Quote paper
- Severin Hoffmann (Author), 2015, Ausgestaltung von Sprechelementen in multimedialen Lernprogrammen. Ein instruktionsdesignbasiertes E-Learning Programm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321844