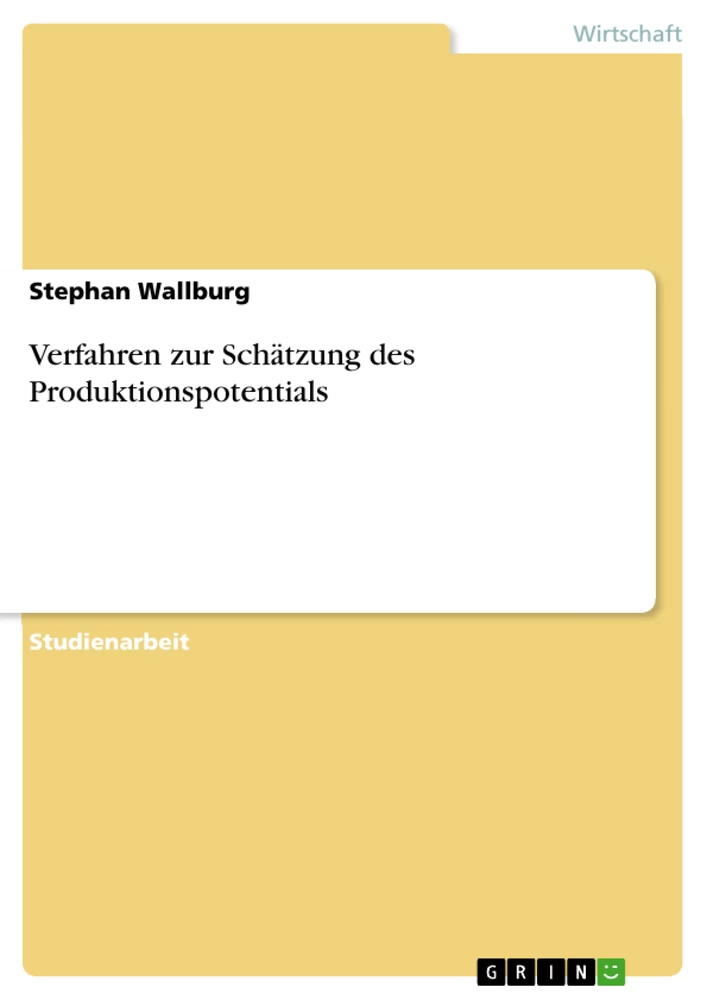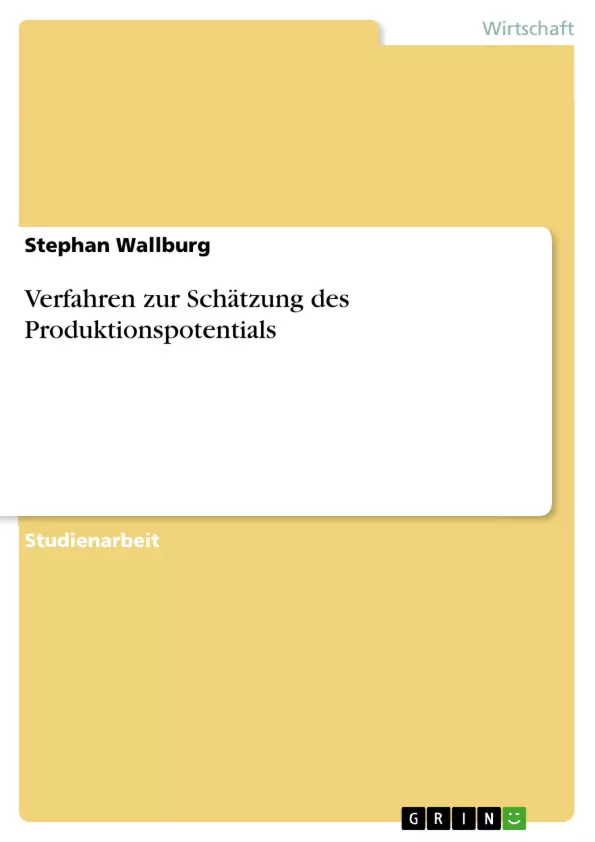Einleitung
Es gibt viele Versuche zur Erklärung des Konjunkturphänomens. Einer davon versucht Konjunkturschwankungen als Schwankungen der gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung zu erklären. Wendepunkte sind die jeweils höchsten bzw. niedrigsten Auslastungsgrade, die Ausschläge lassen sich direkt am Auslastungsgrad ablesen. Zur Berechnung der Kapazitätsauslastung benötigt man einen Wert für die maximal mögliche Produktion – das Produktionspotential. Unter diesem versteht man die gesamtwirtschaftliche Leistung, welche bei voller oder normaler ( differiert je nach Modell ) Auslastung der Produktionsfaktoren möglich wäre. Für die Ermittlung bzw. Schätzung des Produktionspotentials gibt es eine Reihe von Modellen, auf die ich im folgenden näher eingehen werde.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Modelle mit einem Produktionsfaktor
- 2.1 Modell des Sachverständigenrates
- 2.2 Modell von Okun
- 3. Modelle mit mehreren Produktionsfaktoren
- 3.1 Modell der Bundesbank
- 4. Weitere Modelle
- 4.1 Methode gleitender Durchschnitte
- 4.2 Peak - to - Peak - Methode
- 4.3 IFO - Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Verfahren zur Schätzung des Produktionspotentials. Ziel ist es, verschiedene Modelle vorzustellen und zu vergleichen, die zur Berechnung der maximal möglichen gesamtwirtschaftlichen Leistung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Produktionsfaktoren verwendet werden.
- Modelle zur Schätzung des Produktionspotentials
- Vergleich verschiedener Ansätze (ein vs. mehrere Produktionsfaktoren)
- Berechnung des Produktionspotentials anhand verschiedener Methoden
- Der Einfluss von Produktionsfaktoren auf das Produktionspotential
- Anwendung der Modelle auf die deutsche Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Konjunkturschwankungen und deren Erklärung durch Kapazitätsauslastung ein. Sie betont die Bedeutung der Bestimmung des Produktionspotentials – der maximal möglichen Produktion bei voller oder normaler Auslastung der Produktionsfaktoren – für die Analyse von Konjunkturzyklen. Die Arbeit kündigt die Vorstellung verschiedener Modelle zur Schätzung des Produktionspotentials an.
2. Modelle mit einem Produktionsfaktor: Dieses Kapitel befasst sich mit Modellen, die lediglich einen Produktionsfaktor berücksichtigen. Es wird das Modell des Sachverständigenrates detailliert erläutert, welches den Produktionsfaktor Kapital als Grundlage für die Berechnung des Produktionspotentials verwendet. Die Berechnung basiert auf der Entwicklung der volkswirtschaftlichen Kapitalproduktivität und dem daraus abgeleiteten Auslastungsgrad des Produktionspotentials. Weitere Modelle, wie das Modell von Okun, werden ebenfalls kurz erwähnt, jedoch nicht im Detail behandelt.
3. Modelle mit mehreren Produktionsfaktoren: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel werden hier Modelle vorgestellt, die mehrere Produktionsfaktoren in Betracht ziehen. Das Modell der Bundesbank wird als Beispiel genannt und kurz beschrieben. Der Fokus liegt auf der Erweiterung des Modells um weitere Faktoren, die eine realistischere Schätzung des Produktionspotentials ermöglichen sollen.
4. Weitere Modelle: Dieses Kapitel präsentiert zusätzliche Methoden zur Schätzung des Produktionspotentials, darunter die Methode der gleitenden Durchschnitte, die Peak-to-Peak-Methode und die IFO-Methode. Diese Methoden bieten alternative Ansätze zur Bestimmung des Produktionspotentials und erweitern das Spektrum der im vorherigen Kapitel dargestellten Verfahren. Die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Methoden werden im Detail dargelegt.
Schlüsselwörter
Produktionspotential, Kapazitätsauslastung, Konjunktur, Produktionsfaktoren, Kapitalproduktivität, Modellvergleich, Sachverständigenrat, Bundesbank, IFO-Institut, gleitende Durchschnitte, Peak-to-Peak-Methode.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verfahren zur Schätzung des Produktionspotentials
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht verschiedene Verfahren zur Schätzung des Produktionspotentials der deutschen Wirtschaft. Sie stellt verschiedene Modelle vor und vergleicht diese hinsichtlich ihrer Herangehensweise und Ergebnisse. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Vergleich von Modellen mit einem und mehreren Produktionsfaktoren.
Welche Modelle werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert eine Reihe von Modellen zur Schätzung des Produktionspotentials. Dies umfasst Modelle mit nur einem Produktionsfaktor (z.B. das Modell des Sachverständigenrates, das Modell von Okun), Modelle mit mehreren Produktionsfaktoren (z.B. das Modell der Bundesbank), und weitere Methoden wie die Methode der gleitenden Durchschnitte, die Peak-to-Peak-Methode und die IFO-Methode.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Modelle zur Berechnung der maximal möglichen gesamtwirtschaftlichen Leistung vorzustellen und zu vergleichen. Die Arbeit soll einen Überblick über die verschiedenen Ansätze und deren Stärken und Schwächen geben und den Einfluss verschiedener Produktionsfaktoren auf die Schätzung des Produktionspotentials beleuchten.
Welche Produktionsfaktoren werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Modelle, die entweder einen einzelnen Produktionsfaktor (z.B. Kapital im Modell des Sachverständigenrates) oder mehrere Produktionsfaktoren berücksichtigen. Die genauen Produktionsfaktoren, die in den jeweiligen Modellen verwendet werden, werden im Detail innerhalb der Kapitel beschrieben.
Wie werden die Modelle verglichen?
Der Vergleich der Modelle erfolgt anhand ihrer zugrundeliegenden Annahmen, ihrer Berechnungsmethoden und ihrer Ergebnisse. Die Arbeit diskutiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze und bewertet deren Eignung zur Schätzung des Produktionspotentials unter verschiedenen Bedingungen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Modellen mit einem Produktionsfaktor, ein Kapitel zu Modellen mit mehreren Produktionsfaktoren und ein Kapitel zu weiteren Methoden. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Produktionspotential, Kapazitätsauslastung, Konjunktur, Produktionsfaktoren, Kapitalproduktivität, Modellvergleich, Sachverständigenrat, Bundesbank, IFO-Institut, gleitende Durchschnitte, Peak-to-Peak-Methode.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für alle gedacht, die sich mit der Schätzung des Produktionspotentials und der Analyse von Konjunkturschwankungen auseinandersetzen. Sie richtet sich insbesondere an Wirtschaftswissenschaftler, Studenten und alle, die ein tiefergehendes Verständnis der zugrundeliegenden Methoden und Modelle benötigen.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Modellen?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Modellen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln der Arbeit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen ersten Überblick über die jeweiligen Methoden und Ansätze.
Wie wird das Produktionspotential definiert?
Das Produktionspotential wird in der Arbeit als die maximal mögliche Produktion bei voller oder normaler Auslastung der Produktionsfaktoren definiert. Die Bestimmung des Produktionspotentials ist essentiell für die Analyse von Konjunkturzyklen, da sie die Unterscheidung zwischen konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen ermöglicht.
- Quote paper
- Stephan Wallburg (Author), 2001, Verfahren zur Schätzung des Produktionspotentials, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3218