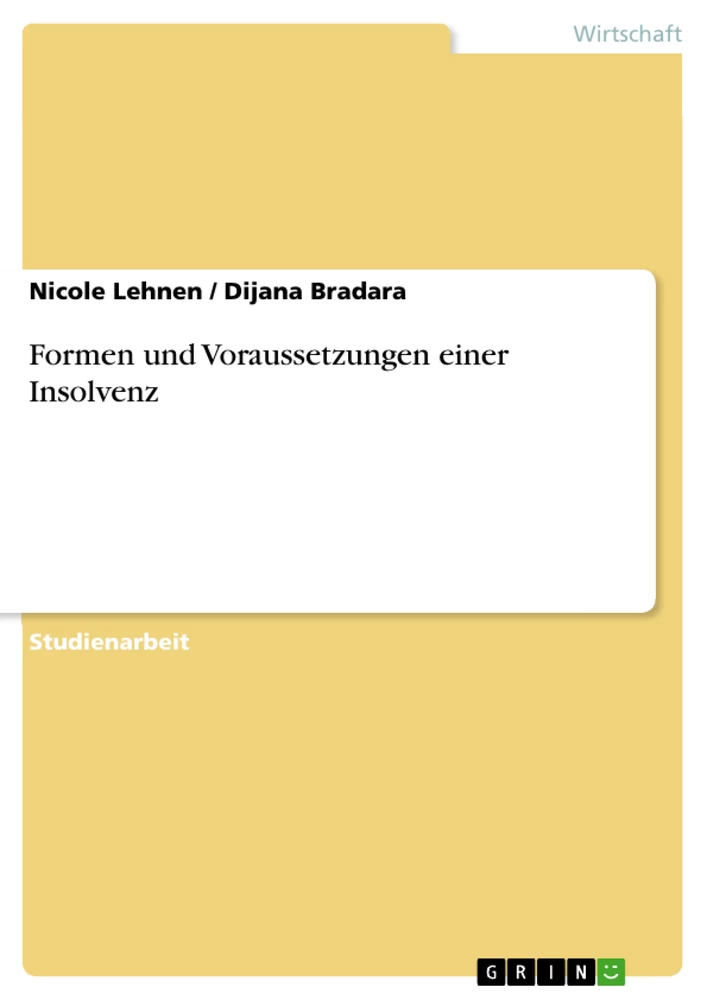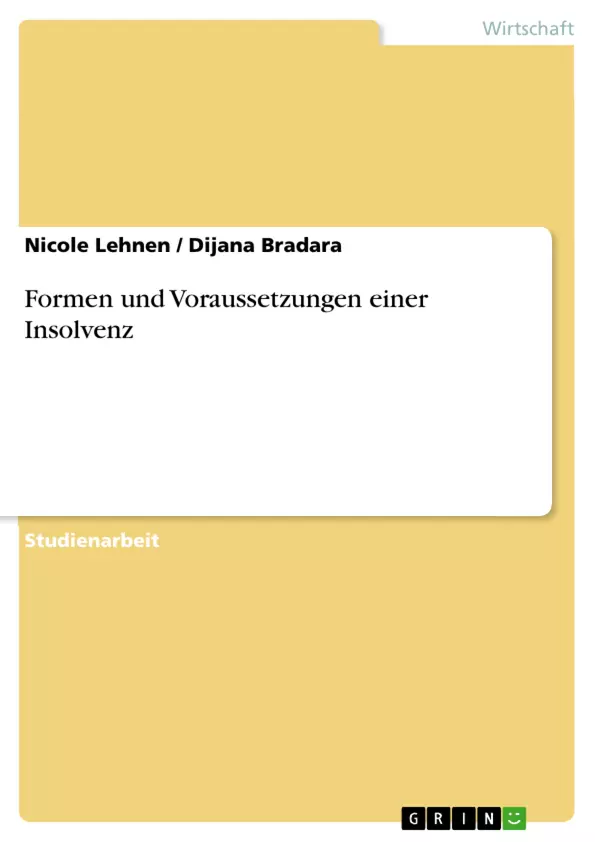Durch die Insolvenzordnung, die am 01.01.1999 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber ein einheitliches Recht für alle Bundesländer geschaffen. Dies war aufgrund der Missstände des früheren Insolvenzrechts, das Konkurs- und Vergleichsrecht und die Gesamtvollstreckungsordnung sowie auch der gestiegenen Anzahl von Insolvenzen nötig. Darüber hinaus wurden damals bis zu 65% aller Verfahren mangels Masse abgelehnt.
Eine Insolvenz entsteht dadurch, dass das Vermögen eines Schuldners nicht mehr ausreicht, um die Forderungen der Gläubiger zu erfüllen. Somit ist das Ziel des Insolvenzverfahrens all diese Gläubiger gemeinschaftlich zu befriedigen.
Die Insolvenz kann aufgrund dreier voneinander unabhängiger
Voraussetzungen eröffnet werden: Die Zahlungsunfähigkeit, die drohende Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung. Der Eröffnungsgrund hängt davon ab, ob es sich beim Schuldner um eine natürliche oder juristische Person handelt. Die vorliegenden Insolvenzgründe müssen zu dem Zeitpunkt festgestellt werden, an dem über die Verfahrenseröffnung entschieden wird. Bis zur Verfahrenseröffnung kann dieser allerdings schon aufgehoben und dadurch ein Verfahren vermieden werden.
In der heutigen Insolvenzordnung ist außerdem eine Unterteilung der Insolvenzen in Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen möglich. Die Wichtigkeit dieser Unterteilung verdeutlicht der Umstand der zunehmenden Privatinsolvenzen in Deutschland.
Im Jahr 2011 beispielsweise wurden 103.289 Verbraucherinsolvenzen verzeichnet, wohingegen es lediglich 30.200 Unternehmensinsolvenzen gab.
Je nachdem, ob der Schuldner eine juristische oder sonstige Person ist, entscheidet sich welches der beiden Verfahren angewendet wird. Danach entscheidet sich auch, ob Eigenverwaltung, Restschuldbefreiung und Insolvenzplan möglich sind.
Die folgende Arbeit gliedert sich in die zwei Teilbereiche „Voraussetzungen“ und „Formen“ einer Insolvenz, in denen wir zunächst die wesentlichen Eröffnungsgründe eines Insolvenzverfahrens darstellen und im Weiteren auf die einzelnen Formen des Insolvenzverfahrens eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Voraussetzungen einer Insolvenz
- Die Zahlungsunfähigkeit
- Die drohende Zahlungsunfähigkeit
- Die Überschuldung
- Überschuldung nach Liquidationswerten
- Überschuldung nach Fortführungswerten
- Konsequenzen der positiven und negativen Fortführungsprognose
- Formen einer Insolvenz
- Regelinsolvenzverfahren (Unternehmensinsolvenz)
- Insolvenzplanverfahren
- Eigenverwaltung
- Verbraucherinsolvenzverfahren
- Außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren
- Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren
- Das vereinfachte Verbraucherinsolvenzverfahren
- Restschuldbefreiung
- Sonderformen des Insolvenzverfahrens
- Nachlassinsolvenzverfahren
- Insolvenzverfahren über Gütergemeinschaft
- Grenzüberschreitendes Insolvenzverfahren
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Formen und Voraussetzungen einer Insolvenz. Ziel ist es, die wesentlichen Eröffnungsgründe eines Insolvenzverfahrens zu erläutern und die verschiedenen Insolvenzverfahren zu beschreiben. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen sowie den jeweiligen Besonderheiten.
- Eröffnungsgründe der Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung)
- Unterscheidung zwischen Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzverfahren
- Verschiedene Formen von Insolvenzverfahren (Regelinsolvenz, Verbraucherinsolvenz, Sonderformen)
- Restschuldbefreiung
- Bedeutung der Insolvenzordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort verweist auf aktuelle Beispiele von Insolvenzen und betont die Bedeutung der einheitlichen Insolvenzordnung von 1999, die ein verbessertes Insolvenzrecht für alle Bundesländer geschaffen hat und die Abwicklung von Insolvenzen regelt. Es hebt die drei zentralen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hervor: Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.
Voraussetzungen einer Insolvenz: Dieses Kapitel erläutert die drei wesentlichen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens: Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Es wird detailliert auf die einzelnen Voraussetzungen eingegangen, wobei insbesondere die Zahlungsunfähigkeit als häufigster Grund im Detail beschrieben wird. Die Rolle des Insolvenzgerichts bei der Ermittlung und Bestätigung des Eröffnungsgrundes wird ebenfalls beleuchtet.
Formen einer Insolvenz: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Formen von Insolvenzverfahren, unterteilt in Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen. Es geht auf das Regelinsolvenzverfahren (mit Insolvenzplanverfahren und Eigenverwaltung) und das Verbraucherinsolvenzverfahren (inklusive außergerichtlicher und gerichtlicher Schuldenbereinigung sowie des vereinfachten Verfahrens) ein. Zusätzlich werden Sonderformen wie Nachlassinsolvenz, Insolvenzverfahren über Gütergemeinschaft und grenzüberschreitende Insolvenzverfahren erwähnt.
Schlüsselwörter
Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzordnung, Unternehmensinsolvenz, Verbraucherinsolvenz, Regelinsolvenzverfahren, Insolvenzplanverfahren, Eigenverwaltung, Schuldenbereinigung, Restschuldbefreiung, Sonderformen des Insolvenzverfahrens.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Insolvenzrecht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Insolvenzrecht. Sie behandelt die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, die verschiedenen Arten von Insolvenzverfahren und die Restschuldbefreiung. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen.
Welche Voraussetzungen müssen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegen?
Die drei zentralen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sind Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Die Arbeit erläutert jede dieser Voraussetzungen detailliert, mit besonderem Augenmerk auf die Zahlungsunfähigkeit als häufigsten Grund. Die Rolle des Insolvenzgerichts bei der Prüfung dieser Voraussetzungen wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Arten von Insolvenzverfahren werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Unternehmensinsolvenzverfahren und Verbraucherinsolvenzverfahren. Zu den Unternehmensinsolvenzverfahren gehört das Regelinsolvenzverfahren mit den Möglichkeiten des Insolvenzplanverfahrens und der Eigenverwaltung. Verbraucherinsolvenzverfahren umfassen das außergerichtliche und gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren sowie das vereinfachte Verbraucherinsolvenzverfahren. Zusätzlich werden Sonderformen wie Nachlassinsolvenz, Insolvenzverfahren über Gütergemeinschaft und grenzüberschreitende Insolvenzverfahren behandelt.
Was ist die Restschuldbefreiung?
Die Arbeit erwähnt die Restschuldbefreiung, ein wichtiger Aspekt im Kontext von Verbraucherinsolvenzverfahren. Nähere Details zur Restschuldbefreiung werden jedoch nicht explizit im Inhaltsverzeichnis oder der Zusammenfassung der Kapitel genannt. Weitere Informationen dazu müssten im Haupttext der Arbeit selbst nachgeschlagen werden.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Eröffnungsgründe der Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung), die Unterscheidung zwischen Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzverfahren, verschiedene Formen von Insolvenzverfahren (Regelinsolvenz, Verbraucherinsolvenz, Sonderformen) sowie die Restschuldbefreiung und die Bedeutung der Insolvenzordnung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzordnung, Unternehmensinsolvenz, Verbraucherinsolvenz, Regelinsolvenzverfahren, Insolvenzplanverfahren, Eigenverwaltung, Schuldenbereinigung, Restschuldbefreiung und Sonderformen des Insolvenzverfahrens.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einem Vorwort, gefolgt von Kapiteln zu den Voraussetzungen einer Insolvenz, den Formen der Insolvenz, einer Zusammenfassung und einer Liste der Schlüsselwörter. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Abschnitte.
Was ist der Zweck des Vorworts?
Das Vorwort verweist auf aktuelle Insolvenzbeispiele und betont die Bedeutung der einheitlichen Insolvenzordnung von 1999. Es hebt die drei zentralen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung) hervor.
- Quote paper
- Nicole Lehnen (Author), Dijana Bradara (Author), 2012, Formen und Voraussetzungen einer Insolvenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321922