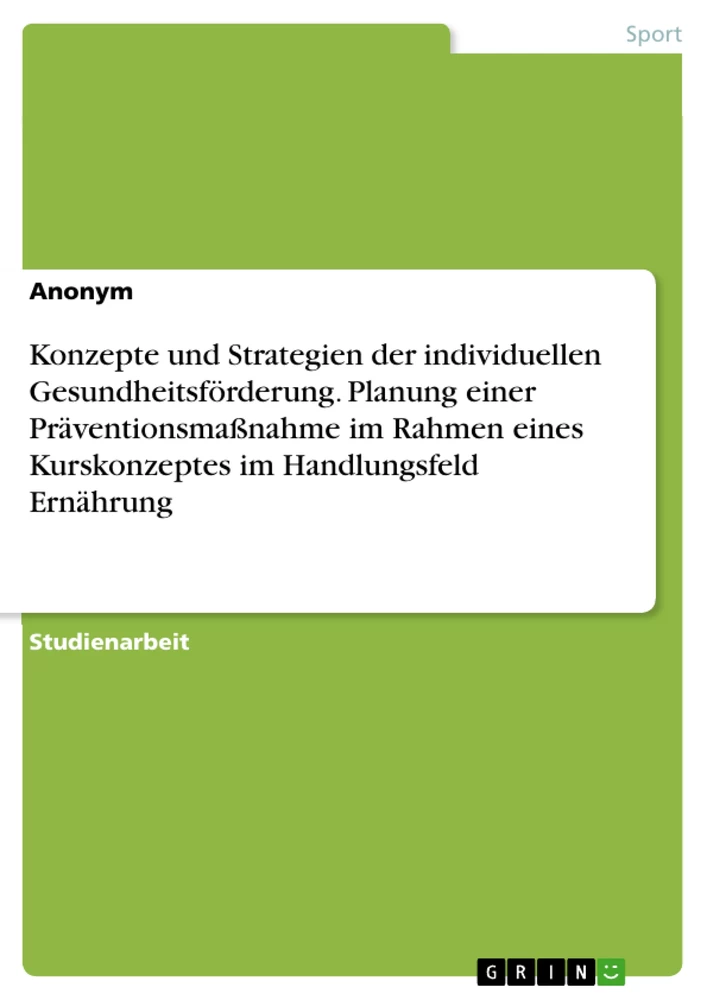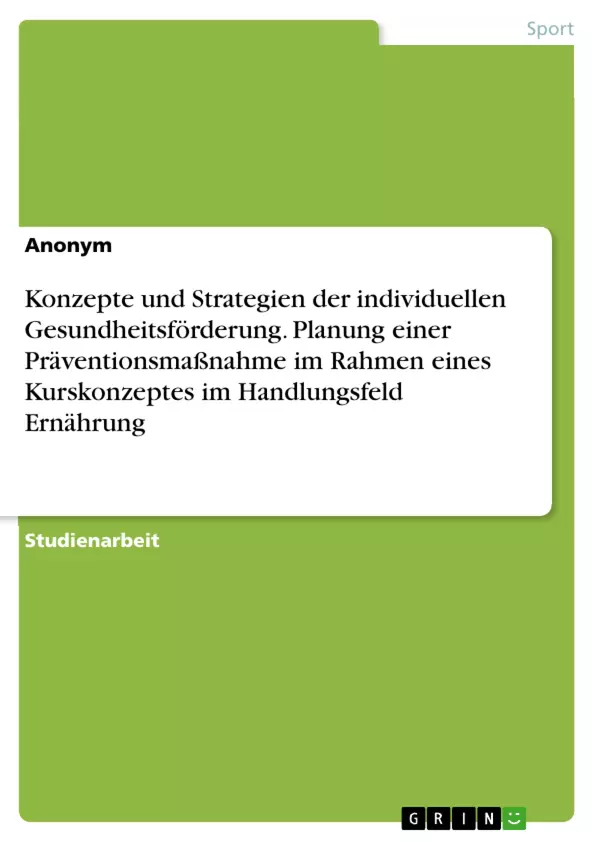Die vorliegende Arbeit hat die „Planung einer Präventionsmaßnahme nach dem individuellen Ansatz“ zum Thema. Die Präventionsmaßnahme findet im Rahmen eines Kurskonzeptes im Handlungsfeld Ernährung statt. Das Konzept wird in Anlehnung an den „Leitfaden Prävention – Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von §§20 und 20a SGB V vom 21.Juni 2000 in der Fassung vom 27.August 2010“ erstellt. Der GKV-Spitzenverband gibt klare Kriterien, die es zu erfüllen gilt, damit die Maßnahmen von den Krankenkassen gefördert werden.
Der Titel des Kurses lautet „Leichter durch den Alltag“. Durch den Titel soll ein positives Bild assoziiert werden. Zum einen geht es um Gewichtsreduktion. Man bewegt sich „leichter“, also mit weniger Körpergewicht im Alltag. Des Weiteren steht auch die Alltagsbewältigung im Bezug zur Ernährung im Vordergrund. Diese soll im Rahmen des Kurses durch Erlernen entsprechender Techniken und nötigem Wissen „erleichtert“ werden, so dass eine langfristige und wirksame Verhaltensänderung erreicht werden kann. Bei der Auswahl des Titels wurden bewusst unnötige Zusätze wie dauerhaft, langfristig oder eigenständig weggelassen. Der Titel soll den Eindruck eines einfach umzusetzenden aber trotzdem wirkungsvollen Konzeptes erwecken und nicht unnötig kompliziert sein.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlegende Angaben zum Schwerpunktthema der geplanten Präventionsmaßnahme
- Titel
- Handlungsfeld und Präventionsprinzip
- Daten zum bestehenden Gesundheitsproblem
- Wirksamkeitsbeleg
- Zielgruppe
- Soziodemografische Merkmale:
- Sozialstatus
- Gesundheitszustand
- Gesundheitsverhalten
- Kontraindikatoren, Ausschlusskriterien
- Mögliche Teilnehmermotive und -ziele
- Ziele der Präventionsmaßnahme
- Inhaltlich-organisatorische Grobplanung des Kurskonzeptes
- Inhaltlich-methodische Detailplanung des Kurskonzeptes
- Darstellung der Detailplanung
- Didaktisch-methodischer Kursaufbau
- Dokumentation und Evaluation des Kurskonzeptes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Planung einer Präventionsmaßnahme im Handlungsfeld Ernährung, die auf dem individuellen Ansatz basiert. Das Ziel ist es, ein Kurskonzept zu entwickeln, das den Kriterien des GKV-Spitzenverbandes entspricht und somit eine Förderung durch die Krankenkassen ermöglicht. Der Kurs soll Übergewicht und Adipositas vorbeugen und gleichzeitig die Alltagsbewältigung im Bezug zur Ernährung verbessern.
- Prävention von Übergewicht und Adipositas
- Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten
- Steigerung der Handlungskompetenz im Bereich Ernährung
- Förderung der Motivation zur Verhaltensänderung
- Vermittlung von wissenschaftlich fundierten Ernährungskenntnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Angaben zum Schwerpunktthema der geplanten Präventionsmaßnahme. Es werden der Titel, das Handlungsfeld, das Präventionsprinzip, Daten zum bestehenden Gesundheitsproblem, der Wirksamkeitsbeleg und die Zielgruppe definiert. Das zweite Kapitel widmet sich der inhaltlich-organisatorischen Grobplanung des Kurskonzeptes. Im dritten Kapitel erfolgt die inhaltlich-methodische Detailplanung des Kurskonzeptes, wobei die Darstellung der Detailplanung und der didaktisch-methodische Kursaufbau im Fokus stehen. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Dokumentation und Evaluation des Kurskonzeptes.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Präventionsmaßnahme, Ernährung, Übergewicht, Adipositas, individuelles Konzept, GKV-Spitzenverband, Verhaltensänderung, Handlungskompetenz, Motivation, Evidenzbasierte Ernährung, Kurskonzept.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Kurses „Leichter durch den Alltag“?
Ziel ist die Prävention von Übergewicht und Adipositas durch die Verbesserung von Ernährungsgewohnheiten und Alltagskompetenzen.
Werden solche Präventionskurse von Krankenkassen gefördert?
Ja, wenn sie den Kriterien des GKV-Spitzenverbandes nach §§ 20 und 20a SGB V entsprechen.
An wen richtet sich die geplante Präventionsmaßnahme?
An Personen mit bestehenden Ernährungsproblemen oder dem Wunsch zur Gewichtsreduktion, unter Berücksichtigung soziodemografischer Merkmale.
Wie wird die Wirksamkeit des Kurses sichergestellt?
Durch die Anwendung wissenschaftlich fundierter Ernährungskenntnisse und eine systematische Evaluation des Kurskonzeptes.
Was bedeutet „individuelle Gesundheitsförderung“ in diesem Kontext?
Es bedeutet, dass der Kurs auf die Verhaltensänderung des Einzelnen abzielt, um langfristig die Gesundheit zu verbessern.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Konzepte und Strategien der individuellen Gesundheitsförderung. Planung einer Präventionsmaßnahme im Rahmen eines Kurskonzeptes im Handlungsfeld Ernährung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321958