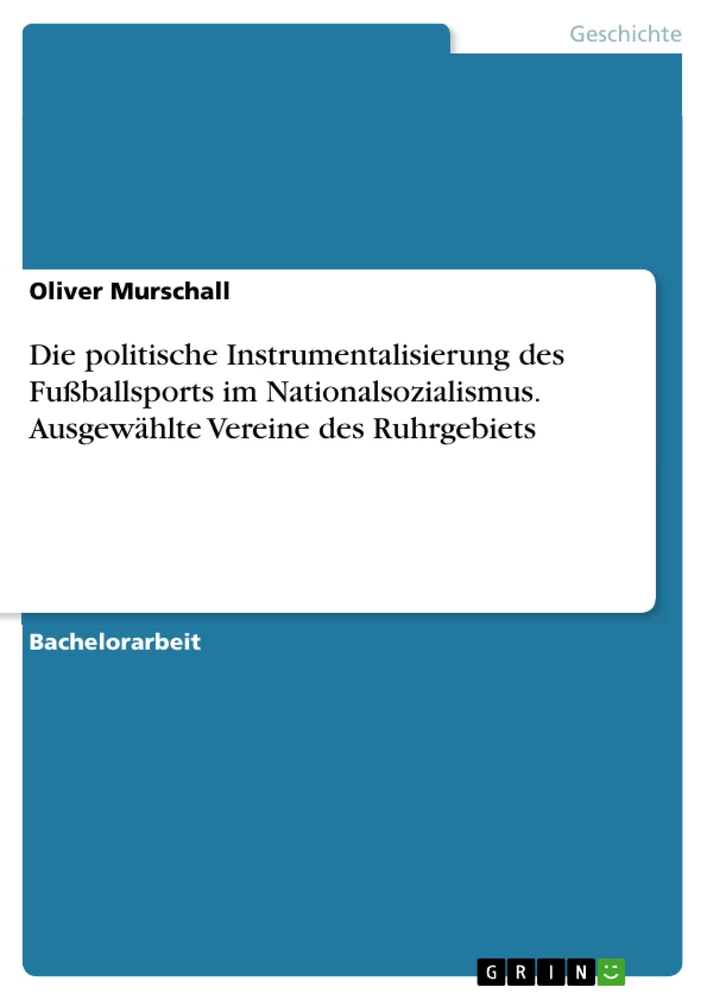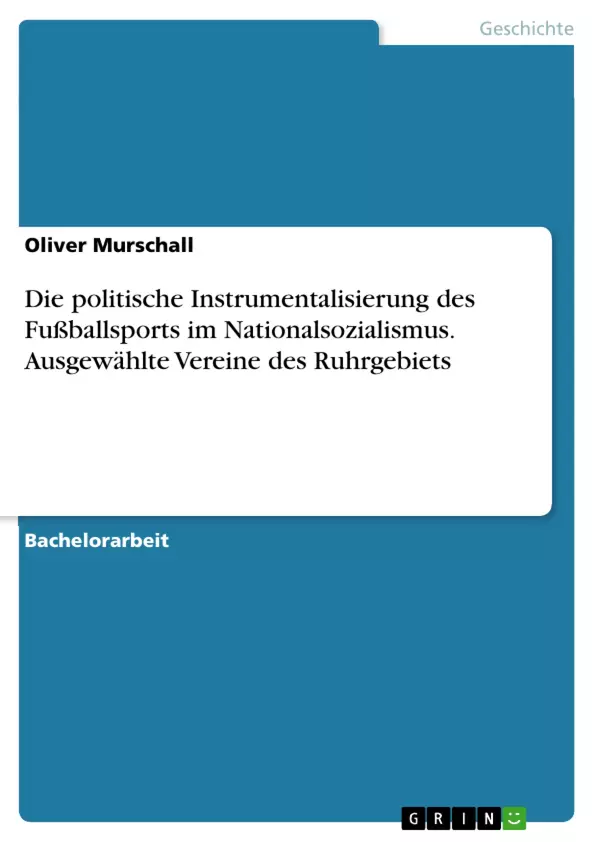Die gegenseitige Verbundenheit und Abhängigkeit von Politik und Sport war immer schon stärker als allgemein angenommen. Besondere sportliche Ereignisse haben auch Dank der medialen Präsenz oftmals eine politische Wirkung und werden daher für politische Zwecke genutzt bzw. missbraucht. Vor allem sportliche Großereignisse globalen Ausmaßes wie Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften dienen als Plattform für die Politik, sich der Welt zu präsentieren. Berühmte Beispiele sind zahlreich in der Geschichte des Sports. Zu denken ist dabei z.B. an die Inszenierung der nationalsozialistischen Ideologie während der Olympischen Spiele in Berlin 1936. Ebenso dienen diese Ereignisse als politisches Instrument der Machtdemonstration, wie die zahlreichen Boykotts bei Olympischen Spielen beweisen, die ihre Höhepunkte bei den Spielen 1976 in Montreal, 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles fanden. Diese Exempel zeigen, dass Sport und Politik sich nicht immer trennen lassen, sondern eng verzahnt sind.
Die Politisierung des sportlichen Wettkampfes und das Messen mit anderen Nationen passte auch in die Vorstellungen der Nationalsozialisten einer überlegenen Herrenrasse, die andere Völker zu unterwerfen hat. Daher stellt sich die Frage, inwieweit das nationalsozialistische Regime den Sport als politisches und ideologisches Instrument nutzte und für seine Zwecke missbrauchte. Diese Fragestellung wird in der vorliegenden Arbeit behandelt. Darüber hinaus ist aber die andere Seite zu beleuchten und die Frage zu beantworten, ob und auf welche Weise der Sport die politische Funktionalisierung akzeptierte und sich für die nationalsozialistische Ideologie einspannen ließ. Schließlich ist der gesellschaftliche Aspekt dieser Konstellation zu berücksichtigen, indem es zu beantworten gilt, welche gesellschaftlichen Veränderungen der national-sozialistischen Herrschaft sich auf den sportlichen Bereich übertragen haben.
Die Untersuchung bezieht sich auf den Spitzensport und nicht auf den Breitensport. Zudem beschränken sich die Analysen auf den Fußball, da dieser bereits in den 1920er Jahren zur beliebtesten Sportart in Deutschland avancierte und insbesondere in der größten deutschen Bevölkerungsgruppe, den Arbeitern, eine besonders hohe Popularität besaß. Der Fokus der Untersuchungen liegt weiterhin im Ruhrgebiet. Die Untersuchungen werden für Schalke 04, Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und Westfalia Herne durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Forschungsstand und Quellenlage
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2 Relevante Entwicklungen im Ruhrgebiet
- 2.1 Fußball vor 1933 - Entwicklung zum Volkssport
- 2.2 Fußball ab 1933 - Gleichschaltung im Nationalsozialismus
- 2.3 Wirtschaft und Politik im Ruhrgebiet
- 3 Ausgewählte Ruhrgebietsvereine von ihrer Entstehung bis zum Nationalsozialismus
- 3.1 FC Schalke 04
- 3.2 Borussia Dortmund
- 3.3 Westfalia Herne
- 3.4 Rot-Weiss Essen
- 4 Analyse der Instrumentalisierung des Fußballsports
- 4.1 Initiierung durch das Regime
- 4.2 Akzeptanz und Widerstand der Vereine
- 4.3 Fußball als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen
- 4.4 Resümee
- 5 Schlussbetrachtung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Instrumentalisierung des Fußballsports im Nationalsozialismus am Beispiel ausgewählter Vereine des Ruhrgebiets. Sie beleuchtet, inwieweit das nationalsozialistische Regime den Sport für seine Zwecke missbrauchte und wie der Sport diese Funktionalisierung akzeptierte. Darüber hinaus analysiert die Arbeit die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auf den sportlichen Bereich übertragen haben.
- Die Rolle des Fußballs als politisches Instrument im Nationalsozialismus
- Die Akzeptanz und den Widerstand der Vereine gegenüber der nationalsozialistischen Ideologie
- Der Einfluss der nationalsozialistischen Herrschaft auf die Entwicklung des Fußballsports
- Die Nutzung des Fußballs als Mittel der Propaganda und zur Durchsetzung der NS-Ideologie
- Die gesellschaftlichen Veränderungen im Ruhrgebiet im Kontext des Nationalsozialismus und deren Auswirkungen auf den Fußball
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Problemstellung, den Forschungsstand und den Gang der Untersuchung dar. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung des Fußballs im Ruhrgebiet vor und nach 1933, wobei der Fokus auf der Gleichschaltung des Sports unter dem Nationalsozialismus liegt. Kapitel 3 stellt die Entstehung und Entwicklung der ausgewählten Vereine im Ruhrgebiet bis zum Nationalsozialismus dar. Kapitel 4 analysiert die Instrumentalisierung des Fußballs durch das Regime, die Akzeptanz und den Widerstand der Vereine sowie die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Fußball, Ruhrgebiet, Instrumentalisierung, Sport, Gleichschaltung, Propaganda, Vereine, Gesellschaftliche Veränderungen, Akzeptanz, Widerstand, Ideologie.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzten die Nationalsozialisten den Fußball für ihre Zwecke?
Fußball diente als Propagandainstrument zur Demonstration von Stärke und zur Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie in der breiten Bevölkerung.
Was versteht man unter der „Gleichschaltung“ von Fußballvereinen?
Ab 1933 wurden Vereine organisatorisch und ideologisch dem NS-Regime unterstellt, jüdische Mitglieder wurden ausgeschlossen und Vereinsstrukturen angepasst.
Welche Vereine aus dem Ruhrgebiet wurden in der Studie untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Schalke 04, Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und Westfalia Herne.
Gab es Widerstand in den Fußballvereinen gegen das Regime?
Die Arbeit analysiert das Spannungsfeld zwischen Akzeptanz, Mitläufertum und punktuellem Widerstand innerhalb der Vereinsführungen und Spielerschaften.
Warum war Fußball besonders im Ruhrgebiet so wichtig für die Politik?
Fußball war bereits in den 1920er Jahren Volkssport der Arbeiterklasse im Revier, weshalb das Regime hier ein besonders hohes Mobilisierungspotenzial sah.
- Citation du texte
- Oliver Murschall (Auteur), 2016, Die politische Instrumentalisierung des Fußballsports im Nationalsozialismus. Ausgewählte Vereine des Ruhrgebiets, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322128