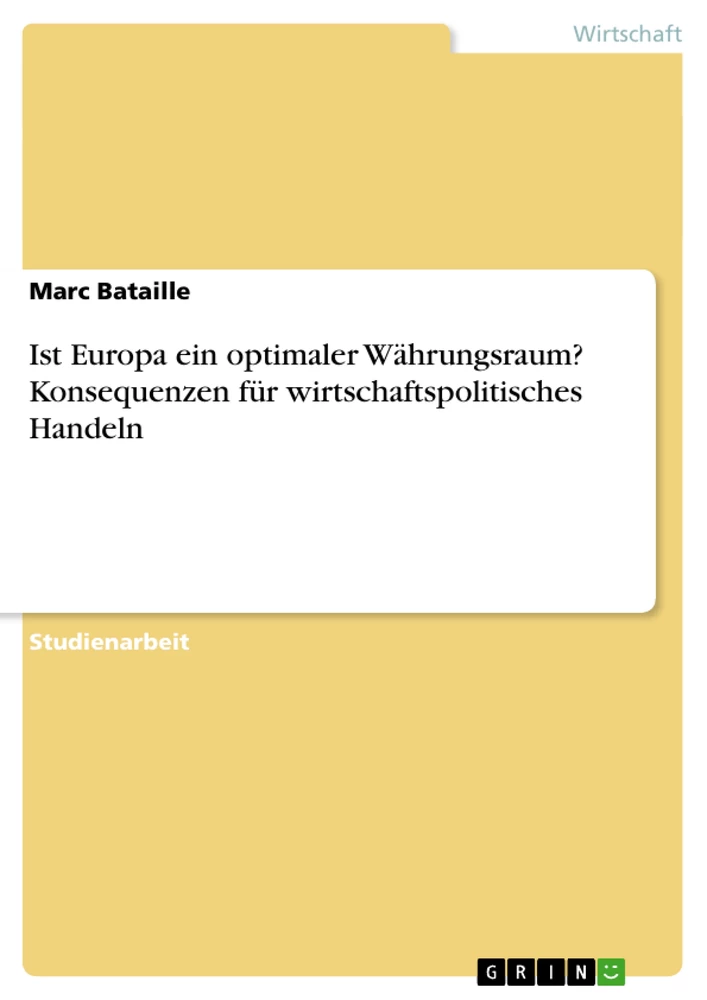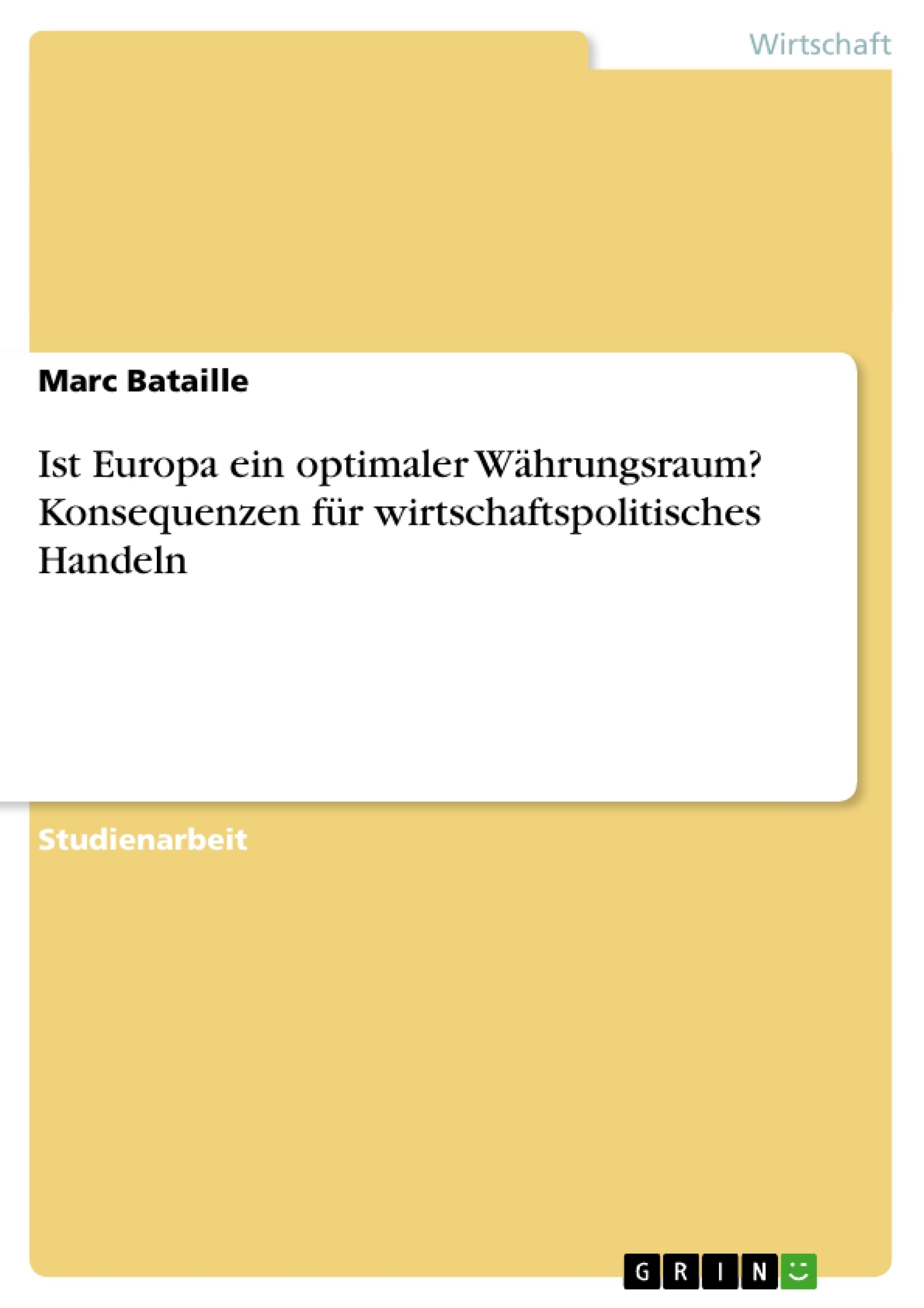Seit dem Jahr 1999 hat Europa mit dem Euro eine gemeinsame Währung. Zwar sind längst nicht alle europäischen Länder und auch nicht alle Mitglieder der Europäischen Union Teil des neuen Währungsraumes, jedoch hat sich der Euro als neue europäische Gemeinschaftswährung mittlerweile fest etabliert. So scheint ein gemeinsamer Währungsraum doch auf den ersten Blick nur Vorteile zu haben. Bereits im Jahre 1948 stellte der britische Nationalökonom John Stuart Mill fest, dass es einer „Barbarei“ gleich käme, dass zivilisierte Staaten daran festhielten, ihre nationalen Währungen beizubehalten. 1 Dabei spielte der Utilitarist vor allem auf die mikroökonomischen Nutzenvorteile einer Gemeinschaftswährung an, die sich aus einer Erleichterung des Zahlungsverkehres für einen selbst und den internationalen Handelspartner ergäben.
Tatsächlich scheint die Beibehaltung einer nationalen Währung ein besonderes Zeichen nationalstaatlicher Souveränität darzustellen. Aus dieser politischen Implikation heraus ist es auch nicht verwunderlich, dass auch Europa erst mit Fortschreiten der nationalen Integration zu einer Gemeinschaftswährung gefunden hat. Insofern scheint ein optimaler Währungsraum auch einen Teil eines Integrationsraumes darzustellen. Reziprok dazu scheint eine Gemeinschaftswährung aber auch zu einer weiteren Einigung beizutragen. Es stellt sich also die Frage, ab wann ein Integrationsprozess so weit fortgeschritten ist, dass er durch eine gemeinsame Währungsunion weiter verstärkt werden sollte. Über diese politische Perspektive hinaus sind ökonomische Kriterien die Entscheidenden, die einen Währungsraum abgrenzen. Diverse Theorien erweitern das auf der Hand liegende, einseitige Nutzenkriterium Mills um diverse weitere Faktoren. In der traditionellen Theorie optimaler Währungsräume, wird dabei versucht, Optimalitätskriterien zu operationalisieren, die zur Bestimmung eines Gebietes als optimalen Währungsraum beitragen sollen. Diese Theorie setzt insbesondere eine hohe Konvergenz der Mitgliedsstaaten voraus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 DER WEG ZUR EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTSWÄHRUNG
- 1.2 ZIELE DER EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSUNION
- 1.3 ÖKONOMISCHE THEORIEN ÜBER DIE ABGRENZUNG OPTIMALER WÄHRUNGSRÄUME
- 2. TRADITIONELLE THEORIE OPTIMALER WÄHRUNGSRÄUME
- 2.1 ANPASSUNG FLEXIBLER WECHSELKURSE
- 2.2 LEITSATZ DER TRADITIONELLEN THEORIE OPTIMALER WÄHRUNGSRÄUME
- 2.3 DIE STRUKTURELLEN KRITERIEN DER TRADITIONELLEN THEORIE
- 2.3.1 FAKTORMOBILITÄT
- 2.3.2 OFFENHEITSGRAD
- 2.3.3 GRAD DER DIVERSIFIKATION
- 2.3.4 KRITERIUM DER STABILEN REALEN WECHSELKURSE
- 2.4 VERGANGENHEITSORIENTIERTE, WIRTSCHAFTSPOLITISCHE HOMOGENITÄTSKRITERIEN
- 3.5 FAZIT AUS DEN TRADITIONELLEN THEORIEN
- 3. NEUERE THEORIEN ZUR EINSTUFUNG OPTIMALER WÄHRUNGSRÄUME
- 3.1 KOSTEN/NUTZEN ANALYSE
- 3.2 ZUKUNFTSORIENTIERTE ANSÄTZE
- 3.3 ZUKUNFTSORIENTIERTE, WIRTSCHAFTSPOLITISCHE IMPLIKATIONEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, ob Europa einen optimalen Währungsraum darstellt. Dazu werden die traditionellen Theorien optimaler Währungsräume analysiert und mit den spezifischen Eigenschaften Europas verglichen. Weiterhin werden neuere Theorien zur Abgrenzung optimaler Währungsräume beleuchtet und auf Europa angewendet.
- Die Kosten und Nutzen einer Währungsunion im Vergleich zu flexiblen Wechselkursen
- Die Kriterien der traditionellen Theorie optimaler Währungsräume, insbesondere Faktormobilität, Offenheitsgrad, Diversität und stabile reale Wechselkurse
- Neuere Theorien, die Kosten/Nutzen-Analysen und zukunftsorientierte Ansätze berücksichtigen
- Die Auswirkungen der Europäischen Währungsunion auf die europäische Wirtschaft
- Die Rolle der Wirtschaftspolitik in einem optimalen Währungsraum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Europäischen Währungsunion ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die traditionelle Theorie optimaler Währungsräume und untersucht die Kriterien, die für einen optimalen Währungsraum erfüllt sein müssen. Kapitel 3 analysiert neuere Theorien zur Abgrenzung optimaler Währungsräume, die Kosten/Nutzen-Analysen und zukunftsorientierte Ansätze berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Europäische Währungsunion, optimale Währungsräume, flexible Wechselkurse, Faktormobilität, Offenheitsgrad, Diversität, stabile reale Wechselkurse, Kosten/Nutzen-Analyse, Wirtschaftspolitik, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Ist Europa ein optimaler Währungsraum?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand ökonomischer Kriterien wie Faktormobilität und Homogenität und vergleicht Theorie mit der Realität der Eurozone.
Was sind die Kriterien der traditionellen Theorie optimaler Währungsräume?
Zentrale Kriterien sind eine hohe Mobilität der Produktionsfaktoren (Arbeit/Kapital), ein hoher Offenheitsgrad der Volkswirtschaften und eine starke Diversifikation.
Welchen mikroökonomischen Nutzen hat der Euro?
Der Euro erleichtert den Zahlungsverkehr, senkt Transaktionskosten und beseitigt Wechselkursrisiken innerhalb des gemeinsamen Marktes.
Was bedeutet "Faktormobilität" in einer Währungsunion?
Es beschreibt die Fähigkeit von Arbeitskräften und Kapital, in Regionen mit besserer wirtschaftlicher Lage abzuwandern, um Schocks ohne Wechselkursanpassungen auszugleichen.
Welche Rolle spielt die politische Integration?
Die Arbeit diskutiert, ob eine Währungsunion erst am Ende eines Integrationsprozesses stehen sollte oder ob sie diesen Prozess beschleunigen kann.
- Citation du texte
- Marc Bataille (Auteur), 2004, Ist Europa ein optimaler Währungsraum? Konsequenzen für wirtschaftspolitisches Handeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32215