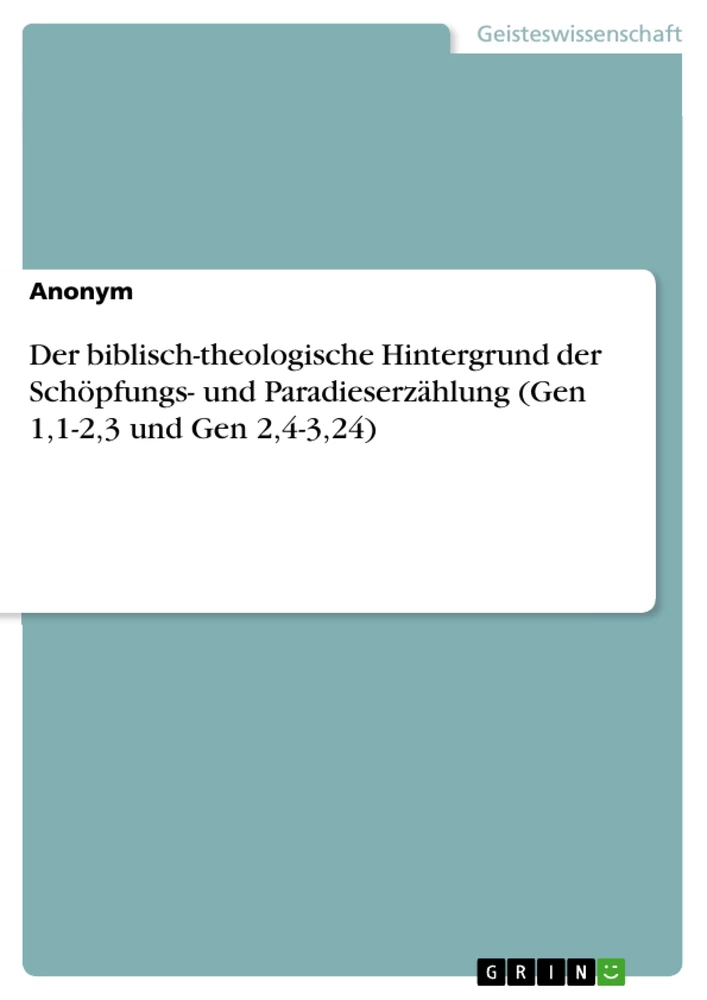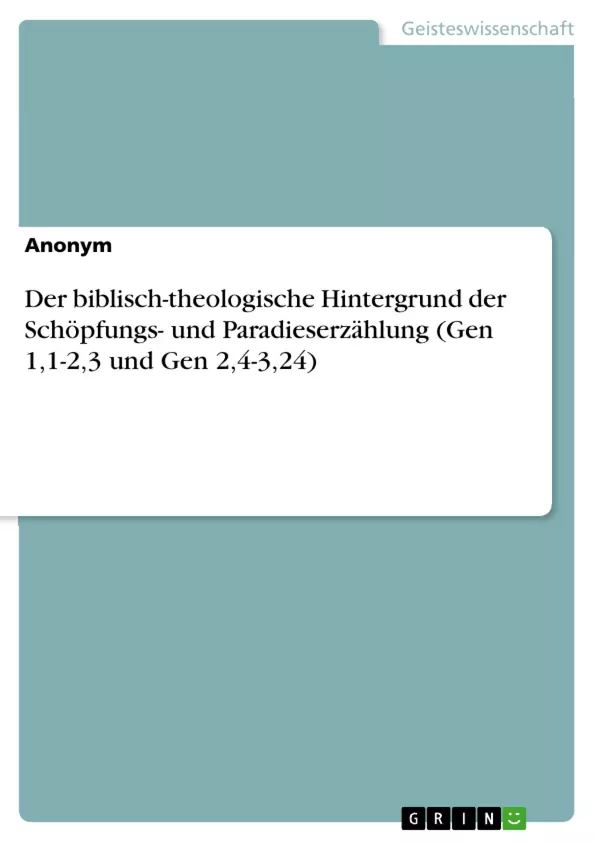Die vorliegende Arbeit bietet einen Überblick über die Schöpfungs- sowie die Paradieserzählung aus biblisch-theologischer Sicht. Auf dogmatische und ethische Ausführungen wird dabei verzichtet. Die Struktur des Textes, "Bibelkundliche Erschließung", "Literatur- und forschungsgeschichtliche Problemanzeige" und "Theologie", geht auf Jan Christian Gertz zurück.
Die Schöpfungs- und Paradieserzählung (Gen 1,1-2,3 beziehungsweise Gen 2,4-3,24) sind Teil der sogenannten Urgeschichte, die von Gen 1-11 reicht. Diese lässt sich in drei Teile gliedern:
(1) die Erschaffung der Welt und die Entfaltung menschlichen Lebens darin (Gen 1,1-6,4),
(2) die Sintfluterzählung (Gen 6,5-9,18) und
(3) die Völkergeschichte (Gen 9,19-11,32).
Beide Erzählungen thematisieren das Schöpfungshandeln Gottes, widersprechen sich aber inhaltlich. Die Schöpfungserzählung zeichnet das Bild einer überschwemmten Erde (bedrohliche Urflut bzw. das Urmeer Tehôm, das die Erde vollends umgibt) und einer daraus auftauchenden Erdscheibe mit einer sukzessiven Bevölkerung, an deren Ende der Mensch als Mann und Frau – in Analogie zu der Schöpfung der Tiere – steht. Der Mensch wird mit der Herrschaft über die anderen Lebewesen beauftragt (dominium terrae). Auffallend ist, dass Gott seine Schöpfung stets mit der „Billigungsformel“ als gut bzw. – nach der „Generalinspektion“ in Gen 1,31 – als sehr gut bewertet. Gut steht für die Lebensdienlichkeit der geschaffenen Sache, sehr gut dafür, dass sie „ganz auf gelingendes Leben hin ausgerichtet [ist]“ (Schmid 2012: 80). Ergänzend meinen die beiden Prädikationen, […] daß das Ergebnis der Absicht Gottes entspricht“ (Kaiser 1998: 254). Geprägt ist die Schöpfungserzählung durch die Gottesbezeichnung Elohim (Gott).
Inhaltsverzeichnis
- Bibelkundliche Erschließung
- Literatur- und forschungsgeschichtliche Problemanzeige
- Die Schöpfungserzählung (Gen 1,1-2,3)
- Die Paradieserzählung (Gen 2,4-3,24)
- Zur Entstehung beider Erzählungen
- Theologie
- Allgemeines
- Schöpfungserzählung
- Paradieserzählung
- Exkurs: Bundestheologie der Priesterschrift
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text bietet eine umfassende Analyse der Schöpfungs- und Paradieserzählung aus biblisch-theologischer Perspektive. Er befasst sich mit der Entstehung und den Inhalten beider Erzählungen, beleuchtet die unterschiedlichen Theologien, die ihnen zugrunde liegen, und untersucht die Bedeutung der Gottesebenbildlichkeit im Schöpfungsprozess.
- Die Entstehung und Entwicklung der Schöpfungs- und Paradieserzählungen
- Die unterschiedlichen theologischen Perspektiven in den Erzählungen
- Die Bedeutung der Gottesebenbildlichkeit und des Herrschaftsauftrags
- Die Rolle des Wortes Gottes in der Schöpfung
- Die Interpretation der Schöpfungsgeschichte im Kontext des Alten Testaments
Zusammenfassung der Kapitel
Die Kapitel der Arbeit befassen sich mit der biblisch-theologischen Interpretation der Schöpfungs- und Paradieserzählungen. Der erste Teil stellt die beiden Erzählungen vor und untersucht ihre Entstehung und Entwicklung. Dabei werden auch die unterschiedlichen theologischen Perspektiven beleuchtet, die den beiden Erzählungen zugrunde liegen. Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Theologie der Schöpfungserzählung, die Paradieserzählung und die Bundestheologie der Priesterschrift.
Schlüsselwörter
Schöpfungserzählung, Paradieserzählung, Gottesebenbildlichkeit, Herrschaftsauftrag, Pentateuch, Priesterschrift, Jahwist, Elohist, biblisch-theologische Interpretation, Schöpfungstheologie, Urgeschichte, Bundestheologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen der Schöpfungs- und der Paradieserzählung?
Die Schöpfungserzählung (Gen 1) beschreibt eine sukzessive Entstehung der Welt aus dem Urwasser, während die Paradieserzählung (Gen 2) den Menschen und seinen Lebensraum in den Mittelpunkt stellt.
Was bedeutet die „Billigungsformel“ in Genesis 1?
Gott bewertet seine Schöpfung als „gut“ oder „sehr gut“, was bedeutet, dass das Ergebnis seiner Absicht entspricht und auf gelingendes Leben ausgerichtet ist.
Welche Gottesbezeichnungen werden in den Erzählungen verwendet?
In der Schöpfungserzählung wird Gott als „Elohim“ bezeichnet, während die Paradieserzählung oft dem Jahwisten zugeordnet wird.
Was beinhaltet das „dominium terrae“?
Es ist der Auftrag an den Menschen, über die anderen Lebewesen zu herrschen und die Erde zu gestalten.
Wie gliedert sich die biblische Urgeschichte?
Sie umfasst die Erschaffung der Welt (Gen 1-6), die Sintfluterzählung (Gen 6-9) und die Völkergeschichte (Gen 9-11).
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Der biblisch-theologische Hintergrund der Schöpfungs- und Paradieserzählung (Gen 1,1-2,3 und Gen 2,4-3,24), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322340