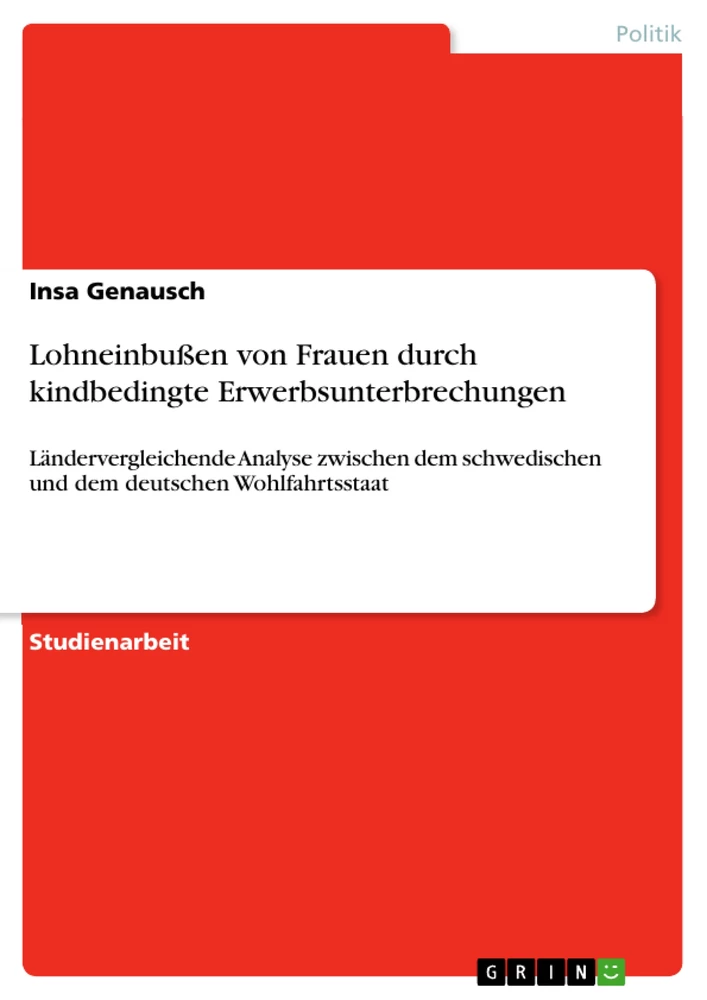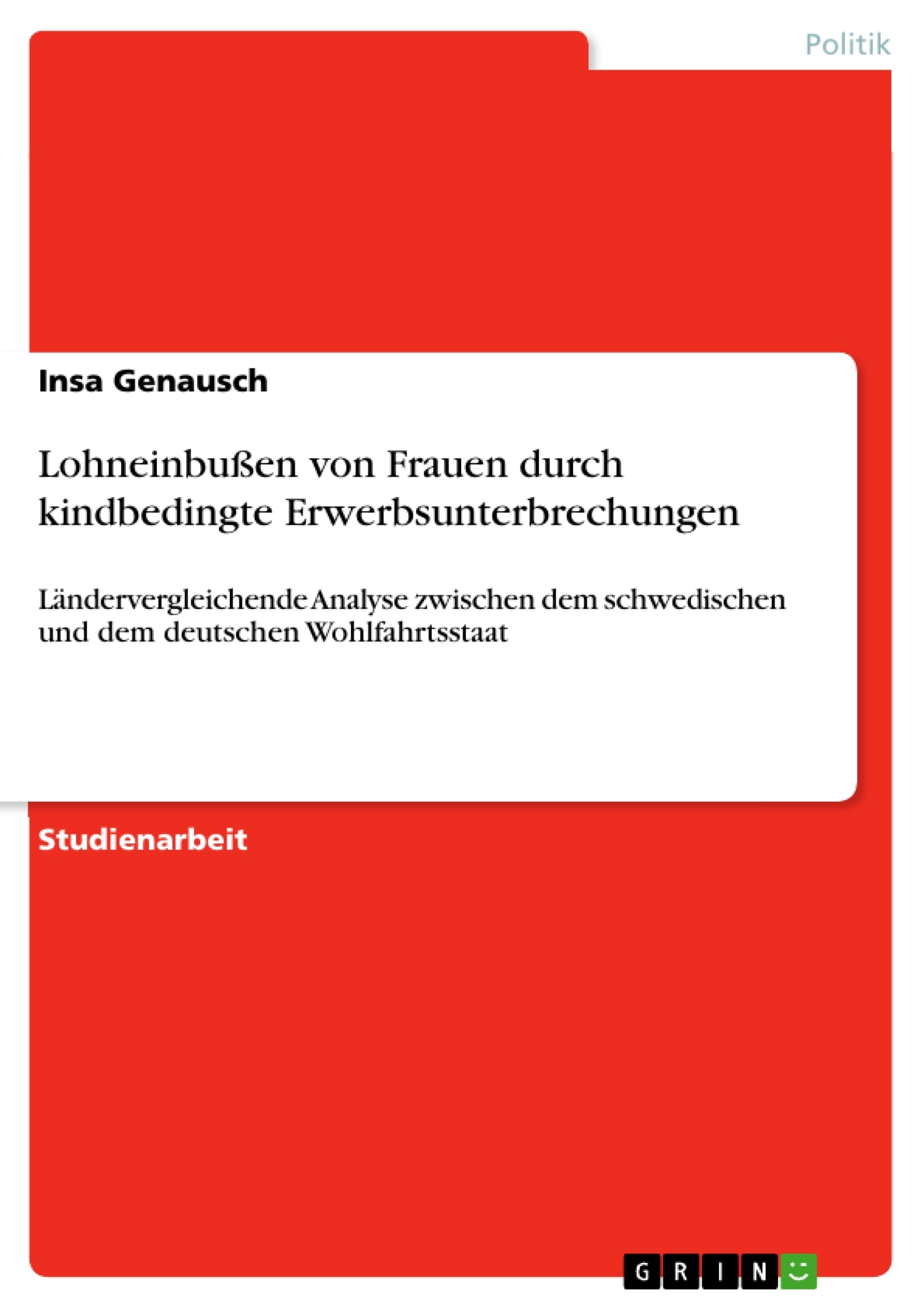Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit kindbedingten Erwerbsunterbrechungen von Müttern in Deutschland und Schweden. Dabei wird der Ländervergleich auf den beruflichen Wiedereinstieg und deren Karrierefolgen gelenkt.
Die zentrale Leitfrage, die sich daraus ergibt und im folgenden beantwortet werden soll, lautet: Welche Auswirkungen haben schwangerschaftsbedingte Erwerbsunterbrechungen von Müttern auf deren Wiedereinstieg in das Berufsleben und deren Lohnentwicklung innerhalb der unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsregime Deutschland und Schweden?
Unter Bezug auf die jeweiligen landestypischen familienpolitischen Maßnahmen soll am Ende diskutiert werden durch welche Leistungen Anreize und Restriktionen für deutsche und schwedische Mütter entstehen, die die eventuellen Lohneinbußen nach der Mutterschaft verhindern oder fördern.
Um einen Einblick in die jeweilige Erwerbsbeteiligungsstruktur und Beschäftigungsmuster von Frauen in Deutschland und Schweden zu bekommen werden diese im nachfolgenden erläutert. Daran schließt sich die Wohlfahrtstypologie von Esping-Andersen an, die als Zuordnungsprinzip der jeweiligen Länder dient, um im daran folgenden Kapitel zu den modernen Sozialpolitiken besser verstehend kann, auf welcher Wohlfahrtsstaatslogik bestimmte Leistungen gründen und sich zuordnen lassen. Daran schliesst sich das Kapitel mit den länderspezifischen Ergebnissen der empirischen Studien zu Lohneinbußen nach der Mutterschaft. Unter Kontrolle von Unterbrechungsdauer und Bildungsgrad, werden die Einkommensentwicklungen vergleichend empirisch geklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erwerbsbeteiligung und Beschäftigungsmuster von Frauen
- Deutschland
- Schweden
- Wohlfahrtsregimetypologie nach Esping-Andersen
- Konservative-korporatistische Wohlfahrtsstaat
- Sozialdemokratischer Wohlfahrtstaat
- Familienpolitische Leistungen für Mütter nach einer schwangerschafts-bedingten Erwerbsunterbrechung
- Deutsche Sozialleistungen
- Schwedische Sozialleistungen
- Ausgewählte Studien über Lohnstrafen nach der Mutterschaft in Abhängigkeit von der Unterbrechungsdauer und dem Bildungsgrad
- Deutschland und Schweden im Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen von kindbedingten Erwerbsunterbrechungen von Müttern auf deren beruflichen Wiedereinstieg und Karrierefolgen in Deutschland und Schweden. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Frage, wie sich schwangerschaftsbedingte Erwerbsunterbrechungen auf die Lohnentwicklung von Müttern in den beiden Ländern mit unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsmodellen auswirken.
- Die Erwerbsbeteiligung und Beschäftigungsmuster von Frauen in Deutschland und Schweden
- Die Wohlfahrtsregimetypologie nach Esping-Andersen und ihre Auswirkungen auf die Familienpolitik
- Familienpolitische Leistungen für Mütter nach einer Erwerbsunterbrechung in Deutschland und Schweden
- Empirische Studien zu Lohneinbußen nach der Mutterschaft in Abhängigkeit von der Unterbrechungsdauer und dem Bildungsgrad
- Die Analyse von Anreizen und Restriktionen für deutsche und schwedische Mütter im Hinblick auf die Vermeidung oder Förderung von Lohneinbußen nach der Mutterschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Leitfrage der Arbeit vor: Welche Auswirkungen haben schwangerschaftsbedingte Erwerbsunterbrechungen von Müttern auf deren Wiedereinstieg in das Berufsleben und deren Lohnentwicklung innerhalb der unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsregime Deutschland und Schweden? Das Kapitel beleuchtet die Erwerbsbeteiligungsstruktur und Beschäftigungsmuster von Frauen in Deutschland und Schweden, wobei die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland hervorgehoben werden.
Das darauffolgende Kapitel erläutert die Wohlfahrtsregimetypologie von Esping-Andersen als Zuordnungsprinzip für die beiden Länder, um die modernen Sozialpolitiken und deren Logik zu verstehen. Im Anschluss werden die länderspezifischen familienpolitischen Leistungen für Mütter nach einer schwangerschaftsbedingten Erwerbsunterbrechung in Deutschland und Schweden vorgestellt.
Das fünfte Kapitel widmet sich ausgewählten empirischen Studien, die Lohneinbußen nach der Mutterschaft in Abhängigkeit von der Unterbrechungsdauer und dem Bildungsgrad untersuchen. Hierbei werden die Ergebnisse für Deutschland und Schweden vergleichend dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen kindbedingte Erwerbsunterbrechungen, Frauenerwerbstätigkeit, Wohlfahrtsstaatsregime, Familienpolitik, Lohnentwicklung, Mutterschaft, Deutschland, Schweden, Esping-Andersen, Erwerbsbeteiligung, Beschäftigungsmuster, Sozialleistungen, Lohnstrafen, Unterbrechungsdauer, Bildungsgrad.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirken sich Erwerbsunterbrechungen auf den Lohn von Müttern aus?
Kindbedingte Pausen führen oft zu sogenannten "Lohnstrafen", wobei die Höhe der Einbußen von der Dauer der Unterbrechung und dem Bildungsgrad abhängt.
Was unterscheidet Deutschland und Schweden in der Familienpolitik?
Deutschland wird als konservativ-korporatistischer Wohlfahrtsstaat klassifiziert, während Schweden einem sozialdemokratischen Modell mit stärkerer Förderung der Frauenerwerbstätigkeit folgt.
Welche Anreize bieten schwedische Sozialleistungen für Mütter?
Das schwedische System ist darauf ausgelegt, den schnellen Wiedereinstieg in den Beruf zu fördern und Lohneinbußen nach der Mutterschaft zu minimieren.
Spielt der Bildungsgrad eine Rolle bei den Lohneinbußen?
Ja, empirische Studien zeigen, dass der Bildungsgrad die Einkommensentwicklung nach der Rückkehr in den Beruf maßgeblich beeinflusst.
Welche Restriktionen gibt es für deutsche Mütter beim Wiedereinstieg?
Die Arbeit diskutiert, inwiefern landestypische Maßnahmen in Deutschland eher Anreize für längere Unterbrechungen schaffen, was die Karrierefolgen verschärfen kann.
- Arbeit zitieren
- Insa Genausch (Autor:in), 2013, Lohneinbußen von Frauen durch kindbedingte Erwerbsunterbrechungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322410