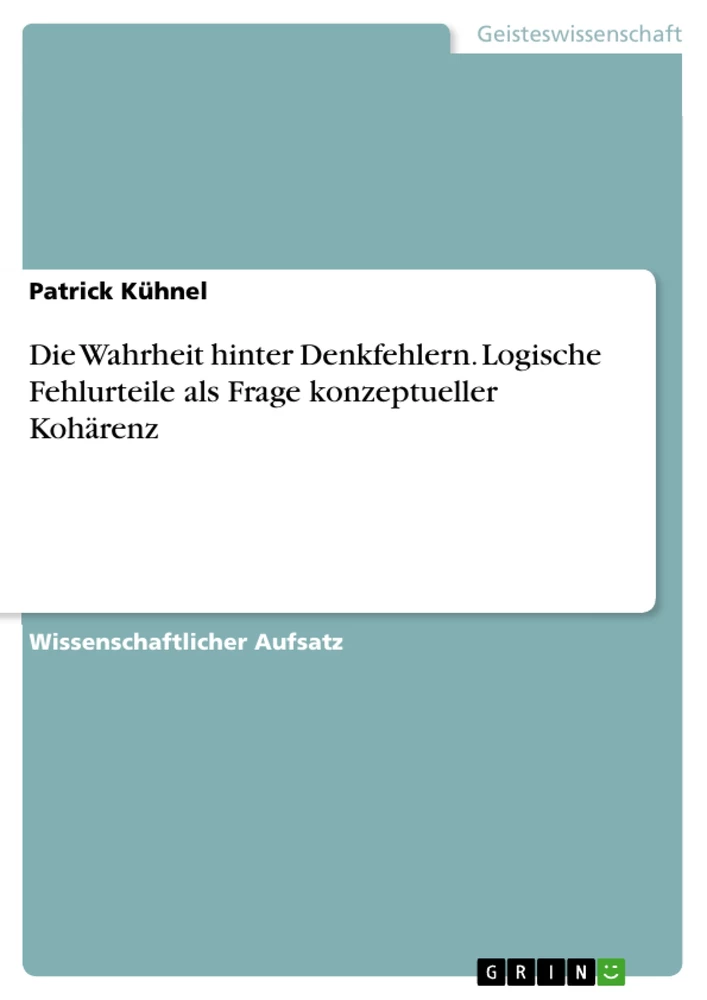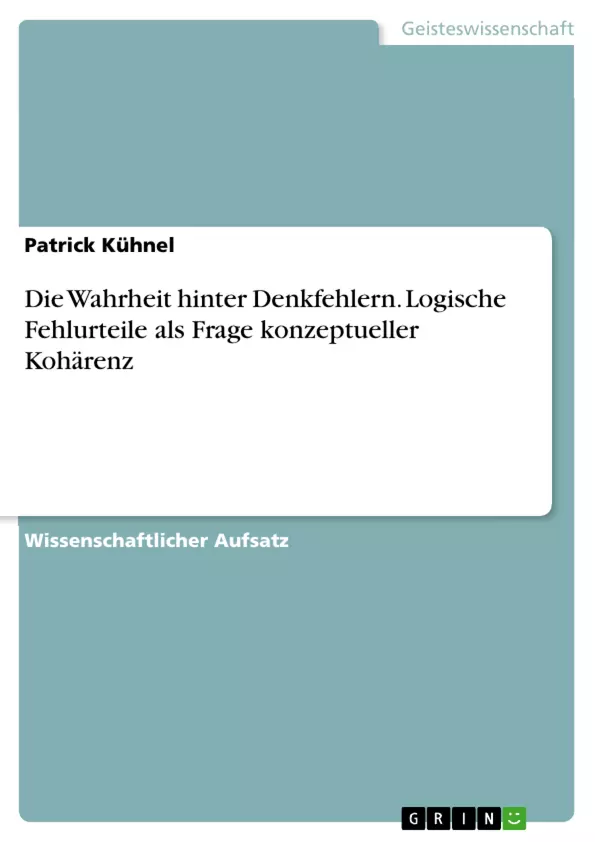In dieser Arbeit wurde der Versucht unternommen, bei der Analyse von kognitiven Fehlurteilen die spezifische Funktionsweise formaler Inferenz zu berücksichtigen. Grundlage hierfür bildeten die Theorie der Gefäßschemata von Lakoff/Núñez (2000) sowie die Theorie der Mental Spaces von Fauconnier (1985).
Statt also kognitive Irrtümer unter dem Aspekt der Devianz vom formallogischen Standard zu betrachten, wurde davon ausgegangen, dass die Herausforderung für die Interpreten der Testitems darin besteht, ein kohärentes Szenario zu konstruieren, das sowohl mit den gegebenen Informationen als auch dem eigenen erfahrungsbasierten Wissen kompatibel und idealerweise zudem noch ausreichend situationsadäquat sein sollte.
Der hierfür zu erbringende kognitive Aufwand weist zahlreiche Parameter auf: Für den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Schematisierungen und der Fähigkeit diese Schematisierungen mit Hilfe unterschiedlicher Referenzstrategien situationsadäquat einzusetzen, spielt deren situationsunabhängige Verfügbarkeit eine wichtige Rolle; bei den hier analysierten Beispiel erwies sich insbesondere der relative kognitive Aufwand bei der Zurückstellung einer Wert-Wert Projektion zwischen Fiktionalem Raum und Wirklichkeitsraum als wichtiger Faktor.
Inhaltsverzeichnis
- Summary
- 1. Einleitung
- 2. Die metaphorische Basis formaler Schlussregeln
- 3. Beispiel: Belief-Bias
- 4. Kognitive Repräsentationen von Syllogismen
- 5. Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Rolle von konzeptuellen Metaphern bei der Entstehung von Denkfehlern. Er stellt die These auf, dass logische Fehlurteile nicht unbedingt auf mangelnde Denkfähigkeit zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf die kognitive Anstrengung, die mit der Konstruktion kohärenter Szenarien aus möglicherweise widersprüchlichen Informationen verbunden ist.
- Die Rolle konzeptueller Metaphern im formalen Denken
- Der Einfluss von "Belief Bias" auf logische Schlussfolgerungen
- Die kognitive Repräsentation von Syllogismen
- Die Rolle von mentalen Räumen im Denkprozess
- Die Beziehung zwischen kognitiven Fehlern und kognitiven Ressourcen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt den Forschungsstand zum Thema logische Fehlurteile dar. Es wird die traditionelle normative Perspektive auf Denkfehler und die damit verbundenen Einflussfaktoren wie Belief Bias und Confirmation Bias beleuchtet. Weiterhin wird die Dual-Process-Theorie vorgestellt, die das menschliche Kognitionssystem in zwei Arbeitsmodi unterteilt: System 1 (schnell, intuitiv) und System 2 (langsam, analytisch).
2. Die metaphorische Basis formaler Schlussregeln
Dieses Kapitel untersucht die Rolle von konzeptuellen Metaphern im formalen Denken. Es wird argumentiert, dass die Fähigkeit des menschlichen Geistes, komplexe Informationen durch Metaphern zu strukturieren, sowohl Vorteile als auch Nachteile für die logische Schlussfolgerung mit sich bringt.
3. Beispiel: Belief-Bias
Dieses Kapitel untersucht den "Belief Bias" als Beispiel für einen Denkfehler, der durch die Interferenz zwischen System 1 und System 2 entsteht. Es wird gezeigt, wie die subjektive Glaubwürdigkeit von Informationen die logische Korrektheit von Schlussfolgerungen beeinflussen kann.
4. Kognitive Repräsentationen von Syllogismen
Dieses Kapitel beleuchtet die kognitive Repräsentation von Syllogismen und die Rolle von mentalen Räumen im Denkprozess. Es wird argumentiert, dass die Konstruktion von mentalen Räumen, auf denen sprachliche Informationen abgebildet werden können, ein komplexer und ressourcenintensiver Prozess ist.
Schlüsselwörter
Metapher, Bias, mentaler Raum, kognitive Fehlurteile, falsche Schlussfolgerungen
Häufig gestellte Fragen
Warum entstehen logische Denkfehler?
Denkfehler entstehen oft nicht durch Dummheit, sondern durch den Versuch des Gehirns, Informationen mit vorhandenem Wissen zu einem kohärenten, plausiblen Szenario zu verknüpfen.
Was ist der Belief-Bias?
Belief-Bias beschreibt die Tendenz, die logische Stärke eines Arguments danach zu bewerten, wie glaubwürdig die Schlussfolgerung für einen selbst ist, anstatt nur die formale Logik zu prüfen.
Was besagt die Dual-Process-Theorie?
Sie unterscheidet zwei Systeme: System 1 arbeitet schnell und intuitiv, System 2 langsam und analytisch. Viele Denkfehler entstehen, wenn System 1 dominiert.
Welche Rolle spielen 'mentale Räume' beim Denken?
Mentale Räume sind kognitive Konstrukte, in denen wir Informationen abbilden. Die Verknüpfung dieser Räume erfordert kognitiven Aufwand und kann zu Fehlern führen.
Wie beeinflussen Metaphern unser logisches Verständnis?
Metaphern strukturieren unser Denken. Formale Schlussregeln basieren oft auf räumlichen Metaphern (Gefäßschemata), die uns helfen, abstrakte Logik zu greifen.
- Citar trabajo
- Patrick Kühnel (Autor), 2015, Die Wahrheit hinter Denkfehlern. Logische Fehlurteile als Frage konzeptueller Kohärenz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322520