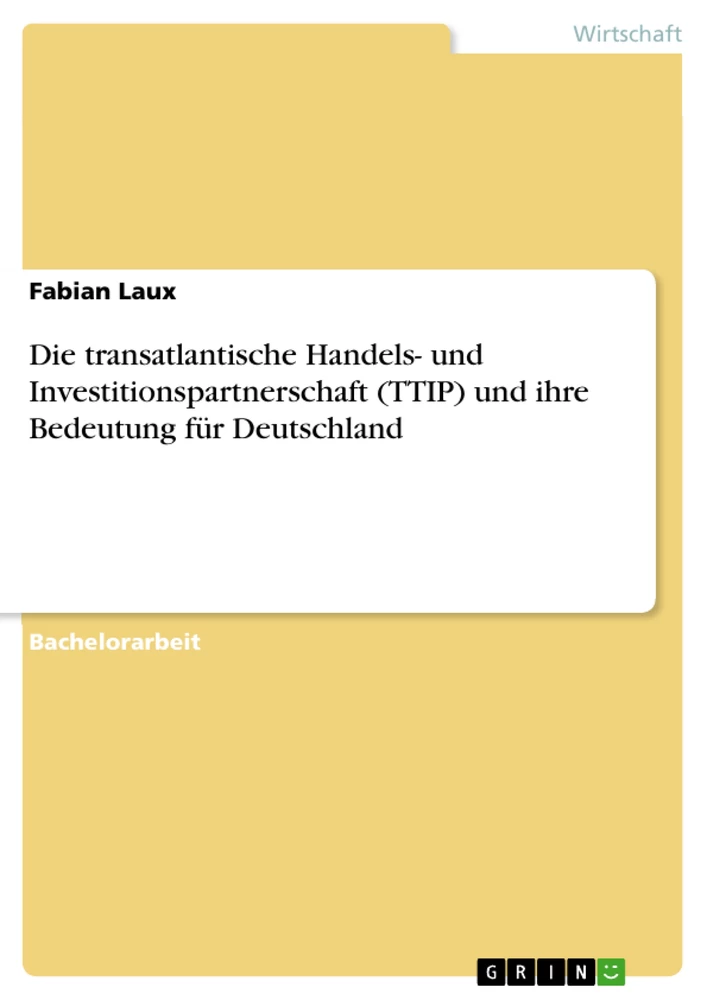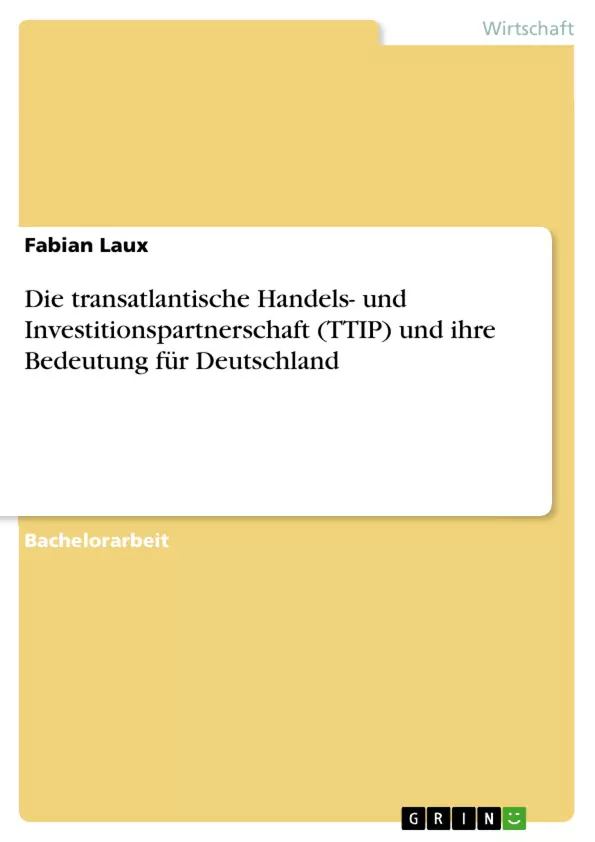In dieser Bachelorarbeit wird auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union (EU), speziell Deutschland, und den Vereinigten Staaten von Amerika eingegangen.
Nordamerika und die EU sind die weltweit am stärksten vernetzten Wirtschaftsregionen. Sie erzielen über 50 Prozent des Weltsozialproduktes, obwohl die beiden Gebiete lediglich 10 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. So lagen 2011 der Gütertausch bei circa 4 Prozent und der Handel mit Dienstleistungen bei 11 Prozent des globalen Handels.
Die Motivation für das Thema liegt zum einen in der steigenden Anzahl der massiven Proteste gegen das Transatlantische Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, nachfolgend TTIP), zum anderen in den Folgen, die das Abkommen auf das globale Handeln und die Weltbevölkerung haben kann. TTIP ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den USA und der EU, um den Unternehmen einen verbesserten Marktzugang im jeweils anderen Land zu ermöglichen und den Güterverkehr zu erleichtern.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
- Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)
- Einleitung
- Hintergrund
- Zeitablauf der TTIP-Verhandlungen
- Vergangene Verhandlungen
- Zusammenfassung der vergangenen Verhandlungen
- Aktuelle und zukünftige Verhandlungen
- Konfliktpotenziale
- Umwelt
- Gesundheit
- Tarifäre- und nichttarifäre Handelshemmnisse
- Investorenschutz und Schiedsgerichte (ISDS)
- Zusammenfassung der Konfliktpotentiale
- Auswirkungen von TTIP
- Wirtschaftliche Effekte
- Politische Folgen
- Zustimmung und Ablehnung in Deutschland
- Befürwortung
- Kritik
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und beleuchtet ihre Bedeutung für Deutschland. Die Arbeit untersucht den historischen Hintergrund der Verhandlungen, die aktuellen Konfliktpotenziale sowie die möglichen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von TTIP. Darüber hinaus werden die Argumente für und gegen TTIP in Deutschland betrachtet.
- Der historische Hintergrund und die Entwicklung der TTIP-Verhandlungen
- Die wichtigsten Konfliktpotenziale von TTIP, insbesondere im Bereich Umwelt, Gesundheit und Investorenschutz
- Die potenziellen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von TTIP auf Deutschland
- Die öffentliche Debatte in Deutschland über TTIP und die Argumente von Befürwortern und Kritikern
- Die Bedeutung von TTIP für die deutsche Wirtschaft und die Rolle Deutschlands in den Verhandlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik und stellt die Relevanz von TTIP für Deutschland dar. Kapitel 2 beleuchtet den historischen Hintergrund der TTIP-Verhandlungen, die wichtigsten Konfliktpotenziale und die aktuelle Verhandlungslage. Kapitel 3 analysiert die potenziellen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von TTIP auf Deutschland. Das vierte Kapitel behandelt die öffentliche Debatte in Deutschland über TTIP, die Argumente der Befürworter und Kritiker sowie die Rolle Deutschlands in den Verhandlungen.
Schlüsselwörter
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP), Freihandelsabkommen, Handelsbeziehungen, Deutschland, USA, Europäische Union, Umwelt, Gesundheit, Investorenschutz, Schiedsgerichte (ISDS), Wirtschaftliche Auswirkungen, Politische Folgen, öffentliche Meinung, Befürworter, Kritiker.
Häufig gestellte Fragen
Was ist TTIP?
TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership, ein geplantes Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA zur Erleichterung des Güterverkehrs.
Warum ist TTIP für Deutschland so bedeutend?
Die EU und Nordamerika erzielen über 50 % des Weltsozialproduktes. Deutschland als Exportnation hätte massiv von Zollsenkungen und Marktzugängen betroffen sein können.
Was sind die größten Konfliktpotenziale von TTIP?
Hauptstreitpunkte waren Standards im Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie der umstrittene Investorenschutz durch private Schiedsgerichte (ISDS).
Was versteht man unter nichttarifären Handelshemmnissen?
Das sind technische Vorschriften, Zulassungsverfahren oder Kennzeichnungspflichten, die den Handel erschweren, auch wenn keine Zölle erhoben werden.
Welche Argumente führten Kritiker in Deutschland an?
Kritiker befürchteten eine Absenkung europäischer Standards, eine Aushöhlung der Demokratie durch Schiedsgerichte und negative Folgen für die Weltbevölkerung.
- Quote paper
- Fabian Laux (Author), 2015, Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und ihre Bedeutung für Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322556