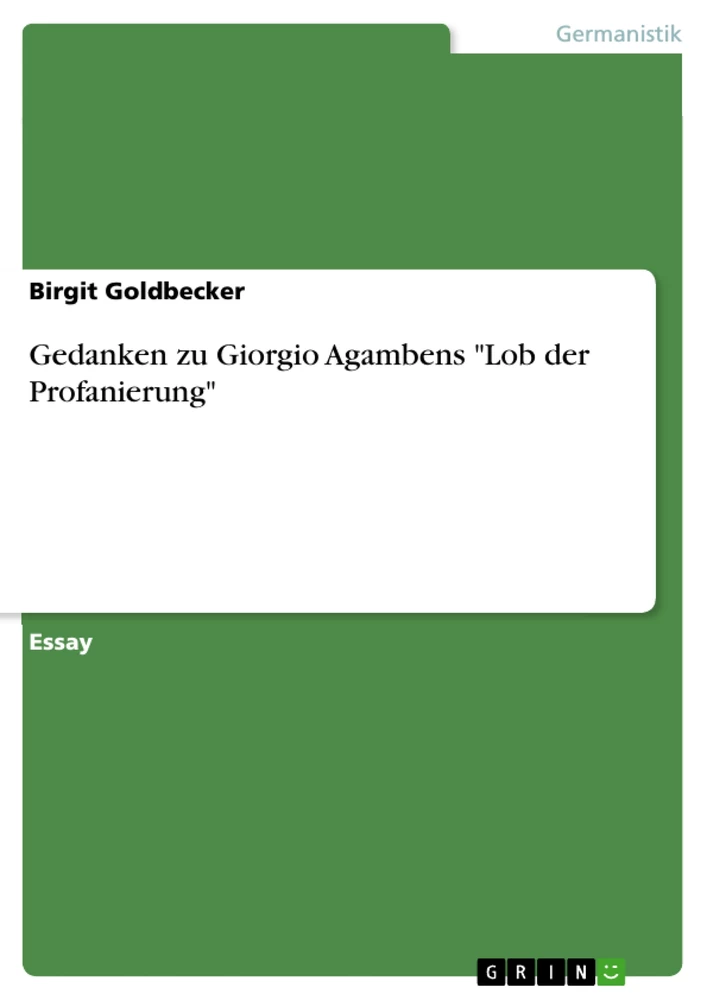Giorgio Agamben gilt als „Denker des Undenkbaren“, als „Meisterdenker der Gegenwart“, als eine „Zitierautorität“, als „theologisierende[r] Provokateur“. Sein Denken wird als grenzüberschreitend beschrieben und bietet neue Perspektiven für die Behandlung von Problemen der Gegenwart.
Seine Schriften sollen Zukunftsperspektiven, die eine „Auseinandersetzung mit Komplexitätssteigerung in der politischen, lebenswissenschaftlichen und ökonomischen Reorganisation der Welt“ fordern, beinhalten. Wie sieht dieses grenzüberschreitende Denken aus und welche Zukunftsperspektiven versucht er damit aufzuzeigen? Welche Lösungswege sieht er für eine Reorganisation der Welt? Welche Rolle spielt dabei der Kapitalismus?
Inhaltsverzeichnis
- Profanierung und Entweihung
- Religion und Absonderung
- Spiel und Profanierung
- Kapitalismus als Religion
- Das Nicht-Profanierbare
- Zukünftige Aufgaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Giorgio Agambens Werk "Profanierungen" und untersucht dessen zentrale These der Profanierung als Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung. Agamben argumentiert, dass die Entweihung metaphysischer Konzepte neue Möglichkeiten des Gebrauchs eröffnet. Der Essay beleuchtet Agambens Konzept der Profanierung im Kontext von Religion und Kapitalismus.
- Agambens Definition von Profanierung
- Die Rolle der Religion im Denken Agambens
- Der Kapitalismus als religiöses Phänomen
- Das Konzept des "Nicht-Profanierbaren"
- Die Bedeutung des freien Gebrauchs
Zusammenfassung der Kapitel
Profanierung und Entweihung: Der Essay beginnt mit einer Einführung in Agambens Konzept der Profanierung, welches im Gegensatz zur gängigen Auffassung nicht als Entweihung oder Entwürdigung verstanden wird, sondern als Rückgabe von Dingen an den freien Gebrauch der Menschen. Agamben unterscheidet zwischen der abgesonderten Sphäre des Heiligen und dem freien Gebrauch des Profanen. Dieser Unterschied wird durch die Analyse der Etymologien des Begriffs „religio“ veranschaulicht, wobei Agamben sich auf Ciceros Definition konzentriert, um seine These zu untermauern. Die Ambivalenz dieser Definition und die alternative Interpretation von Witte, welcher die Gemeinschaftsaspekte der religiösen Opfer betont, wird angesprochen, um die Komplexität des Agambenschen Denkens aufzuzeigen.
Religion und Absonderung: Dieser Abschnitt vertieft Agambens Analyse der Religion als System der Absonderung. Anhand antiker Opferbräuche wird verdeutlicht, wie Religion bestimmte Dinge, Orte oder Personen dem allgemeinen Gebrauch entzieht. Agamben betont die Machtstrukturen, die durch diese Absonderung entstehen, und zeigt, wie diese Absonderung einen "genuin religiösen Kern" darstellt. Die unterschiedlichen Deutungen von "religio" – als sorgsame Beachtung (Cicero) oder als Bindung und Gemeinschaft mit Gott (Theologie) – werden kontrastiert. Agambens Fokus auf den Machtfaktor der Absonderung wird als zentral für sein Verständnis von Profanierung hervorgehoben.
Spiel und Profanierung: Agamben verwendet das Spiel als Metapher für die Profanierung. Durch das Spiel werden Dinge ihrer festgelegten Funktion enthoben und einem freien Gebrauch überlassen. Dies wird als Möglichkeit gesehen, herrschende Machtstrukturen zu unterlaufen, ohne ihnen zu erliegen. Jedoch erkennt Agamben die zunehmende Verknüpfung von Spiel und Religion im modernen Kontext, besonders durch Medien wie Fernsehspiele, die eine säkularisierte Form religiöser Rituale darstellen und die Macht lediglich verschieben statt zu neutralisieren.
Kapitalismus als Religion: In diesem zentralen Abschnitt wird Agambens These vom Kapitalismus als Religion, analog zu Walter Benjamins Argumentation, ausführlich dargelegt. Agamben beschreibt den Kapitalismus als "Kultreligion" mit drei Hauptmerkmalen: permanente Dauer, Fokus auf den Kultus selbst und die Zerstörung statt der Transformation der Welt. Der Kapitalismus entzieht alle Dinge dem allgemeinen Gebrauch und reduziert sie auf ihren Ausstellungswert, vergleichbar mit der Funktion des Museums. Dies führt zu einer vollständigen Weihung und Profanierung zugleich, wobei alles abgespalten und in die Sphäre des Konsums verschoben wird.
Das Nicht-Profanierbare: Der Essay erklärt, wie der extreme Kapitalismus ein "Nicht-Profanierbares" schafft, welches durch die Allgegenwärtigkeit des Konsums und der Musealisierung charakterisiert ist. Alles wird zum Ausstellungsstück, entzogen jeglicher Möglichkeit des realen Gebrauchs. Diese Situation wird als eine zentrale Herausforderung für Agambens Konzept der Profanierung dargestellt.
Schlüsselwörter
Giorgio Agamben, Profanierung, Religion, Kapitalismus, Absonderung, Spiel, freier Gebrauch, Nicht-Profanierbares, Walter Benjamin, Machtstrukturen, Konsum.
Häufig gestellte Fragen zu Giorgio Agambens "Profanierungen"
Was ist das zentrale Thema von Agambens "Profanierungen"?
Das zentrale Thema ist die Profanierung als Mittel gesellschaftlicher Veränderung. Agamben versteht Profanierung nicht als Entweihung, sondern als Rückgabe von Dingen an den freien Gebrauch der Menschen. Der Essay untersucht dieses Konzept im Kontext von Religion und Kapitalismus.
Wie definiert Agamben Profanierung?
Agamben definiert Profanierung als die Rückgabe von Dingen, die zuvor aus dem allgemeinen Gebrauch ausgeschlossen waren (z.B. durch religiöse Rituale), in den freien Gebrauch. Es ist ein Prozess der Befreiung von festgelegten Funktionen und Bedeutungen.
Welche Rolle spielt die Religion in Agambens Analyse?
Agamben analysiert Religion als System der Absonderung, das bestimmte Dinge, Orte oder Personen dem allgemeinen Gebrauch entzieht. Er untersucht, wie Machtstrukturen durch diese Absonderung entstehen und wie die unterschiedlichen Interpretationen von "religio" (sorgsame Beachtung vs. Bindung an Gott) diese Dynamik beeinflussen.
Wie wird der Kapitalismus in Bezug auf Religion und Profanierung dargestellt?
Agamben beschreibt den Kapitalismus als eine "Kultreligion" mit den Merkmalen permanenter Dauer, Fokus auf den Kultus selbst und der Zerstörung statt Transformation der Welt. Er argumentiert, dass der Kapitalismus alle Dinge dem allgemeinen Gebrauch entzieht und sie auf ihren Ausstellungswert reduziert (Musealisierung), was zu einer vollständigen Weihung und Profanierung zugleich führt.
Welche Rolle spielt das Spiel in Agambens Theorie?
Agamben nutzt das Spiel als Metapher für Profanierung. Durch das Spiel werden Dinge ihrer festgelegten Funktion enthoben und einem freien Gebrauch überlassen. Dies wird als Möglichkeit gesehen, Machtstrukturen zu unterlaufen, obwohl Agamben auch die zunehmende Verknüpfung von Spiel und Religion im modernen Kontext anerkennt.
Was ist das "Nicht-Profanierbare" laut Agamben?
Das "Nicht-Profanierbare" beschreibt eine Situation, in der durch den extremen Kapitalismus und die Allgegenwärtigkeit des Konsums alles zum Ausstellungsstück wird und dem realen Gebrauch entzogen ist. Dies stellt eine zentrale Herausforderung für Agambens Konzept der Profanierung dar.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Essays relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Giorgio Agamben, Profanierung, Religion, Kapitalismus, Absonderung, Spiel, freier Gebrauch, Nicht-Profanierbares, Walter Benjamin, Machtstrukturen, Konsum.
Welche Kapitel werden im Essay behandelt?
Der Essay umfasst Kapitel zu Profanierung und Entweihung, Religion und Absonderung, Spiel und Profanierung, Kapitalismus als Religion, dem Nicht-Profanierbaren und zukünftigen Aufgaben. Jedes Kapitel vertieft spezifische Aspekte von Agambens Theorie.
Wie wird Agambens Konzept der Profanierung im Vergleich zu gängigen Auffassungen dargestellt?
Im Gegensatz zur gängigen Auffassung von Profanierung als Entweihung oder Entwürdigung, versteht Agamben Profanierung als Rückgabe von Dingen an den freien Gebrauch. Dieser Unterschied wird durch die Analyse der Etymologien des Begriffs „religio“ und durch den Vergleich mit anderen Interpretationen (z.B. Witte) deutlich gemacht.
- Quote paper
- Birgit Goldbecker (Author), 2013, Gedanken zu Giorgio Agambens "Lob der Profanierung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322824