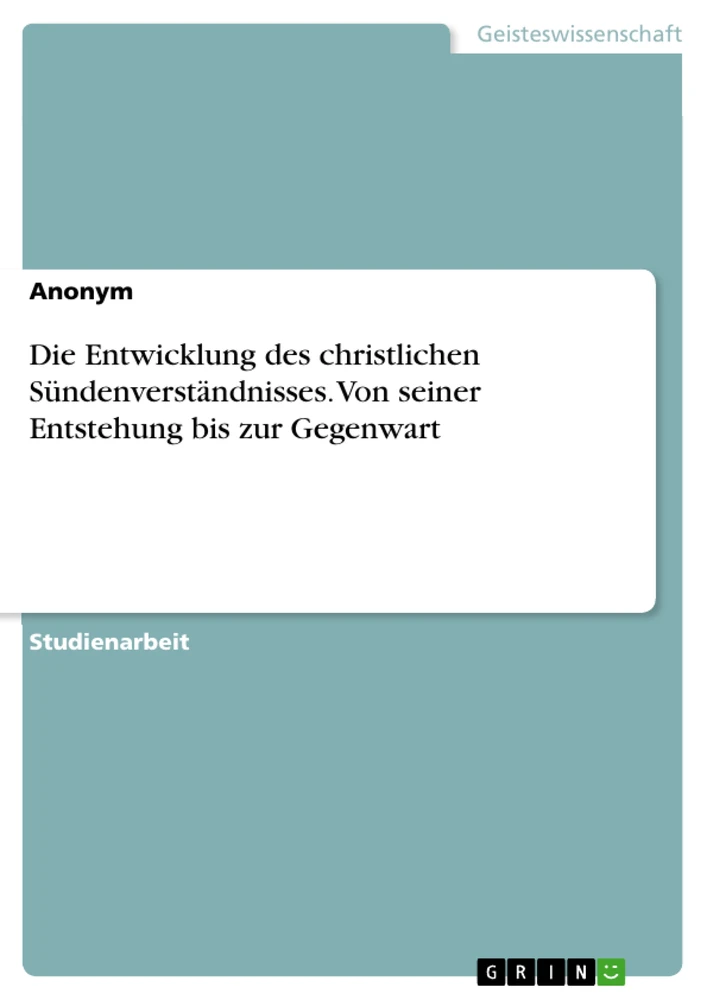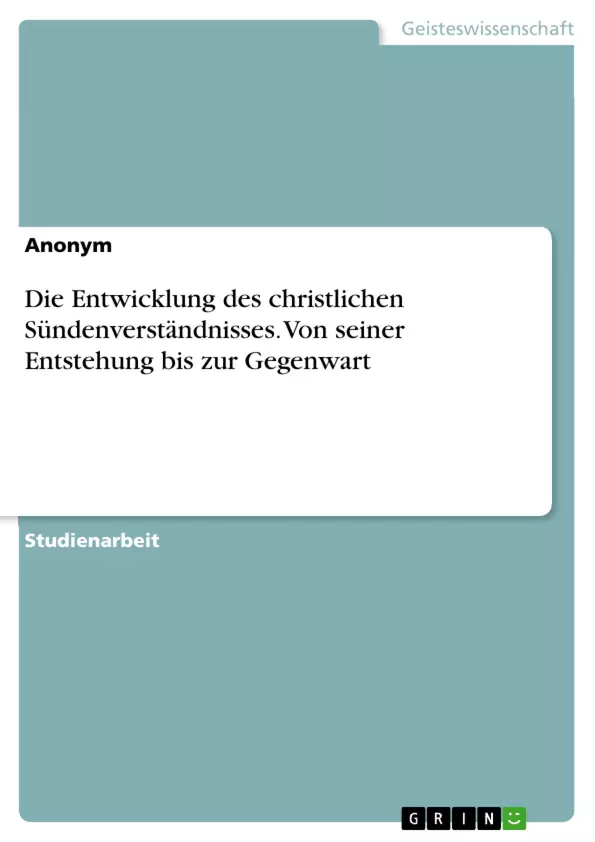Diese Hausarbeit soll sich mit der Thematik der Sünde beschäftigen. In genauerer Eingrenzung soll sie das christliche Sündenverständnis in verschiedenen Epochen und Ansätzen aufzeigen. So soll zu Beginn das Sündenverständnis in den Schriften des Alten Testaments aufgezeigt werden um den Grundstein für das christliche Sündenverständnis zu legen. Anschließend werden neutestamentliche Schriften untersucht. Darüber hinaus werden frühkirchliche, mittelalterliche und reformatorische Ansätze bei Luther aufgezeigt und schließlich neuere Ansätze der Forschung. Abschließend werden die Ergebnisse festgehalten und ausgewertet.
Der Begriff der Sünde ist in allen drei abrahamitischen Religionen wieder zu finden. Wird im christlichen Kontext von Sünde gesprochen, so ist die Abkehr des Menschen von Gott gemeint. Der Begriff Sünde beschreibt eine verwerfliche Tat, welche als Fehlverhalten und als Gegenteil moralischer Verantwortung angesehen wird. Diese kann bewusst wie auch unbewusst passieren. Die Entstehung der Sünde ist zurückzuführen auf den Sündenfall in Genesis 3, welcher durch Adam und Eva begangen wurde und die Trennung von Gott initiiert hat, durch welche der Mensch von Gottes Heilsplan verworfen wurde. Dieses Ereignis wird auch als Ursünde oder Erbsünde bezeichnet. “Siehe ich bin Schuld geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen“
In den folgenden Schritten soll das Sündenverständnis nun in den genannten Zeitepochen untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Das Sündenverständnis im Alten Testament
- 3.0 Die Sünde im Johannesevangelium
- 3.1 Paulus Sündenlehre
- 4.0 Augustinus von Hippos Erbsündenlehre
- 4.1 Thomas von Aquin
- 4.2 Die katholische Todsünde
- 5.0 Eine Reformation des Sündenverständnisses bei Martin Luther
- 5.1 Heutige Ansätze zum Umgang mit der Begrifflichkeit der Sünde
- 6.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das christliche Sündenverständnis über verschiedene Epochen und Ansätze hinweg. Ziel ist es, die Entwicklung des Verständnisses von Sünde von den alttestamentarischen Wurzeln bis hin zu neueren Ansätzen aufzuzeigen und zu analysieren.
- Das alttestamentarische Verständnis von Sünde und Vergebung
- Die Entwicklung des Sündenverständnisses im Neuen Testament
- Die Erbsündenlehre Augustinus und ihre Weiterentwicklung
- Die reformatorische Sicht auf Sünde bei Martin Luther
- Moderne Perspektiven auf den Umgang mit dem Begriff "Sünde"
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sünde ein und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Entwicklung des christlichen Sündenverständnisses in verschiedenen Epochen darzustellen. Sie stellt die zentrale Frage nach dem Sinn des Begriffs "Sünde" im christlichen Kontext angesichts des Erlösungswerks Jesu Christi und definiert den Begriff Sünde als Abkehr des Menschen von Gott, ein verwerfliches Handeln als Gegensatz zur moralischen Verantwortung, verbunden mit dem Sündenfall in Genesis 3 als Ursprung.
2.0 Das Sündenverständnis im Alten Testament: Dieses Kapitel analysiert das vielschichtige Verständnis von Sünde im Alten Testament. Es betont, dass der Begriff "Sünde" nicht abstrakt ist, sondern eng mit dem Bund Gottes mit Israel verknüpft ist. Die Kapitel untersucht die hebräischen Begriffe Pesha (Wegbrechen vom Bund), Het (Verfehlen, Verletzung der Gemeinschaft), und Awon (vollständiger Prozess von Tat bis Strafe). Die Folgen der Sünde sind untrennbar mit der Tat verbunden; Sünde und Strafe sind eng miteinander verknüpft. Das Kapitel beleuchtet auch die verschiedenen Arten der Vergebung (Mahah, Kabas, Taher, Hitte, Rapha) und die Bedeutung von Sühne (Kipper) und Bekenntnis für die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Das christliche Sündenverständnis"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das christliche Sündenverständnis über verschiedene Epochen und Ansätze hinweg. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Verständnisses von Sünde von den alttestamentarischen Wurzeln bis hin zu neueren Ansätzen aufzuzeigen und zu analysieren.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das alttestamentarische Verständnis von Sünde und Vergebung, die Entwicklung des Sündenverständnisses im Neuen Testament (inkl. der Sündenlehre des Paulus und des Johannesevangeliums), die Erbsündenlehre Augustinus und ihre Weiterentwicklung (inkl. der Ansichten von Thomas von Aquin und der katholischen Todsünde), die reformatorische Sicht auf Sünde bei Martin Luther und moderne Perspektiven auf den Umgang mit dem Begriff "Sünde".
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das Sündenverständnis im Alten Testament, Die Sünde im Johannesevangelium, Paulus' Sündenlehre, Augustinus von Hippos Erbsündenlehre, Thomas von Aquin, Die katholische Todsünde, Eine Reformation des Sündenverständnisses bei Martin Luther, Heutige Ansätze zum Umgang mit der Begrifflichkeit der Sünde, Fazit.
Wie wird Sünde im Alten Testament verstanden?
Das alttestamentarische Verständnis von Sünde ist eng mit dem Bund Gottes mit Israel verknüpft. Es werden die hebräischen Begriffe Pesha (Wegbrechen vom Bund), Het (Verfehlen, Verletzung der Gemeinschaft), und Awon (vollständiger Prozess von Tat bis Strafe) untersucht. Sünde und Strafe sind untrennbar miteinander verbunden. Die Kapitel beleuchtet auch verschiedene Arten der Vergebung und die Bedeutung von Sühne und Bekenntnis für die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott.
Wie wird der Begriff "Sünde" in der Einleitung definiert?
Die Einleitung definiert Sünde als Abkehr des Menschen von Gott, ein verwerfliches Handeln im Gegensatz zur moralischen Verantwortung, verbunden mit dem Sündenfall in Genesis 3 als Ursprung. Die zentrale Frage ist der Sinn des Begriffs "Sünde" im christlichen Kontext angesichts des Erlösungswerks Jesu Christi.
Welche Rolle spielen Augustinus und Luther im Verständnis von Sünde?
Die Hausarbeit untersucht Augustinus' Erbsündenlehre und deren Weiterentwicklung, sowie Martin Luthers reformatorische Sicht auf Sünde. Es wird beleuchtet, wie diese Theologen das Verständnis von Sünde geprägt haben und wie ihre Ansichten bis heute nachwirken.
Welche modernen Perspektiven auf den Umgang mit dem Begriff "Sünde" werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet aktuelle Ansätze im Umgang mit dem Begriff "Sünde" und zeigt auf, wie sich das Verständnis von Sünde im Laufe der Zeit gewandelt hat und welche Herausforderungen sich in der heutigen Zeit stellen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2011, Die Entwicklung des christlichen Sündenverständnisses. Von seiner Entstehung bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323083