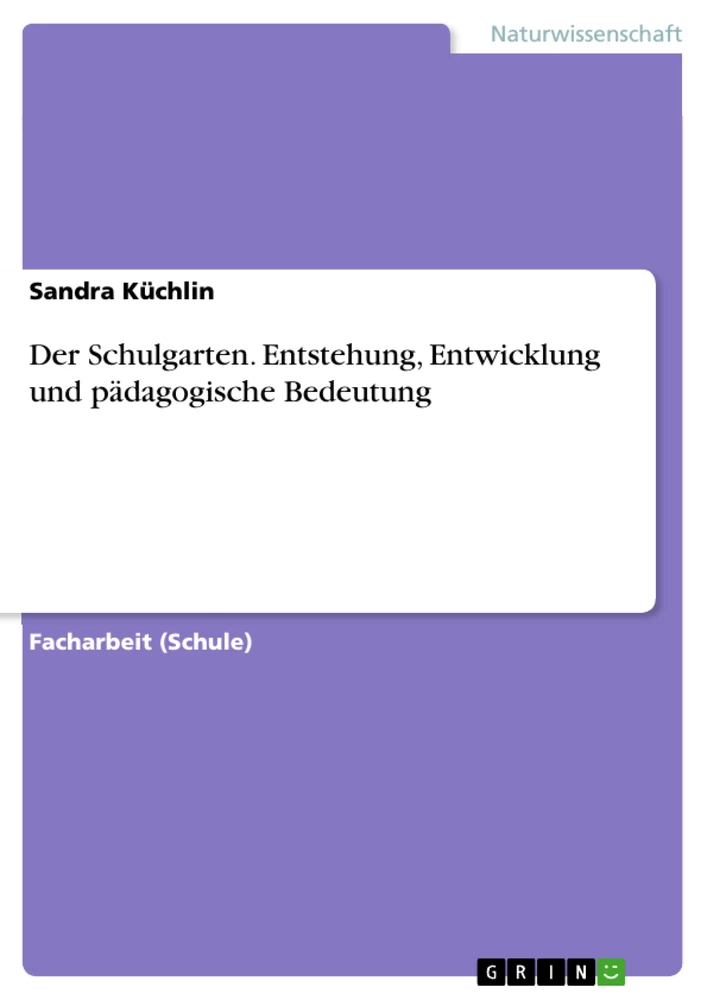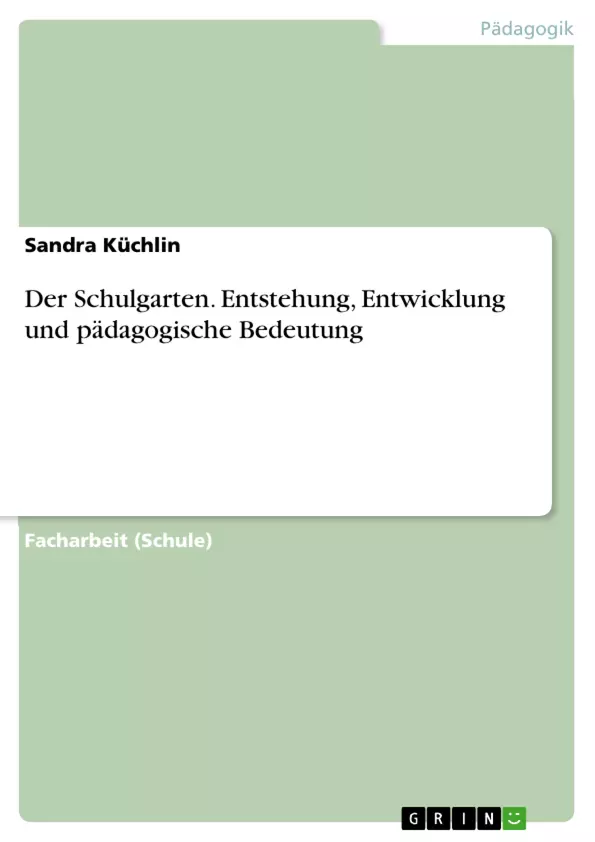Kinder und Jugendliche werden immer weniger an alltäglichen Prozessen beteiligt, wie beispielsweise an der Urproduktion von Lebensmitteln, was sich in einer zunehmenden Abnahme der Alltagskompetenz und des Umweltverständnisses widerspiegelt.
Eine pädagogische Handlungsmöglichkeit ist die Gartenarbeit in Form des Schulgartens. Die vorliegende Facharbeit mit dem Titel „Der Schulgarten - Entstehung, Entwicklung und pädagogische Bedeutung“ geht zum einen der Frage nach, was die pädagogische Besonderheit eines Schulgartens ausmacht, um zu verstehen, wie bei Kindern und Jugendlichen ein Verständnis für die Prozesse in der Natur entstehen kann. Des Weiteren geht es um die Frage, in welcher Art und Weise Gartenarbeit im Schulalltag gestaltet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Der Schulgarten
- 1. 1 Der Begriff des Schulgartens
- 1. 2 Die Geschichte des Schulgartens
- 1. 2. 1 Wegbereiter der Schulgartenbewegung
- 1. 2. 2 Erste Phase der Schulgartenbewegung
- 1. 2. 3 Zweite Phase der Schulgartenbewegung
- 1. 2. 4 Dritte Phase der Schulgartenbewegung
- 2 Pädagogische Bedeutung
- 2. 1 Erwartungen, Ziele und Motive des Schulgartens
- 2. 2 Methodisch-didaktische Umsetzung
- 2. 3 Grenzen der Schulgartenarbeit und Zukunftsprognose
- 3 Praxisbeispiel
- 3. 1 Der Schulgarten an der Freien Waldorfschule Heidelberg
- 3. 2 Gestaltung des Schulgartengeländes
- 3. 3 Pädagogisches Konzept
- 3. 4 Ablauf einer „typischen“ Unterrichtsstunde
- 3. 5 Zukünftige Entwicklung
- 4 Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit befasst sich mit dem Schulgarten und untersucht seine Entstehung, Entwicklung und pädagogische Bedeutung. Das Ziel ist es, die besonderen pädagogischen Möglichkeiten des Schulgartens aufzuzeigen und zu verstehen, wie er zur Förderung von Umweltverständnis und Alltagskompetenz bei Kindern und Jugendlichen beitragen kann.
- Die Geschichte der Schulgartenbewegung
- Die pädagogischen Ziele und Möglichkeiten des Schulgartens
- Methoden und didaktische Ansätze in der Schulgartenarbeit
- Die Grenzen und Herausforderungen der Schulgartenarbeit
- Ein Praxisbeispiel: Der Schulgarten an der Freien Waldorfschule Heidelberg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Wandel von Kindheit im Kontext gesellschaftlicher, familiärer und politischer Veränderungen. Sie stellt den Zusammenhang zwischen dem Rückgang von Alltagskompetenz und Umweltverständnis bei Kindern und Jugendlichen und der Bedeutung des Schulgartens als pädagogisches Instrument heraus.
Kapitel 1 befasst sich mit dem Begriff des Schulgartens und seiner historischen Entwicklung. Es werden verschiedene Definitionen des Schulgartens und die wichtigsten Phasen der Schulgartenbewegung vorgestellt.
Kapitel 2 untersucht die pädagogische Bedeutung des Schulgartens. Es werden die Erwartungen, Ziele und Motive des Schulgartens sowie methodisch-didaktische Ansätze der Umsetzung beleuchtet. Zudem werden die Grenzen der Schulgartenarbeit und Zukunftsprognosen behandelt.
Kapitel 3 stellt den Schulgarten der Freien Waldorfschule Heidelberg als Praxisbeispiel vor. Es werden die Gestaltung des Schulgartengeländes, das pädagogische Konzept, der Ablauf einer typischen Unterrichtsstunde und die zukünftige Entwicklung des Schulgartens dargestellt.
Schlüsselwörter
Schulgarten, Umweltbildung, Nachhaltigkeit, Gartenarbeit, Alltagskompetenz, Pädagogik, Didaktik, Waldorfschule, Praxisbeispiel, Geschichte, Entwicklung, Bedeutung, Methoden, Grenzen, Zukunftsprognose.
- Citation du texte
- Sandra Küchlin (Auteur), 2012, Der Schulgarten. Entstehung, Entwicklung und pädagogische Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323142