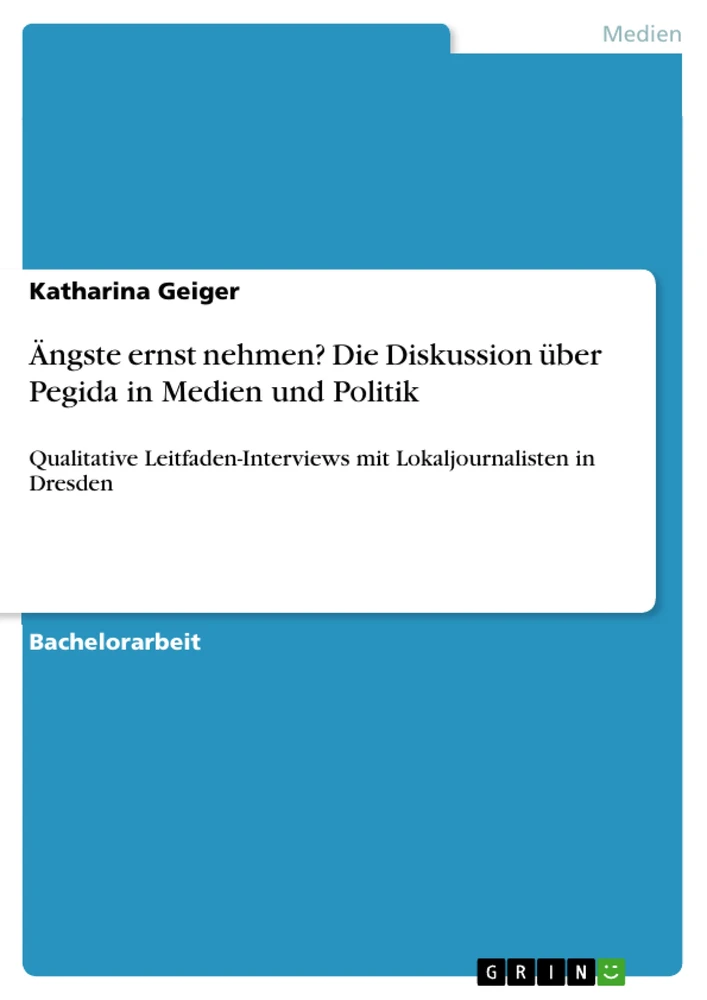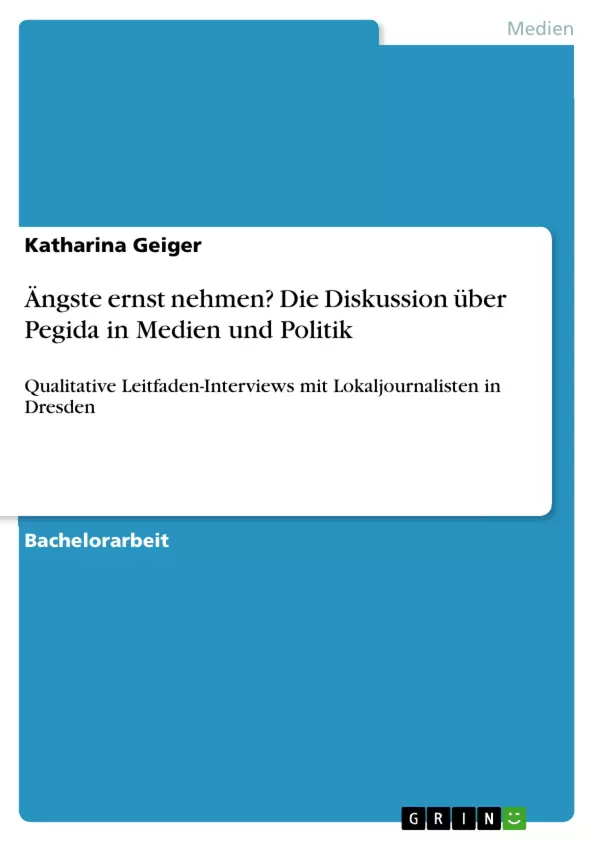PEGIDA (Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung Des Abendlandes), dieser Begriff dominierte im Dezember 2014 und Januar 2015 die Titelzeilen nahezu aller Medien. Eine politische Bewegung, die durch ihre Montagsspaziergänge in der Dresdner Innenstadt bekannt wurde. Kurz danach folgten in mehreren deutschen Städten Ableger der Bewegung und demonstrierten ebenfalls. Unklar war anfangs jedoch, wofür oder gegen was genau bei diesen Spaziergängen demonstriert wurde. Der Name der Bewegung deutet vorerst auf eine ablehnende Haltung gegenüber dem Islam hin, was eventuell der explodierenden Berichterstattung über die Glaubenskriege, Terroranschläge und Mord- und Raubzüge des Islamischen Staates und der Boko Haram zurechenbar wäre. Allerdings geht es bei Pegida eher um nationale Angelegenheiten, anfangs tatsächlich um die Asylpolitik, da durch die aufkommenden Flüchtlingsströme viele Menschen mit muslimischem oder anderem Glauben in Deutschland Asyl suchen.
Obwohl sich die Organisatoren von Pegida des Öfteren von Rechtsradikalen und der NPD (Nationalsozialistische Partei Deutschland) distanzieren wollten, wurden sie immer wieder von diesen instrumentalisiert beziehungsweise in ihren Absichten mit deren rechten politischen Ansichten verglichen. Die Organisatoren wurden genauer beobachtet und in die Öffentlichkeit gezogen. Dadurch wurden natürlich all ihre Aussagen besonders genau abgewogen und vergangene Fehltritte regelrecht skandalisiert. Aber hat sie denn nicht genau das Verhalten der Medien und Medienschaffenden in ihren Ansichten zur sogenannten „Lügenpresse“ bestätigt? Hat ihnen dieses Maß an Öffentlichkeit und Publizität noch mehr Zulauf verschafft oder fingen die Anhänger an, sich nach Veröffentlichungen zu den Ungereimtheiten innerhalb des Organisatorenteams, zu distanzieren, aus Angst, sie könnten doch bei einer Bewegung mitgelaufen sein, die sich mehr als vermutet am äußeren rechten politischen Sektor befindet? Diese Wirkungen der Medien auf die Gesellschaft sind freilich nicht leicht zu bemessen, allerdings stellt sich noch eine andere Frage: Zielen Journalisten mit ihrer Berichterstattung nicht genau auf solche Wirkungen? Welche Gedanken machen sich Journalisten vor der Veröffentlichung eines Beitrags zu einem prekären Thema? Dies führt zu der Forschungsfrage, mit der sich diese Arbeit fortan beschäftigen wird:
Welche ethischen Grundannahmen und Motive verfolgen Journalisten in ihrer Berichterstattung über Pegida?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Relevanz des Themas
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Näherungen an den Forschungsstand
- 2.1.1 Individuelle Betrachtung
- 2.1.2 Ethische und philosophische Prinzipien
- 2.1.3 Rollenverständnis von Journalisten
- 2.2 Rationalität und Ethik der Journalisten nach Weber
- 2.2.1 Ethik
- 2.2.1.1 Verantwortungsethik
- 2.2.1.2 Gesinnungsethik
- 2.2.2 Rationalität
- 2.2.2.1 Zweckrationalität
- 2.2.2.2 Wertrationalität
- 2.2.1 Ethik
- 2.3 Theorie der instrumentellen Aktualisierung
- 2.3.1 Bewusstes Hochspielen
- 2.3.2 Bewusstes Herunterspielen
- 2.4 Kategorien
- 2.1 Näherungen an den Forschungsstand
- 3. Methode
- 3.1. Qualitative Leitfadeninterviews
- 3.2. Konstruktion des Leitfadens
- 3.3. Stichprobe und Rekrutierung
- 3.4. Ablauf des Interviews, Interviewerprotokoll und Transkription
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Rollenselbstverständnis
- 4.2 Ethik
- 4.3 Rationalität
- 4.4 Instrumentelle Aktualisierung
- 4.4.1 Bewusstes Hochspielen
- 4.4.2 Bewusstes Herunterspielen
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Berichterstattung über die Pegida-Bewegung in den Medien und analysiert die Rolle der Lokaljournalisten in Dresden. Im Fokus stehen dabei die ethischen und rationalen Handlungsweisen der Journalisten, sowie die Frage, inwieweit sie bewusst die Bedeutung von Pegida in der öffentlichen Wahrnehmung hochspielen oder herunterspielen.
- Ethische und rationale Handlungsweisen von Journalisten
- Rollenverständnis von Journalisten in Bezug auf die Berichterstattung über Pegida
- Die Rolle der instrumentellen Aktualisierung in der Berichterstattung
- Analyse der Medienberichterstattung über Pegida und deren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung
- Die Auseinandersetzung mit der Kritik an der „Lügenpresse“ im Kontext der Pegida-Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz des Themas Pegida und die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse der Medienberichterstattung. Es wird die Entstehung der Bewegung und ihre zentralen Aussagen im Kontext der Flüchtlingskrise skizziert. Das zweite Kapitel widmet sich dem theoretischen Hintergrund der Arbeit und beleuchtet verschiedene Theorien, die das Rollenverständnis von Journalisten, ihre ethischen und rationalen Handlungsweisen sowie die Rolle der instrumentellen Aktualisierung im Journalismus erklären. Im dritten Kapitel werden die methodischen Grundlagen der Arbeit dargestellt. Hierbei wird auf die qualitative Leitfadeninterviewmethode, die Konstruktion des Leitfadens, die Auswahl der Interviewpartner und den Ablauf der Interviews eingegangen. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews. Es werden die Rollenselbstwahrnehmung der Lokaljournalisten, ihre ethischen und rationalen Handlungsweisen sowie die Anwendung der instrumentellen Aktualisierung in der Berichterstattung über Pegida analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Medienberichterstattung, der ethischen und rationalen Handlungsweisen von Journalisten, der Rolle der instrumentellen Aktualisierung und der Analyse der öffentlichen Wahrnehmung der Pegida-Bewegung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit zu Pegida?
Die Arbeit fragt, welche ethischen Grundannahmen und Motive Journalisten bei ihrer Berichterstattung über die Pegida-Bewegung verfolgen.
Was bedeutet "instrumentelle Aktualisierung"?
Es beschreibt das bewusste Hochspielen oder Herunterspielen von Themen durch Journalisten, um eine bestimmte Wirkung in der Öffentlichkeit zu erzielen.
Wie unterscheiden sich Verantwortungsethik und Gesinnungsethik im Journalismus?
Verantwortungsethiker achten auf die Folgen ihrer Berichterstattung, während Gesinnungsethiker primär nach ihren inneren Überzeugungen handeln.
Welche Rolle spielt der Vorwurf der "Lügenpresse" in der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht, ob das Verhalten der Medien die Anhänger in ihrem Misstrauen bestätigt hat oder ob die Berichterstattung zur Aufklärung über die Organisatoren beitrug.
Welche Methode wurde für die Ergebnisse genutzt?
Es wurden qualitative Leitfadeninterviews mit Lokaljournalisten aus Dresden durchgeführt.
- Quote paper
- Katharina Geiger (Author), 2015, Ängste ernst nehmen? Die Diskussion über Pegida in Medien und Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323323