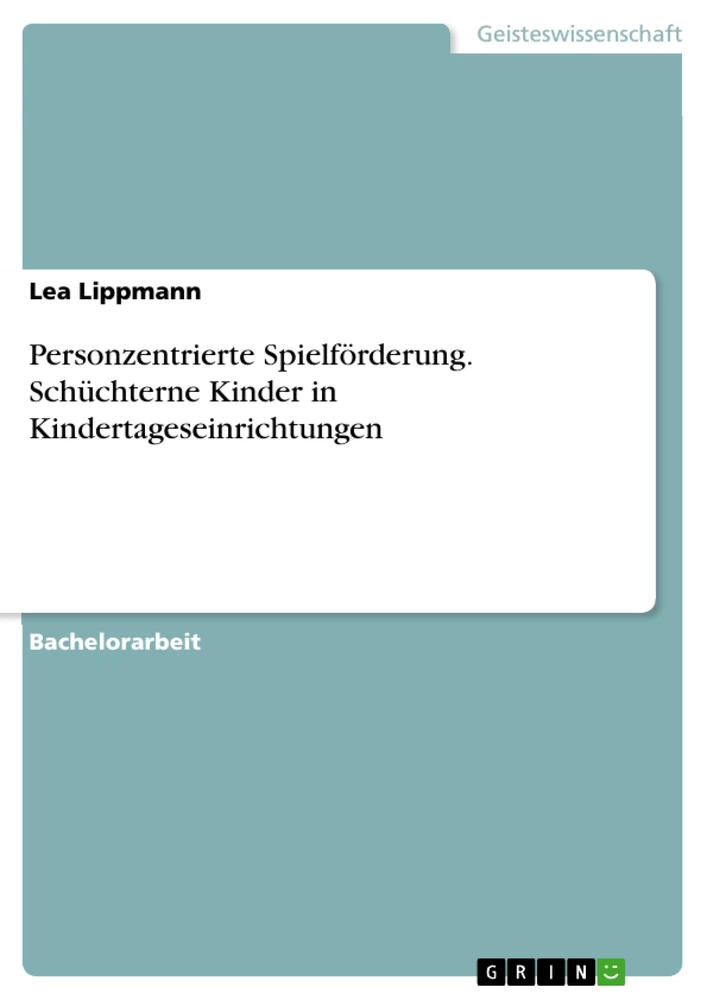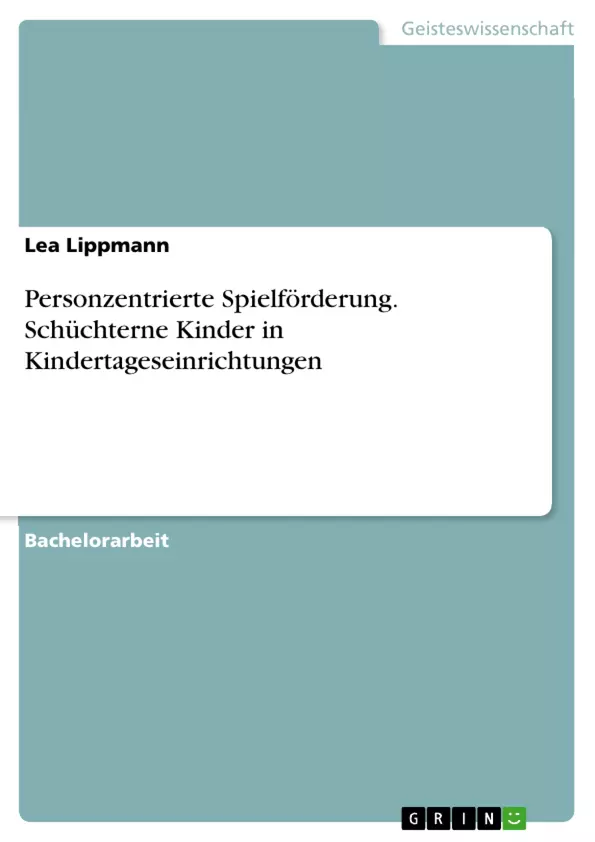Ist personzentrierte Spielförderung von ängstlichen und unsicheren Kindern in Kindertageseinrichtungen wirksam und umsetzbar? Zeigen sich positive Auswirkungen bezüglich ihrer Ängstlichkeit, ihres Selbstwertgefühls und ihres Sozialverhaltens? Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Wirksamkeit von personzentrierter Spiel- und Entwicklungsförderung in Kindertageseinrichtungen zur Unterstützung einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung speziell bei ängstlichen und unsicheren Kindern.
Eine Stichprobe von 102 Kindern (55 ♀, 47 ♂, 4,0 – 5,11 Jahre) gleichmäßig aufgeteilt in Durchführungs- und Kontrollgruppe, erhielten in einem Zeitraum von sechs Wochen 15 Interventionen, die sich aus Einzel-, Zweier-, Klein- und Gruppenförderungen zusammensetzten. Hierbei wurden an drei verschiedenen Zeitpunkten Daten der Kinder, der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte erhoben. Die so gewonnenen Testwerte aller Beteiligten lassen auf eine positive Wirkung der personzentrierten Spielförderung auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung / Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Schüchternheit
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Ausprägung / Differenzierte Darstellung
- 2.1.3 Erklärungsansatz nach dem personzentrierten Modell
- 2.1.4 Erscheinungsbild
- 2.1.5 Symptomatik
- 2.1.6 Auswirkungen
- 2.2 Personzentrierte Spieltherapie
- 2.2.1 Das Konzept der klientenzentrierten Psychotherapie nach Carl R. Rogers
- 2.2.2 Das kindliche Spiel
- 2.2.3 Die Bedeutung des Spiels in der personzentrierten Spieltherapie
- 2.2.4 Personzentrierte Spieltherapie und interaktionelle Methoden nach Virginia Mae Axline
- 2.2.5 Die Bedeutung der therapeutischen Beziehung
- 2.2.6 Personzentrierte Gruppenspieltherapie
- 2.2.7 Umgang in der personzentrierten Spieltherapie
- 2.2.8 Spielförderung in Kindertageseinrichtungen
- 2.2.9 (Aktuelle) Forschung zur Wirksamkeit von Spieltherapie
- 3 Fragestellung
- 4 Methoden
- 4.1 Studiendesign
- 4.2 Auswahl der Einrichtung
- 4.3 Spielmaterialien / Spielzimmer
- 4.4 Teilnehmende Kinder
- 4.5 Vorbereitung und Planung der Spielförderung
- 4.6 Protokollierung
- 4.7 Eingesetzte Testverfahren
- 4.7.1 BAV 3-11
- 4.7.2 CBCL 1,5-5
- 4.7.3 C-TRF 1,5-5
- 4.7.4 Zielerreichungsskala / Goal Attainment Scale (GAS)
- 4.7.5 Sonstige Testverfahren
- 4.8 Durchführung der Spielförderung
- 4.8.1 Einzelförderung im Spielzimmer
- 4.8.2 Zweiergruppenförderung im Spielzimmer
- 4.8.3 Kleingruppenförderung im Spielzimmer
- 4.8.4 Gruppenförderung im Gruppenraum
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Hypothese 1
- 5.2 Hypothese 2
- 5.3 Hypothese 3
- 5.4 Hypothese 4
- 5.5 Hypothese 5
- 5.6 Einzelergebnisse der selbstgeförderten vier Kinder
- 5.6.1 Einzelergebnisse von CJ 201108 (Durchführungsgruppe)
- 5.6.2 Einzelergebnisse von CS 251107 (Durchführungsgruppe)
- 5.6.3 Einzelergebnisse von EH 260708 (Kontrollgruppe)
- 5.6.4 Einzelergebnisse von SS 270908 (Kontrollgruppe)
- 6 Subjektive Erfahrungen und Eindrücke
- 6.1 Zielerreichungsskala (GAS) / Halbstrukturiertes Kurzinterview
- 6.1.1 Auswertung von CJ 201108
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Wirksamkeit personenzentrierter Spielförderung in Kindertageseinrichtungen für ängstliche und unsichere Kinder. Ziel ist es, zu untersuchen, ob personenzentrierte Spielförderung positive Auswirkungen auf die Ängstlichkeit, das Selbstwertgefühl und das Sozialverhalten von Kindern hat.
- Schüchternheit und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern
- Das Konzept der personzentrierten Spieltherapie und ihre Anwendung in Kindertageseinrichtungen
- Die Rolle des Spiels in der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
- Empirische Untersuchung der Wirksamkeit von personenzentrierter Spielförderung
- Analyse der subjektiven Erfahrungen von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage erläutert. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund, wobei Schüchternheit und ihre Ursachen sowie die personzentrierte Spieltherapie und ihre Anwendung in Kindertageseinrichtungen im Detail betrachtet werden. Kapitel 3 formuliert die Forschungsfrage und die Hypothesen. Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Studie, einschließlich des Studiendesigns, der Auswahl der Einrichtung, der teilnehmenden Kinder, der eingesetzten Testverfahren und der Durchführung der Spielförderung. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie, wobei die Hypothesen geprüft und die Einzelergebnisse der selbstgeförderten Kinder analysiert werden. Kapitel 6 fasst die subjektiven Erfahrungen und Eindrücke der Beteiligten zusammen.
Schlüsselwörter
Personenzentrierte Spielförderung, Schüchternheit, ängstliche Kinder, Kindertageseinrichtungen, Spieltherapie, klientenzentrierte Psychotherapie, Selbstwertgefühl, Sozialverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist personzentrierte Spielförderung?
Ein pädagogischer Ansatz basierend auf Carl Rogers, der das Spiel nutzt, um die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstwertgefühl von Kindern zu stärken.
Hilft Spielförderung schüchternen Kindern?
Ja, die Studie mit 102 Kindern zeigt positive Auswirkungen auf Ängstlichkeit, Selbstwertgefühl und Sozialverhalten bei ängstlichen und unsicheren Kindern.
Wie wurde die Wirksamkeit in der Studie gemessen?
Es wurden Daten von Kindern, Eltern und Erziehern zu drei Zeitpunkten erhoben und Testverfahren wie BAV 3-11 und CBCL genutzt.
Welche Rolle spielt die therapeutische Beziehung?
Die Beziehung zwischen Kind und Pädagoge ist zentral, um einen sicheren Raum für die freie Entfaltung im Spiel zu schaffen.
Können solche Förderungen direkt in der Kita stattfinden?
Ja, die Arbeit untersucht explizit die Umsetzbarkeit von Einzel-, Zweier- und Gruppenförderungen im Alltag von Kindertageseinrichtungen.
- Quote paper
- Lea Lippmann (Author), 2013, Personzentrierte Spielförderung. Schüchterne Kinder in Kindertageseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323393