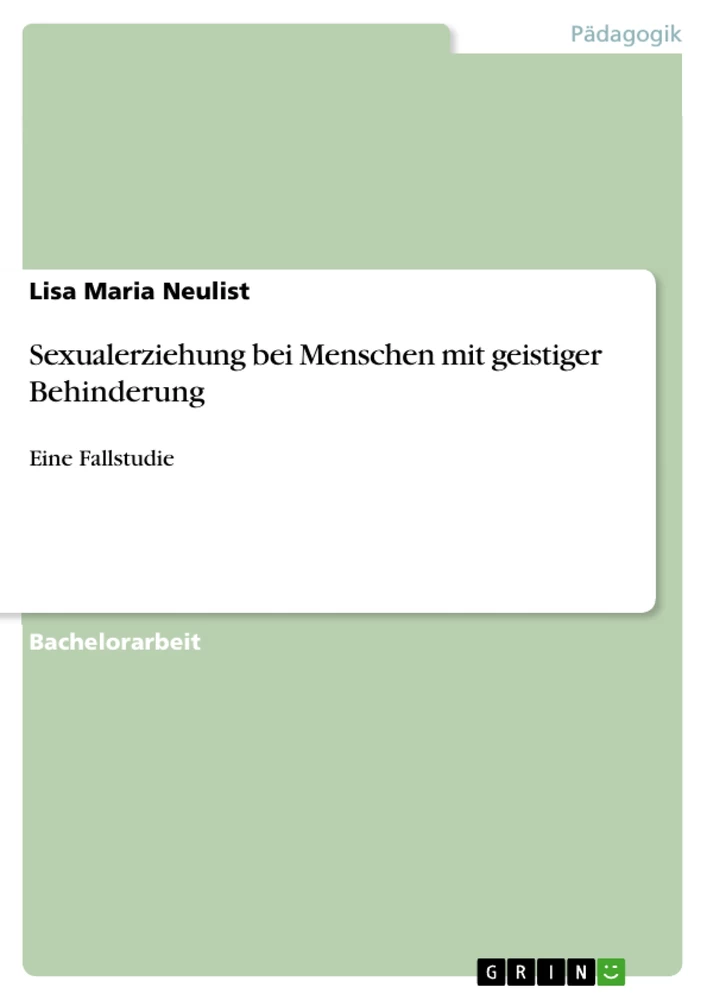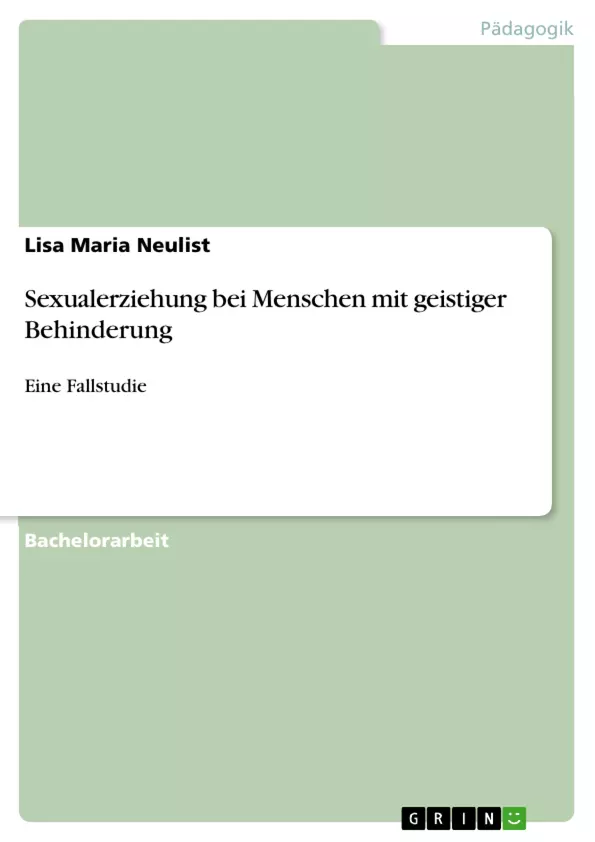Anlass zu dieser Arbeit sind aktuelle Diskussionen in den Medien um Frühsexualisierung beziehungsweise Sexualerziehung im Kindergarten. Die Parallele zu Menschen mit geistiger Behinderung formuliert Rett in der These, dass Sexual-Alter und Intelligenz-Alter bei Menschen mit geistiger Behinderung divergieren. Die Heranwachsenden werden auf der sexuellen Ebene auf die Stufe eines 4-8 Jährigen gestellt, welche noch keine sexuellen Regungen und Empfindungen kennen würden. Sexualerziehung wurde daher lange Zeit als unnötig befunden.
Paradox ist, dass neben dem Vorurteil der Asexualität auch das Vorurteil besteht Menschen mit geistiger Behinderung seien hypersexuelle Wesen. Das Thema Sexualität und Sexualerziehung wird, wenn überhaupt, im allgemeinen Verständnis auf Sexualaufklärung begrenzt. Damit einhergehend werden vor allem Problemfelder behandelt wie Empfängnisverhütung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch, Ehe, Nachkommenschaft und sexueller Missbrauch. Wobei hier die Schwangerschaftsverhütung und die Prävention von sexuellem Missbrauch im Vordergrund stehen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden viele Gespräche mit ErzieherInnen und LeiterInnen aus Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung geführt, sowie mit Angehörigen und mit einer spezialisierten Beraterin der Pro Familia Stelle in Augsburg. Die Gespräche und die Literatur ergaben einen Konsens, dass das Thema sehr belastet ist, so ist es Konvention den Bewohnerinnen ein Verhütungsmittel zu verabreichen, mit oder ohne Aufklärung.
Auch, wenn dies beispielsweise nicht gegen sexuellen Missbrauch schützt, schwingen Ängste von ungewollten wie auch gewollten sexuellen Kontakten bei dieser Praxis mit. Wenn von einer Deregulierung des sexuellen Umgangs mal die Rede ist, sind Themen wie die mangelnde Raumgestaltung in Betreuungseinrichtungen zentral, um Intimsphäre zu gewährleisten. Sowohl Sexualität, als auch Behinderungen sind schwierige Themen schon wenn es darum geht passende Begrifflichkeiten zu finden. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass Ängste und Unsicherheiten den Umgang prägen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methode
- 2.1 Einzelfallstudie
- 2.2 Befragung
- 2.3 Qualitative Inhaltsanalyse
- 3. Terminus 'Menschen mit geistiger Behinderung', Prävalenzrate und Klassifikationen
- 3.1 Definitionen und Ursachen der geistigen Behinderung
- 3.2 Klassifikationsinstrument ICD-10 auf medizinischen Grundlagen
- 3.3 Ergänzende Faktoren der geistigen Behinderung
- 3.4 Das bio-psycho-soziale Modell ICF
- 4. Erweiterte Definition von Sexualität
- 5. Pubertät und Sexualverhalten im Kontext von Eltern, ErzieherInnen und Peers
- 6. Pädagogik bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 6.1 Das Normalisierungsprinzip
- 6.2 Selbstbestimmung und Empowerment
- 6.3 Sexualerziehung
- 7. Qualitative Inhaltsanalyse des Interviews
- 7.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials
- 7.2 Verwendetes Kategoriensystem
- 7.3 Ergebnisaufbereitung
- 7.3.1 Erwachsensein und Familiensituation des Teilnehmers
- 7.3.2 Selbstbestimmung
- 7.3.3 Partnerschaft
- 7.3.4 Sexualität
- 7.3.5 Zusammenfassende Interpretation in Rückbezug auf die Theorie
- 8. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Sexualerziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse dieser Personengruppe im Hinblick auf Sexualität zu entwickeln und die aktuelle Praxis zu hinterfragen. Die Arbeit analysiert bestehende Vorurteile und Defizitorientierungen und plädiert für eine wertschätzende Pädagogik, die Selbstbestimmung und Mitbestimmung in den Vordergrund stellt.
- Vorurteile und gesellschaftliche Stigmatisierung bezüglich Sexualität und geistiger Behinderung
- Die Bedeutung von Selbstbestimmung und Empowerment in der Sexualerziehung
- Differenzen zwischen Theorie und Praxis in der Sexualerziehung für Menschen mit geistiger Behinderung
- Analyse der Rolle von Eltern, Erziehern und Peers in der psychosexuellen Entwicklung
- Entwicklung eines umfassenderen Verständnisses von Sexualität im Kontext geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet aktuelle Diskussionen um Sexualerziehung, insbesondere die kontroverse Debatte um Menschen mit geistiger Behinderung. Sie thematisiert divergierende Auffassungen von Sexualität und Alter bei dieser Gruppe, von Asexualität bis hin zu Hypersexualität, und kritisiert die Reduktion von Sexualerziehung auf Aufklärung über Verhütung und Missbrauchsprävention. Die Arbeit kündigt einen hermeneutischen Ansatz an, der die normative Haltung der Autorin klärt und die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung in den Mittelpunkt stellt. Die Fallanalyse soll die theoretischen Annahmen praxisnah überprüfen und die Potentiale von Sexualerziehung aufzeigen.
2. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es wird betont, dass Menschen mit geistiger Behinderung selbst wenig zu ihrem Verständnis von Erwachsensein und Sexualität befragt wurden. Die Arbeit stützt sich auf Beiträge von Walter und Hoyer-Hermann, die die Lebenswirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung hermeneutisch untersuchten und befragten. Es wird die Abhängigkeit von der Toleranz sexueller Normen der Betreuer und das Phänomen der sekundären Behinderung thematisiert. Ziel der Untersuchung war es, durch theoretische Reflexionen und biographische Interviews die Lebenswirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung bezüglich Sexualität und Erwachsensein zu erforschen und zu einem besseren Verständnis zu gelangen, um konkrete Lebensbedingungen zu verbessern.
3. Terminus 'Menschen mit geistiger Behinderung', Prävalenzrate und Klassifikationen: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und den Ursachen geistiger Behinderung. Es untersucht das Klassifikationsinstrument ICD-10 und berücksichtigt ergänzende Faktoren. Das bio-psycho-soziale Modell ICF wird als umfassendes Rahmenmodell vorgestellt, um die Komplexität der geistigen Behinderung zu erfassen. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Betrachtung, die biologische, psychische und soziale Aspekte einbezieht und ein umfassendes Verständnis für den Umgang mit geistiger Behinderung ermöglicht.
4. Erweiterte Definition von Sexualität: Dieses Kapitel geht über die gängigen Definitionen von Sexualität hinaus und betrachtet Sexualität als integralen Bestandteil der menschlichen Identität und Personentwicklung. Es betont die Bedeutung einer ungestörten psychosexuellen Entwicklung und die Notwendigkeit von angepassten Erziehungsmaßnahmen zum Ausgleich von Entwicklungsunterschieden. Diese erweiterte Sichtweise bildet die Grundlage für die gesamte Arbeit und legt den Fokus auf ein ganzheitliches Verständnis von Sexualität jenseits rein biologischer Aspekte.
5. Pubertät und Sexualverhalten im Kontext von Eltern, ErzieherInnen und Peers: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen der Pubertät und des Sexualverhaltens bei Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext ihrer Beziehungen zu Eltern, Erziehern und Gleichaltrigen. Es wird sich mit den spezifischen Bedürfnissen und Schwierigkeiten dieser Lebensphase auseinandersetzen und die Bedeutung von Unterstützung und angemessener Begleitung hervorheben. Dieser Abschnitt verdeutlicht die komplexe Interaktion verschiedener Einflussfaktoren auf die psychosexuelle Entwicklung.
6. Pädagogik bei Menschen mit geistiger Behinderung: Das Kapitel behandelt pädagogische Ansätze im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung. Es erläutert das Normalisierungsprinzip, Selbstbestimmung und Empowerment als zentrale Konzepte. Der Schwerpunkt liegt auf Sexualerziehung und der Entwicklung einer angemessenen, wertschätzenden und inklusiven Pädagogik. Die Kapitelteile beleuchten die verschiedenen pädagogischen Strategien, um Menschen mit geistiger Behinderung bei ihrer sexuellen Entwicklung zu unterstützen.
Schlüsselwörter
Sexualerziehung, geistige Behinderung, Selbstbestimmung, Empowerment, Normalisierungsprinzip, ICD-10, ICF, Vorurteile, Inklusion, Fallstudie, Qualitative Inhaltsanalyse, Sexualität, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Sexualerziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Sexualerziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Sie analysiert bestehende Vorurteile, Defizitorientierungen und die Praxis der Sexualerziehung, und plädiert für eine wertschätzende Pädagogik, die Selbstbestimmung und Mitbestimmung in den Vordergrund stellt.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse eines Interviews. Sie stützt sich außerdem auf theoretische Beiträge und betrachtet die Lebenswirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung hermeneutisch. Es wird eine Einzelfallstudie durchgeführt und die Abhängigkeit von der Toleranz sexueller Normen der Betreuer und das Phänomen der sekundären Behinderung thematisiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Ursachen geistiger Behinderung (inkl. ICD-10 und ICF), erweiterte Definition von Sexualität, Pubertät und Sexualverhalten im Kontext von Eltern, Erziehern und Peers, pädagogische Ansätze (Normalisierungsprinzip, Selbstbestimmung, Empowerment), Sexualerziehung, Vorurteile und gesellschaftliche Stigmatisierung, und die Analyse der Rolle von Eltern, Erziehern und Peers in der psychosexuellen Entwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Methodenbeschreibung, Kapitel zur Definition geistiger Behinderung und Klassifizierung (ICD-10, ICF), Kapitel zur erweiterten Definition von Sexualität, Kapitel zur Pubertät und Sexualverhalten im Kontext sozialer Beziehungen, Kapitel zur Pädagogik bei Menschen mit geistiger Behinderung, Kapitel zur qualitativen Inhaltsanalyse des Interviews (inkl. Ergebnisaufbereitung) und Schlussreflexion.
Welche Ergebnisse liefert die qualitative Inhaltsanalyse?
Die qualitative Inhaltsanalyse des Interviews untersucht Aspekte wie Erwachsensein und Familiensituation des Teilnehmers, Selbstbestimmung, Partnerschaft, Sexualität und liefert eine zusammenfassende Interpretation in Rückbezug auf die Theorie. Die konkreten Ergebnisse sind im Kapitel 7 detailliert beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit plädiert für eine wertschätzende und inklusive Pädagogik, die die Selbstbestimmung und Mitbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf Sexualität in den Mittelpunkt stellt. Sie kritisiert reduktionistische Ansätze in der Sexualerziehung und betont die Bedeutung eines umfassenden Verständnisses von Sexualität im Kontext geistiger Behinderung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Sexualerziehung, geistige Behinderung, Selbstbestimmung, Empowerment, Normalisierungsprinzip, ICD-10, ICF, Vorurteile, Inklusion, Fallstudie, Qualitative Inhaltsanalyse, Sexualität, Pädagogik.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung im Hinblick auf Sexualität zu entwickeln und die aktuelle Praxis der Sexualerziehung zu hinterfragen.
Wie wird das Normalisierungsprinzip in der Arbeit betrachtet?
Das Normalisierungsprinzip wird als zentrales pädagogisches Konzept im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung behandelt und im Kontext der Sexualerziehung diskutiert.
Wie wird das ICF-Modell in der Arbeit verwendet?
Das bio-psycho-soziale Modell ICF dient als umfassender Rahmen, um die Komplexität geistiger Behinderung zu erfassen und ein ganzheitliches Verständnis für den Umgang mit geistiger Behinderung zu ermöglichen.
- Quote paper
- Lisa Maria Neulist (Author), 2015, Sexualerziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323527