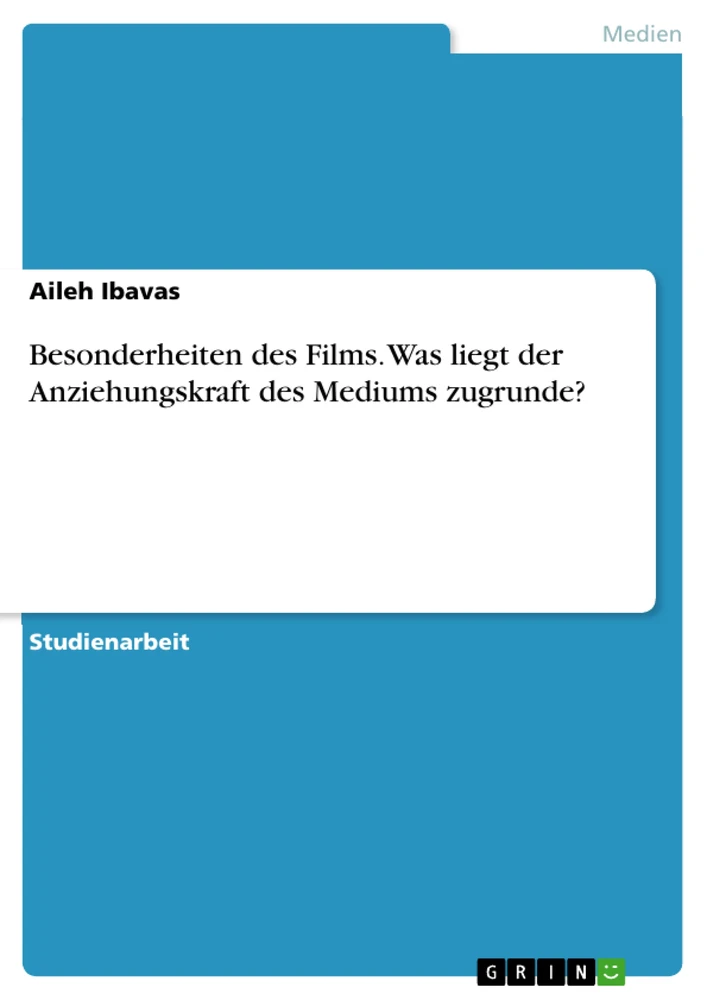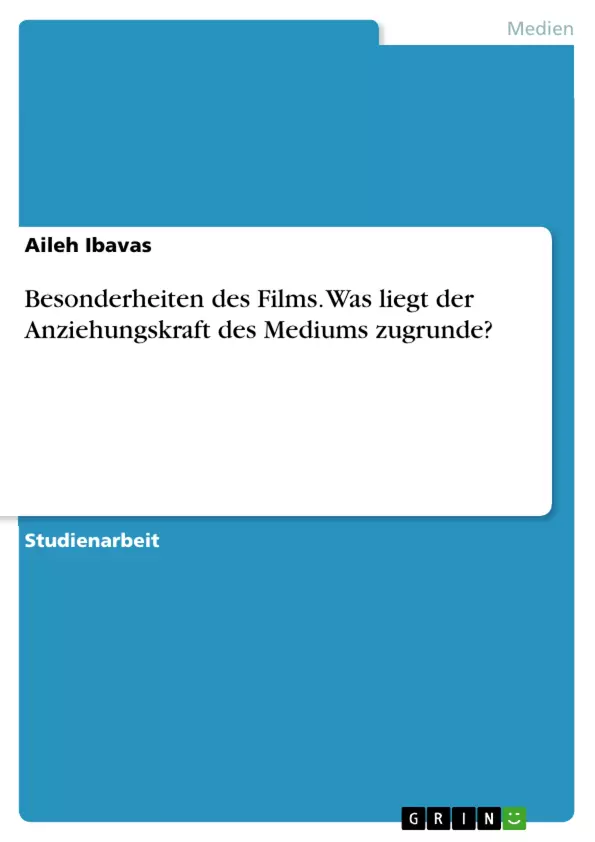Was ist „der Zauber“ des Films? - Welche Einzigartigkeit besitzt der Film, welche filmischen Mittel sind es, die eine solche Anziehungskraft auf ein immer breiter werdendes Publikum ausüben?
Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Frage, was das Besondere an Film ist, dass das Publikum in seinen Bann zieht. Zunächst soll die Eigenständigkeit des Films als Kunstform festgehalten werden.
Im Anschluss dessen werden die technischen Mittel von Filmaufnahmen in ihrer Funktion und Bedeutung für den Film analysiert, wobei auch die Einordnung von Film an den Grenzen der verschiedenen Kunstformen erfolgt.
Als nächstes wird die Darstellungsform des Films in ihrer Wirkung auf den Zuschauer betrachtet. Der Theatervergleich wird den Abschluss bieten, in dem nach der Erläuterung der filmischen Mittel als künstlerische Mittel gezeigt werden soll, ob beide Künste auch heute noch viele und wenn ja, wie viele Parallelen tatsächlich aufweisen und ob der Vergleich in der heutigen Zeit überhaupt noch Begründung findet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Film als eigenständige Kunstform
- 3. Filmische Mittel
- 3.1 Raum und Zeit
- 3.2 Die Musik
- 3.3 Fokussierung
- 3.4 Visualisierung seelisches Geschehens
- 4. Fiktionalität
- 5. Die Darstellungsform des Films
- 5.1 Phantasiegestaltung- Masken und Figurenbildung
- 5.2 Film in Theater
- 6. Der ästhetische Moment
- 7. Einordnung des Films an Kunstgrenzen
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Besonderheiten des Films und analysiert, was ihn so anziehend für das Publikum macht. Sie konzentriert sich auf die Frage, was die Eigenartigkeit des Films ausmacht und welche filmischen Mittel zur Anziehungskraft auf ein breites Publikum beitragen. Die Arbeit stützt sich dabei auf die Thesen von Hugo Münsterberg in seinem Essay „Warum wir ins Kino gehen“, wobei seine Argumente auf moderne Tonfilmaufnahmen in Farbe angewendet und mit anderen Kunsttheoretikern und Philosophen ergänzt werden.
- Der Film als eigenständige Kunstform und seine Abgrenzung zum Theater.
- Die Bedeutung filmischer Mittel, wie Raum, Zeit, Musik, Fokussierung und die Visualisierung seelischen Geschehens.
- Die Darstellungsform des Films und ihre Wirkung auf den Zuschauer.
- Der Einfluss der Phantasiegestaltung, Masken und Figurenbildung auf das filmische Erlebnis.
- Der ästhetische Moment im Film und seine Einordnung an den Grenzen anderer Kunstformen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Philosophie des Films als einen wichtigen Teilbereich der zeitgenössischen Philosophie der Kunst vor und erläutert die wachsende Bedeutung des Films in der Gesellschaft. Das Kapitel beleuchtet die Frage nach dem Wesen des Films und seiner Berechtigung als Kunstform. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Eigenständigkeit des Films als Kunstform und verfolgt die Entwicklung des Films von der reinen Aufnahme des realen Geschehens hin zu einer eigenständigen Kunstform mit Spielhandlung und filmischen Mitteln. Das dritte Kapitel analysiert die technischen Mittel von Filmaufnahmen in ihrer Funktion und Bedeutung für den Film. Es werden Beispiele aus der Filmwelt gebracht, um die praktischen Umsetzungen der filmischen Mittel zu veranschaulichen. Das vierte Kapitel untersucht die Darstellungsform des Films in ihrer Wirkung auf den Zuschauer. Im fünften Kapitel werden die besondere filmischen Mittel im Zusammenhang mit der Phantasiegestaltung, Masken und Figurenbildung erläutert. Das sechste Kapitel widmet sich dem ästhetischen Moment im Film und setzt den Film in Bezug zu anderen Kunstformen.
Schlüsselwörter
Film, Kunst, Philosophie, Filmische Mittel, Darstellungsform, Theater, ästhetischer Moment, Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim.
Häufig gestellte Fragen
Was macht den Film zu einer eigenständigen Kunstform?
Der Film ist mehr als eine bloße Aufnahme der Realität. Durch filmische Mittel wie Montage, Kameraperspektiven und die Gestaltung von Raum und Zeit schafft er eine eigene ästhetische Welt, die ihn vom Theater abgrenzt.
Welche Rolle spielen Raum und Zeit im Film?
Im Gegensatz zur physischen Realität kann der Film Raum und Zeit manipulieren (z. B. durch Zeitlupe, Rückblenden oder schnelle Schnitte), was eine gezielte Lenkung der Zuschaueraufmerksamkeit ermöglicht.
Wie visualisiert der Film seelisches Geschehen?
Durch Nahaufnahmen, Lichtsetzung und Musik kann der Film innere Zustände, Emotionen und Gedanken der Figuren für den Zuschauer unmittelbar erfahrbar machen.
Wer war Hugo Münsterberg und was war seine These?
Münsterberg war ein früher Filmtheoretiker. In seinem Essay „Warum wir ins Kino gehen“ argumentierte er, dass der Film die psychischen Prozesse des Geistes (wie Aufmerksamkeit und Erinnerung) objektiviert und dadurch seine Anziehungskraft entfaltet.
Gibt es noch Parallelen zwischen Film und Theater?
Obwohl beide Künste Schauspieler und Handlung nutzen, unterscheidet sie die Unmittelbarkeit. Das Theater lebt vom Live-Moment, während der Film durch die technische Bearbeitung eine kontrollierte, fiktionale Realität erschafft.
- Citar trabajo
- Aileh Ibavas (Autor), 2016, Besonderheiten des Films. Was liegt der Anziehungskraft des Mediums zugrunde?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323543