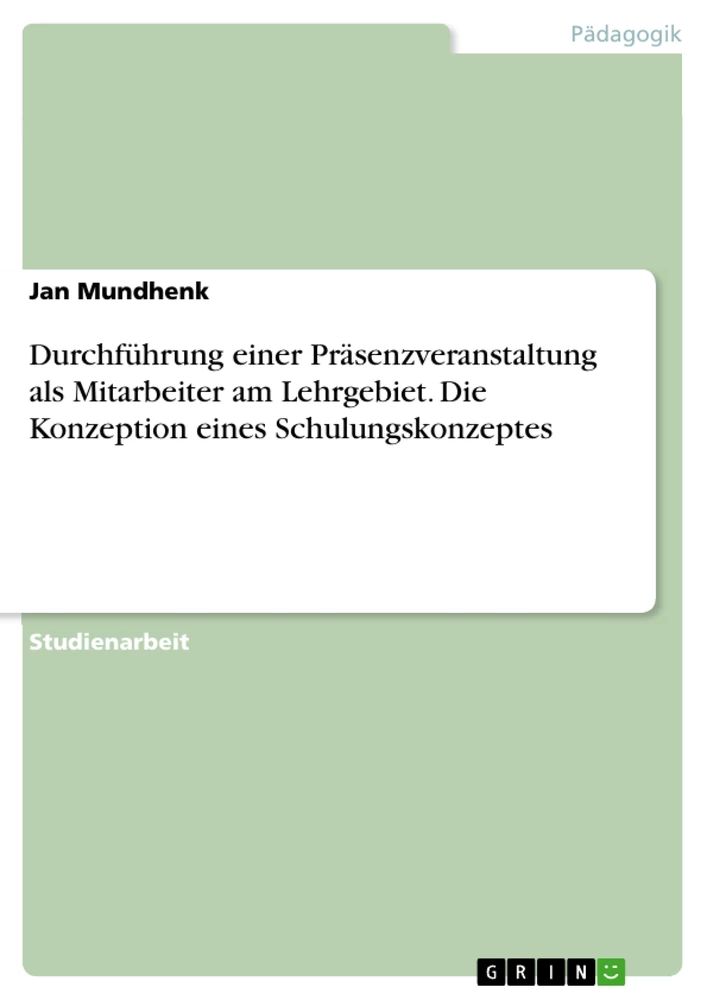Im Text geht es um die Konzeption eines Schulungskonzeptes für Mitarbeiter an einem Lehrgebiet zum Vorbereiten, Durchführen und Evaluieren eines Seminars vor Ort (zum Beispiel als Teil von Blended Learning).
In dieser Hausarbeit wird das 4C/ID-Modell von van Merriënboer et al. (2007) und van Merriënboer et al. (2002, S.39-64) angewendet auf das Thema. Dieser Anwendungsbereich heißt „Eine Präsenzveranstaltung durchführen als Mitarbeiter am Lehrgebiet“.
Besonders interessant am hier vorliegenden Thema ist für den Verfasser der Arbeit, dass er als Dozent tätig ist und somit häufig selbst Schulungen oder Seminare konzipieren, durchführen und evaluieren kann. Insofern hat sich ein Praxisbezug bei der Aufgabenstellung durchaus ergeben.
Ziel des 4CID-Modelles ist es, komplexe Fertigkeiten zu trainieren und dazu so zerlegt vorzubereiten, dass Instruktionsdesigner daraus eine Lernumgebung anfertigen können für ein Instructional Design. Damit kann schrittweise diese Fertigkeit mit all ihren Teilfertigkeiten erlernt werden und in der realen Situation anzuwenden.
Da das speziell zu vermittelnde Fachwissen der Präsenzveranstaltung nicht Gegenstand dieses Entwurfes ist, kann er auf verschiedene Lehrgebiete angewendet werden. Im Folgenden wird die Präsenzveranstaltung kurz als Seminar bezeichnet.
Das 4CID-Modell ist ein Modell in der Tradition des Instruktionsdesigns und wurde von van Merriënboer et al. (2007, S.9ff.) entwickelt mit den Komponenten Lernaufgaben (Learning Tasks), unterstützenden Informationen (Supportive Information), Ablaufinformationen oder prozeduralen Informationen (Procedural Information) und Übung von Teilfertigkeiten oder Teilaufgaben üben (Part-task Practice). Daraus wurden dann zehn Schritte entwickelt, wobei den Lernaufgaben die Schritte 1 bis 4 zugeordnet wurden, den Unterstützenden Informationen die Schritte 4 bis 6 und den prozeduralen Informationen die Schritte 7 bis 9 und den Übungen der Teilfertigkeiten der Schritt 10 von van Merriënboer et al. (2007, S.9ff.). Verpflichtend durchgeführt werden sollen die Schritte, in denen entsprechende Komponenten entwickelt werden (Design). Schritt 1, 4, 7 und 10 sind somit grundlegend wichtig. Die anderen Schritte können unterstützend durchgeführt werden, um eine vollständige Trainingsvorlage zu erarbeiten.
In der folgenden Tabelle sind diese Komponenten und Schritte noch einmal dargestellt und vom Autoren ins Deutsche übersetzt worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- 4CID-Modell
- Szenario
- Überblick
- Theoretischer Exkurs
- Pfadabhängigkeit
- Unterschied zwischen Didaktik und Instruktionsdesign
- Bezugstheorie des 4CID-Modells
- Hierarchische Kompetenzanalyse
- Hierarchieerstellung
- (Non-)Rekurrente Fertigkeiten
- Hierarchiefunktion
- Bildung von Aufgabenklassen
- Funktion
- Vereinfachende Annahmen und Aufgabenklassen
- Entwicklung von Lernaufgaben
- Lernaufgaben
- Variabilität
- Mediale Umsetzung
- Prozedurale und unterstützende Informationen
- Unterstützende Information
- Prozedurale Information
- Part-task Practice
- Didaktische Szenarien
- Diskussion
- Fidelity
- Fazit
- Verortung im ADDIE-Phasenmodell
- Stärken-Schwächen-Abschätzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit wendet das 4C/ID-Modell auf die Durchführung einer Präsenzveranstaltung an. Ziel ist es, die komplexe Fertigkeit des Seminarleitens mithilfe des Modells in Teilfertigkeiten zu zerlegen und daraus eine strukturierte Lernumgebung zu entwickeln. Der Praxisbezug ist durch die Tätigkeit des Autors als Dozent gegeben.
- Anwendung des 4C/ID-Modells auf komplexe Fertigkeiten
- Zerlegung komplexer Fertigkeiten in Teilfertigkeiten
- Entwicklung einer strukturierten Lernumgebung
- Analyse der Pfadabhängigkeit in der Didaktik
- Vergleich von Didaktik und Instruktionsdesign
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Anwendung des 4C/ID-Modells von van Merriënboer auf die Durchführung von Präsenzveranstaltungen. Der Autor betont den Praxisbezug aufgrund seiner eigenen Tätigkeit als Dozent. Das 4C/ID-Modell wird als Werkzeug zur strukturierten Gestaltung von Lernumgebungen für komplexe Fertigkeiten vorgestellt, wobei der Fokus auf der Zerlegung in Teilfertigkeiten und der schrittweisen Aneignung liegt. Das spezifische Fachwissen der Präsenzveranstaltung wird als austauschbar dargestellt, um die Anwendbarkeit des Modells auf verschiedene Lehrgebiete zu betonen.
Theoretischer Exkurs: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund, insbesondere das Konzept der Pfadabhängigkeit. Es wird erklärt, wie sich vergangene Entscheidungen auf zukünftige Entwicklungen auswirken und wie dies im Kontext von Didaktik und Instruktionsdesign relevant ist. Der Einfluss der etablierten Allgemeinen Didaktik im Vergleich zum eher neuen Instructional Design wird diskutiert, wobei die geringere Verbreitung deutschsprachiger Forschung zum letzteren hervorgehoben wird. Das Konzept eines stabilen Stadiums in reifen Entwicklungsprozessen wird im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Abkehr von etablierten Methoden erläutert.
Hierarchische Kompetenzanalyse: Dieses Kapitel befasst sich mit der Erstellung einer Fertigkeitenhierarchie zur systematischen Zerlegung der komplexen Fertigkeit „Durchführung einer Präsenzveranstaltung“. Die Unterscheidung zwischen wiederkehrenden und nicht-wiederkehrenden Fertigkeiten spielt eine zentrale Rolle. Der Prozess der Hierarchieerstellung und die Bestimmung der Funktion der einzelnen Hierarchieebenen werden detailliert beschrieben. Die Analyse dient als Grundlage für die Entwicklung spezifischer Lernaufgaben.
Bildung von Aufgabenklassen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bildung von Aufgabenklassen basierend auf der zuvor erstellten Fertigkeitenhierarchie. Es werden vereinfachende Annahmen erläutert, die die Entwicklung der Aufgabenklassen vereinfachen und gleichzeitig die Komplexität der Aufgabe beibehalten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Aufgabenklassen, die den Lernenden schrittweise an die komplexe Fertigkeit heranführen und dabei kognitive Überlastung vermeiden.
Entwicklung von Lernaufgaben: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Entwicklung von Lernaufgaben, die auf den zuvor definierten Aufgabenklassen basieren. Es werden verschiedene Aspekte der Lernaufgabengestaltung behandelt, wie z.B. die Berücksichtigung der Variabilität und die mediale Umsetzung. Das Kapitel legt den Grundstein für die praktische Anwendung des 4C/ID-Modells.
Prozedurale und unterstützende Informationen: In diesem Kapitel werden die prozeduralen und unterstützenden Informationen, die für das erfolgreiche Erlernen der Fertigkeiten notwendig sind, detailliert erläutert. Es wird unterschieden zwischen Informationen, die den Lernenden bei der Ausführung der Aufgaben unterstützen und Informationen, die den Ablauf der Aufgaben beschreiben. Die Bedeutung beider Informationsarten für den Lernerfolg wird hervorgehoben.
Part-task Practice: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung von Teilfertigkeitsübungen (Part-task Practice) im 4C/ID-Modell. Es wird dargelegt, wie diese Übungen zum Erlernen komplexer Fertigkeiten beitragen und welche Vorteile sie gegenüber dem direkten Üben der gesamten Fertigkeit bieten. Die Optimierung des Lernprozesses durch gezielte Teilfertigkeitsübungen steht im Mittelpunkt.
Didaktische Szenarien: Dieses Kapitel präsentiert didaktische Szenarien, die die Anwendung des 4C/ID-Modells in der Praxis verdeutlichen. Es wird diskutiert, wie die entwickelten Lernaufgaben, Informationen und Übungen in einem realistischen Kontext eingesetzt werden können. Der Aspekt der Fidelity (Echtheit) der Simulation wird ebenfalls berücksichtigt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum 4C/ID-Modell in der Seminarleitung
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des 4C/ID-Modells auf die komplexe Fertigkeit der Seminarleitung. Ziel ist die Zerlegung dieser Fertigkeit in Teilfertigkeiten und die Entwicklung einer strukturierten Lernumgebung für deren Erwerb. Der Autor nutzt seine Erfahrung als Dozent als Praxisbezug.
Was ist das 4C/ID-Modell?
Das 4C/ID-Modell (von van Merriënboer) ist ein Werkzeug zur Gestaltung von Lernumgebungen für komplexe Fertigkeiten. Es fokussiert auf die Zerlegung der Fertigkeit in Teilfertigkeiten und deren schrittweises Erlernen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anwendung des 4C/ID-Modells, die hierarchische Kompetenzanalyse zur Zerlegung der Seminarleitung in Teilfertigkeiten, die Bildung von Aufgabenklassen, die Entwicklung von Lernaufgaben, die Integration prozeduraler und unterstützender Informationen, Part-task Practice sowie die Gestaltung didaktischer Szenarien. Zusätzlich werden Pfadabhängigkeit in der Didaktik und der Unterschied zwischen Didaktik und Instruktionsdesign theoretisch beleuchtet.
Wie wird die komplexe Fertigkeit „Seminarleitung“ zerlegt?
Die Zerlegung erfolgt mithilfe einer hierarchischen Kompetenzanalyse. Dabei wird zwischen wiederkehrenden und nicht-wiederkehrenden Fertigkeiten unterschieden, um eine strukturierte Hierarchie zu erstellen, die als Grundlage für die Entwicklung von Lernaufgaben dient.
Welche Rolle spielen Aufgabenklassen?
Aufgabenklassen vereinfachen die Entwicklung von Lernaufgaben, indem sie die Komplexität der Seminarleitung schrittweise reduzieren, ohne den Kern der Fertigkeit zu vernachlässigen. Sie ermöglichen den Lernenden einen kontrollierten Zugang zur Gesamtfertigkeit.
Wie werden Lernaufgaben entwickelt und umgesetzt?
Die Lernaufgaben basieren auf den definierten Aufgabenklassen. Die Gestaltung berücksichtigt Variabilität und mediale Umsetzung. Der Fokus liegt auf der schrittweisen Aneignung der Teilfertigkeiten.
Welche Bedeutung haben prozedurale und unterstützende Informationen?
Prozedurale Informationen beschreiben den Ablauf der Aufgaben, während unterstützende Informationen den Lernenden bei der Ausführung helfen. Beide sind essentiell für den Lernerfolg.
Was ist Part-task Practice und warum ist sie wichtig?
Part-task Practice bezeichnet das Üben von Teilfertigkeiten. Es ist im 4C/ID-Modell zentral, da es den Lernprozess optimiert und im Vergleich zum direkten Üben der Gesamtfertigkeit effizienter ist.
Wie werden die Ergebnisse im Kontext des ADDIE-Modells verortet?
Die Arbeit beschreibt die Verortung der Ergebnisse innerhalb des ADDIE-Phasenmodells (Analyse, Design, Development, Implementation, Evaluation).
Welche Stärken und Schwächen des vorgestellten Ansatzes werden diskutiert?
Die Arbeit schließt mit einer Stärken-Schwächen-Analyse des entwickelten Ansatzes zur Vermittlung der Fertigkeit „Seminarleitung“ ab.
Wie wird die Echtheit (Fidelity) der Simulation berücksichtigt?
Der Aspekt der Fidelity, also die Realitätsnähe der simulierten Lernsituationen, wird in der Gestaltung der didaktischen Szenarien berücksichtigt, um einen möglichst authentischen Lernprozess zu gewährleisten.
Welche Bedeutung hat die Pfadabhängigkeit im Kontext dieser Arbeit?
Der theoretische Exkurs beleuchtet die Pfadabhängigkeit, also den Einfluss vergangener Entscheidungen auf zukünftige Entwicklungen in der Didaktik und im Instruktionsdesign. Es wird analysiert, wie etablierte Methoden die Entwicklung neuer Ansätze beeinflussen.
Wie unterscheidet sich diese Arbeit von herkömmlichen didaktischen Ansätzen?
Die Arbeit hebt sich durch die systematische Anwendung des 4C/ID-Modells und die detaillierte Zerlegung der komplexen Fertigkeit „Seminarleitung“ von traditionellen didaktischen Ansätzen ab. Der Fokus liegt auf der strukturierten Gestaltung einer Lernumgebung und der Berücksichtigung von Teilfertigkeiten.
- Citation du texte
- Jan Mundhenk (Auteur), 2014, Durchführung einer Präsenzveranstaltung als Mitarbeiter am Lehrgebiet. Die Konzeption eines Schulungskonzeptes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323594