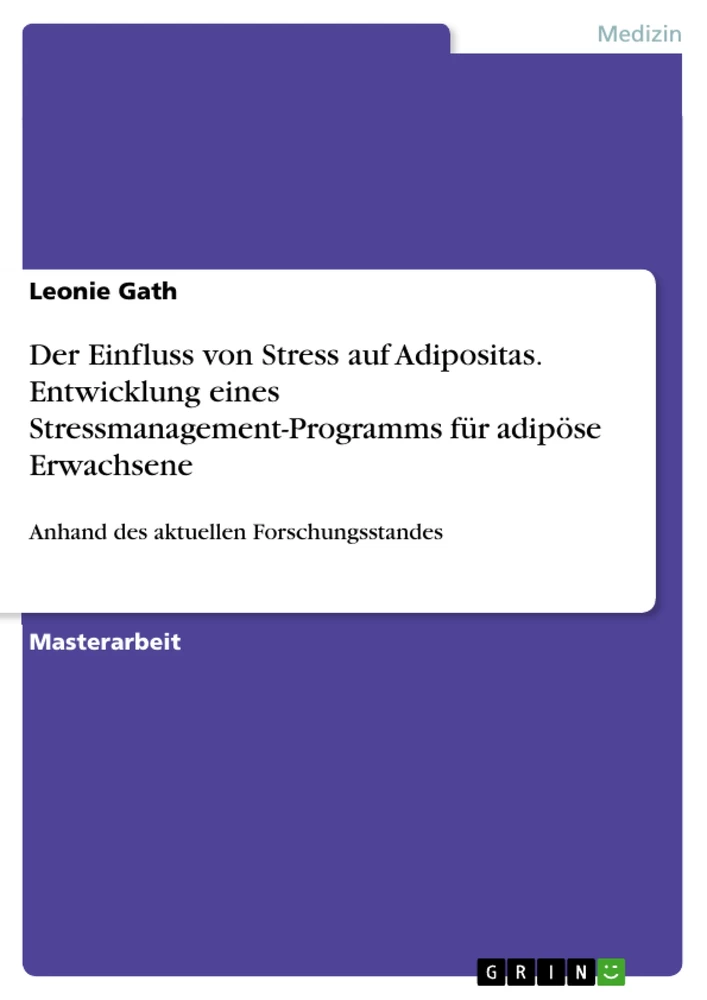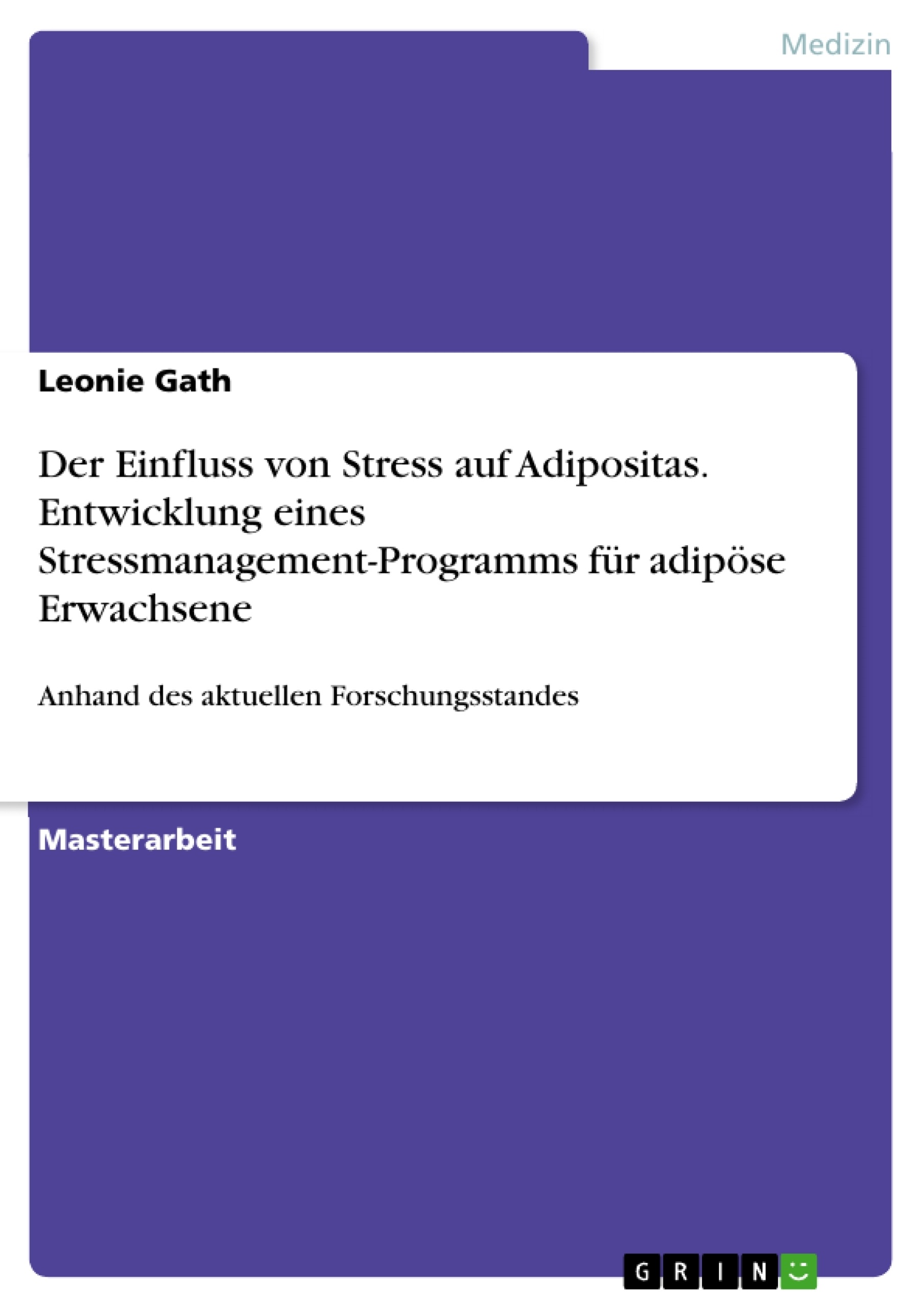Übergewicht und Adipositas stellen unverändert eine große gesundheitspolitische Herausforderung dar. Zum einen durch deren weitreichende Verbreitung und zum anderen birgt eine lang bestehende Adipositas erhebliche gesundheitliche Risiken. Da oftmals mehrere Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen werden, sind viele Betroffene multimorbid. Adipositas verursacht daher erhebliche Kosten.
Es besteht eine unüberschaubare Vielzahl an Methoden zur Gewichtsreduktion. Die Grundlage und erfolgversprechendste Methode bildet die Basistherapie, bestehend aus einer Kombination von Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie. Jedoch ist für die psychosomatische Betrachtungsweise von Übergewicht und Adipositas ebenso ein multifaktorieller Verstehensansatz unabdingbar. Im Vordergrund jeder Therapie sollte immer die langfristige und dauerhafte Gewichtsabnahme bzw. -stabilisierung stehen. Folglich sollten alle Strategien auf eine sichere, nebenwirkungsarme, effektive und kostengünstige Vorgehensweise abzielen und eine Rückfallprophylaxe mit einschließen. Da psychosozialer Stress ein Prädiktor für Rückfälle in alte Verhaltensmuster ist, ist es sinnvoll, Methoden zur Stress- und Spannungsreduktion in verhaltenstherapeutischen Programmen zu vermitteln. Zudem scheint das Erlernen einer Entspannungsmethode förderlich, da Essen im Kontext von Adipositas häufig als dysfunktionale Entspannungsmethode Anwendung findet. Derzeit existierende Interventionsprogramme bestehen zwar überwiegend aus allen Eckpfeilern der Basistherapie, allerdings reflektieren sie die Faktoren genetische Disposition, Ernährung, Bewegung, mentaler Umgang mit dem Problem, soziale Situation sowie psychosoziale Konstellation mit unterschiedlicher Gewichtung, oftmals wird der Ernährungsmodifikation und der Bewegungstherapie jedoch die größte Bedeutung zugesprochen. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen, die Stressmanagement-Komponenten beinhalten und alternative Stressbewältigungsmöglichkeiten zum Essen in emotionalen Situationen aufzeigen, werden weitaus weniger praktiziert, weswegen nur eine geringe Anzahl wissenschaftlich evaluierter Studien aufzufinden ist.
Da die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas in der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland trotz aller Bemühungen weiterhin auf hohem Niveau liegt, und Betroffene im Vergleich zu Normalgewichtigen vermehrt unter psychischen Störungen leiden, besteht diesbezüglich ein enormer Handlungsbedarf, an dem die vorliegende Arbeit ansetzt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- ZIELSETZUNG
- GEGENWÄRTIGER KENNTNISSTAND
- Entstehung und Verlauf von Stressprozessen.
- Definition von Stress
- Stressoren
- Die Stressreaktion..
- Biopsychosoziale Grundlagen der Stressreaktion.
- Biologische Perspektive..
- Soziologische Perspektive...
- Psychologische Perspektive....
- Stressmodelle
- Cannon und Selye.
- Stressmodell von Lazarus.
- Salutogenetischer Ansatz
- Stressbewältigung.
- Proaktive Bewältigung.
- Individuelle und strukturelle Stressbewältigung
- Das Zwei-Prozess-Modell
- Adipositas: Begriff, Entstehung, Stresspotentiale und Therapiemethoden
- Definition und Klassifikation von Übergewicht und Adipositas
- Prävalenz der Adipositas
- Ursachen und Folgen...
- Lebensqualität und Barrieren im Alltag
- Ernährungs- und Bewegungsverhalten
- Psychosoziale Aspekte.
- Herkömmliche Bestandteile einer Adipositastherapie
- Ernährungsmodifikation.
- Körperliche Aktivität/Training
- Verhaltensmodifikation.
- Kombinierte Interventionen...
- Therapieziele und Voraussetzungen für den Therapieerfolg
- Aktuelle Forschungslage bzgl. des Zusammenhangs von Stress und Adipositas
- Status quo der Wirksamkeit von Stressmanagement-Programmen für adipöse Erwachsene
- METHODIK...
- Literaturrecherche.
- Recherchethemen und Definition der Fragestellung ..
- Aufstellung der Suchbegriffe....
- Bestimmung der Recherchedatenbanken..
- Suchstrategie
- Ein- und Ausschlusskriterien ..
- Auswahl der relevanten Studien.
- Entwicklung eines Stressmanagement-Programms für adipöse Erwachsene ...
- Zielsetzung und Nutzen des Programms...
- Zielgruppe.
- Einsatzbereiche......
- Rahmenbedingungen .
- Aufbau, Inhalte und Lernziele
- Detaillierte Darstellung der Programmeinheiten .
- Mögliche Probleme bei der Programm-Durchführung
- Verhaltensmodifikation
- Sicherstellung der Programmqualität und des Programmerfolges..
- ERGEBNISSE
- Ergebnisdarstellung der Literaturrecherche.
- Darstellung der Kernaspekte des konzipierten Stressmanagement-Programms ..
- DISKUSSION..
- Gesamtdiskussion und praktische Implikationen für zukünftige Interventionen.
- Interpretation der Ergebnisse unter den Aspekten der Problemstellung
- Grenzen der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit.
- Schlussfolgerung und Ausblick
- ZUSAMMENFASSUNG ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Bedeutung von Stressmanagement-Programmen für adipöse Erwachsene zu beleuchten und ein solches Programm zu entwickeln.
- Zusammenhang zwischen Stress und Adipositas
- Aktuelle Forschungslage zu Stressmanagement-Programmen für adipöse Erwachsene
- Entwicklung eines evidenzbasierten Stressmanagement-Programms
- Potenzielle Auswirkungen des Programms auf die Gewichtsreduktion und die Lebensqualität der Teilnehmer
- Praktische Implikationen für die Anwendung in der Adipositastherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem von Übergewicht und Adipositas sowie die Bedeutung von Stressmanagement in diesem Kontext dar. Das Kapitel "Gegenwärtiger Kenntnisstand" beleuchtet die Entstehung und den Verlauf von Stressprozessen, die verschiedenen Stressmodelle und die Möglichkeiten der Stressbewältigung. Im Anschluss wird Adipositas definiert, ihre Prävalenz und Ursachen sowie die gängigen Therapiemethoden erläutert. Die Methodik beschreibt die Literaturrecherche, die zur Entwicklung des Stressmanagement-Programms geführt hat. Die Ergebnisse der Literaturrecherche und die Details des Programms werden im nächsten Kapitel vorgestellt. Die Diskussion analysiert die Ergebnisse der Literaturrecherche und die praktische Relevanz des entwickelten Programms. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten gegeben.
Schlüsselwörter
Adipositas, Stress, Stressmanagement, Gewichtsreduktion, Entspannungstechniken, Verhaltenstherapie, evidenzbasierte Intervention, Lebensqualität, Multimorbidität, psychosoziale Faktoren, Therapieerfolg.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Stress und Adipositas zusammen?
Psychosozialer Stress ist ein Prädiktor für Rückfälle in alte Verhaltensmuster. Zudem wird Essen oft als dysfunktionale Entspannungsmethode genutzt, um Stress abzubauen.
Was ist das Ziel des entwickelten Stressmanagement-Programms?
Das Programm soll adipösen Erwachsenen alternative Strategien zur Stressbewältigung aufzeigen, um die langfristige Gewichtsstabilisierung und Lebensqualität zu fördern.
Welche Rolle spielen Entspannungsmethoden bei der Gewichtsabnahme?
Entspannungsmethoden helfen dabei, das Spannungsniveau zu senken, ohne auf Nahrung als Beruhigungsmittel zurückzugreifen.
Was umfasst die Basistherapie bei Adipositas?
Die Basistherapie besteht aus einer Kombination von Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie.
Warum scheitern viele herkömmliche Diäten?
Viele Programme vernachlässigen psychologische Faktoren wie Stress und emotionale Essmuster, was häufig zu Rückfällen führt.
- Entstehung und Verlauf von Stressprozessen.
- Quote paper
- Leonie Gath (Author), 2015, Der Einfluss von Stress auf Adipositas. Entwicklung eines Stressmanagement-Programms für adipöse Erwachsene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323606