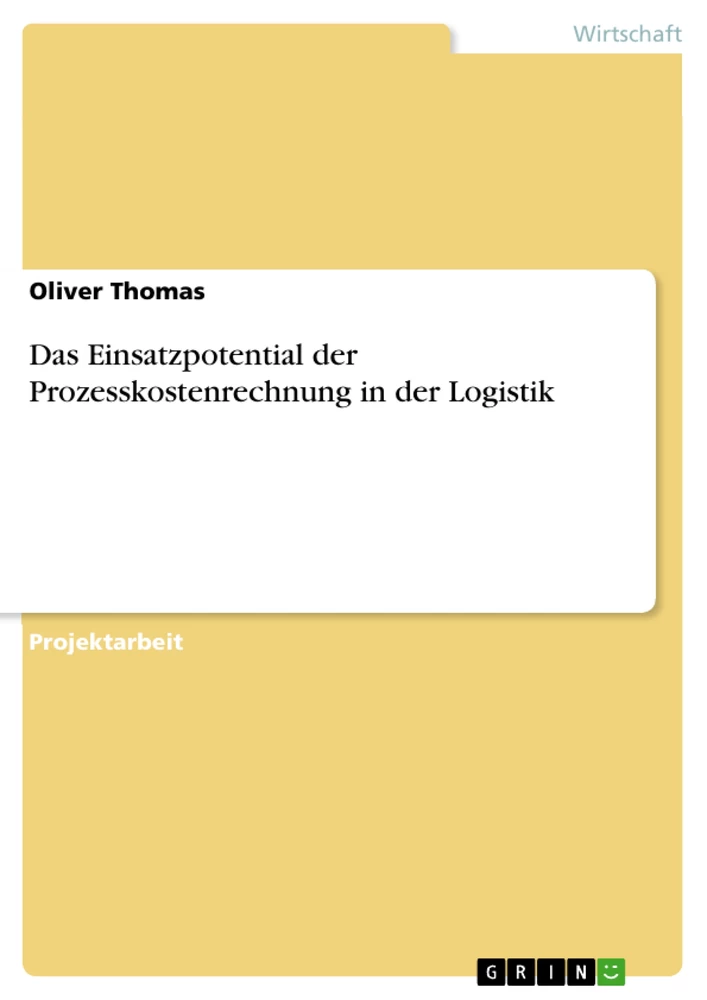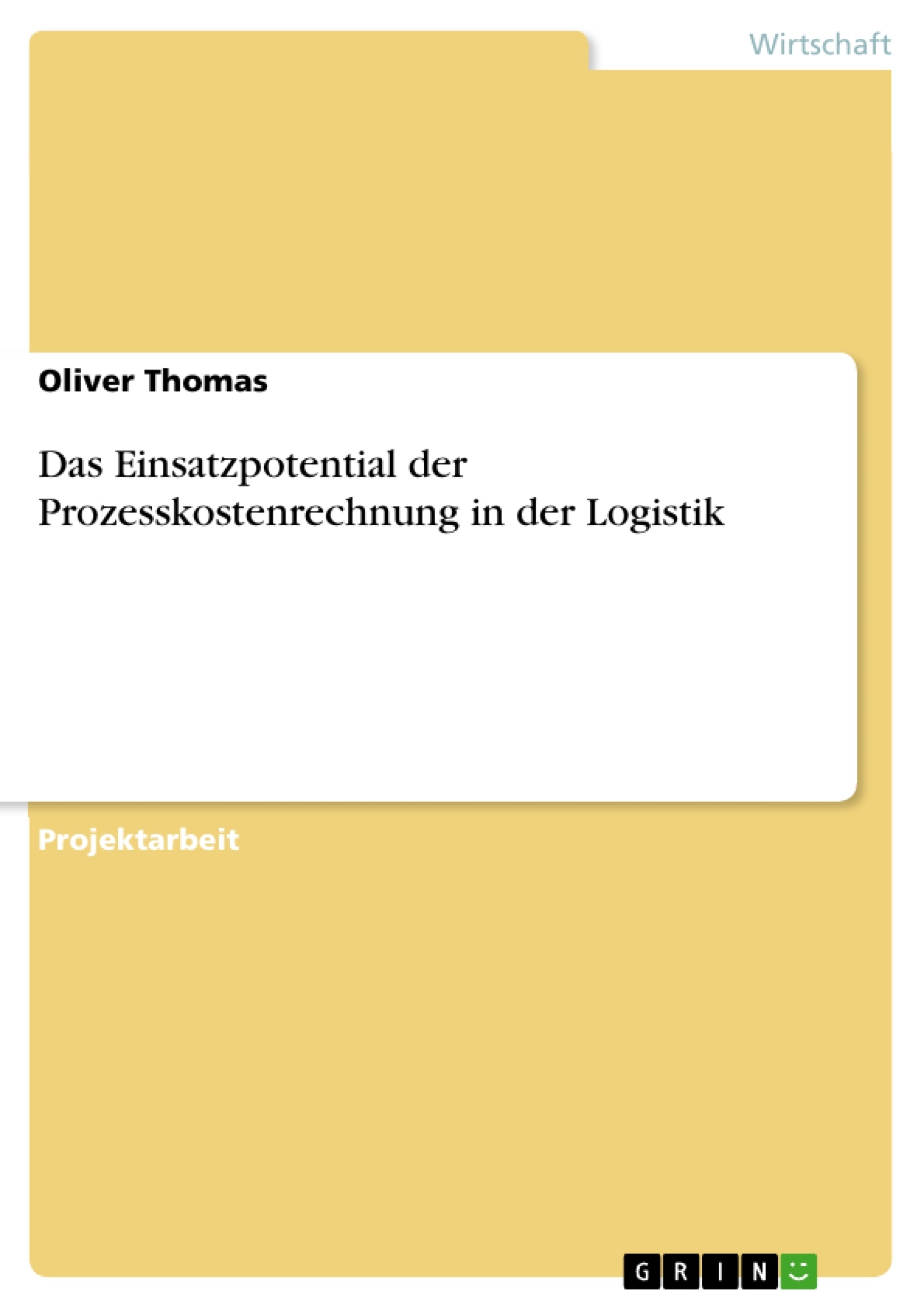Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer Supply Chain für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) die Auswirkung des Nachfrageverhaltens eines Endkunden beim Logistikdienstleister (LDL) anhand eines Anwendungsbeispiels der Prozesskostenrechnung sichtbar zu machen. Unter Anwendung der Elemente der Prozesskostenrechnung werden die prozessualen Aufwände des Logistikbetriebes vor und nach einer Veränderung des Nachfrageverhaltens aufbereitet, um so eine Basis zur transparenten und wirtschaftlichen Leitung des Betriebes zu schaffen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Erfassung der leistungsmengeninduzierten (lmi) Prozesskosten, welche das Herzstück des Kontraktlogistik Dienstleisters sind.
Eine grundlegende Aufgabe der Logistik besteht heutzutage darin, gesamte Supply Chains zu gestalten, diese zu betreuen und im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) einer permanenten Rückkopplung zu unterziehen. So soll durch fortwährendes Lernen eine permanente Verbesserung durch Anpassung der Prozesse erzielt werden. Angestrebt wird der strategische Fit, der Punkt, an dem das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen für alle Beteiligten größtmöglich ist.
Der KVP führt mitunter dazu, dass Supply Chain Beteiligte interne Prozesse verändern, ohne diese mit anderen Netzwerkbeteiligten abzustimmen. Kleine „interne Veränderungen“ können in diesem Zuge durch den „Bullwhip-Effekt“ ungeahnte Auswirkungen aufbauen. Diese Auswirkungen können zu einer negativen Veränderung der Prozesse bzw. der benötigen Ressourcen der Supply Chain Akteure führen. Dies hat unter Umständen einen Anstieg der Gemein- oder Prozess Einzelkosten zur Folge, welche nicht verursachungsgerecht erfasst und verbucht werden können. Die traditionelle Kostenstellenrechnung gerät hier schnell an ihre Grenzen. Betriebliche Kostenrechner und Controller haben seitens der Wirtschaft die mangelnde Transparenz steigender Kosten als Anlass gesehen, nach neuen Wegen der Kostenrechnung zu suchen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung / Ziel dieser Arbeit
- Problemstellung
- Ziel dieser Arbeit
- Begriffliche Grundlagen
- Prozesse
- Prozesskostenrechnung
- Logistik
- Nachfrageverhalten
- Das Nachfrageverhalten in der Kontraktlogistik und dessen Auswirkung
- Das Nachfrageverhalten als wesentlicher Faktor in der Preisfindung
- Veränderungen im Nachfrageverhalten
- Ausgangssituation Logistikprozess, Szenario A
- Veränderung des Bestell- /Nachfrageverhalten, Szenario B
- Pauschal betrachtete Auswirkung
- Bewertungsansatz: Die Prozesskostenrechnung
- Die Prozesskostenrechnung als Instrument
- Aufbau einer Prozesskostenrechnung
- Phase 1, Aufnahme der Ist-Prozesse
- Phase 2, Ermittlung der Kostentreiber
- Phase 3, Zusammenfassung der Teil- in Hauptprozesse
- Phase 4, Berechnung der Prozesskosten und Kostensätze
- Anwendung der Prozesskostenrechnung
- Die Ist-Analyse
- Ermittlung der Kostentreiber
- Zusammenfassung der Teil- in Hauptprozesse
- Berechnung der Prozesskosten, Modellerstellung
- Prozesskosten Szenario A
- Prozesskosten Szenario B
- Ergebnisbetrachtung
- Ergebnisdiskussion
- Auswirkung beim Empfänger (Einzelhandel)
- Auswirkung beim Logistikdienstleister
- Auswirkung beim Kunden (Hersteller/Lieferant)
- Positive Effekte der PKR
- Allokationseffekt
- Komplexitätseffekt
- Degressionseffekt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht das Einsatzpotential der Prozesskostenrechnung in der Logistik anhand eines Anwendungsbeispiels für Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Ziel ist es, die Auswirkungen des Nachfrageverhaltens eines Endkunden auf die Prozesse eines Logistikdienstleisters (LDL) mithilfe der Prozesskostenrechnung aufzuzeigen.
- Einfluss des Nachfrageverhaltens auf die Kostenstruktur in der Logistik
- Anwendung der Prozesskostenrechnung zur Analyse und Optimierung von Logistikprozessen
- Identifizierung von Kostentreibern in der Logistik
- Entwicklung eines Modells zur Berechnung von Prozesskosten in der Logistik
- Bewertung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Logistikprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Problemstellung und des Ziels der Arbeit. Im Anschluss werden die begrifflichen Grundlagen von Prozessen, Prozesskostenrechnung, Logistik und Nachfrageverhalten erläutert. Kapitel 3 analysiert das Nachfrageverhalten in der Kontraktlogistik und dessen Auswirkungen auf die Logistikprozesse. Kapitel 4 stellt die Prozesskostenrechnung als Instrument zur Kostenverursachungsgerechten Verrechnung vor. In Kapitel 5 wird die Anwendung der Prozesskostenrechnung anhand eines konkreten Beispiels demonstriert, wobei die Ist-Analyse, die Ermittlung der Kostentreiber und die Berechnung der Prozesskosten für zwei Szenarien (Szenario A und Szenario B) betrachtet werden. Kapitel 6 bietet eine Ergebnisbetrachtung, die die Auswirkungen der Prozesskostenrechnung auf verschiedene Stakeholder (Empfänger, Logistikdienstleister, Kunde) beleuchtet. Schließlich werden die positiven Effekte der Prozesskostenrechnung zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Prozesskostenrechnung, Logistik, Nachfrageverhalten, Kostentreiber, Supply Chain, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Logistikdienstleister, Szenarioanalyse, Effizienz, Wirtschaftlichkeit.
- Citar trabajo
- Oliver Thomas (Autor), 2015, Das Einsatzpotential der Prozesskostenrechnung in der Logistik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323624