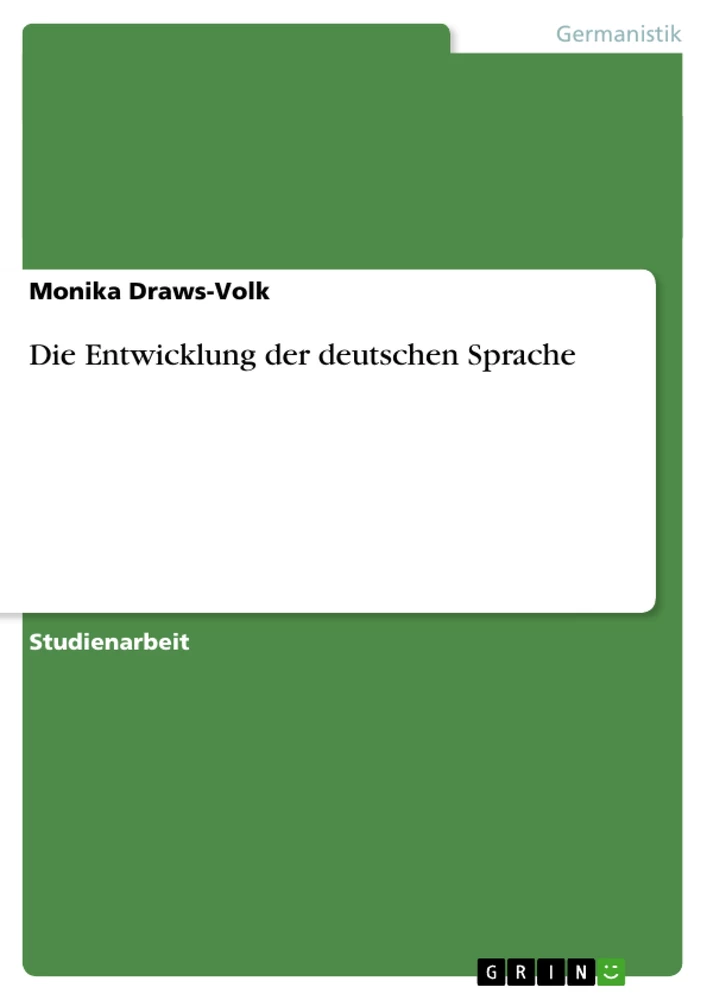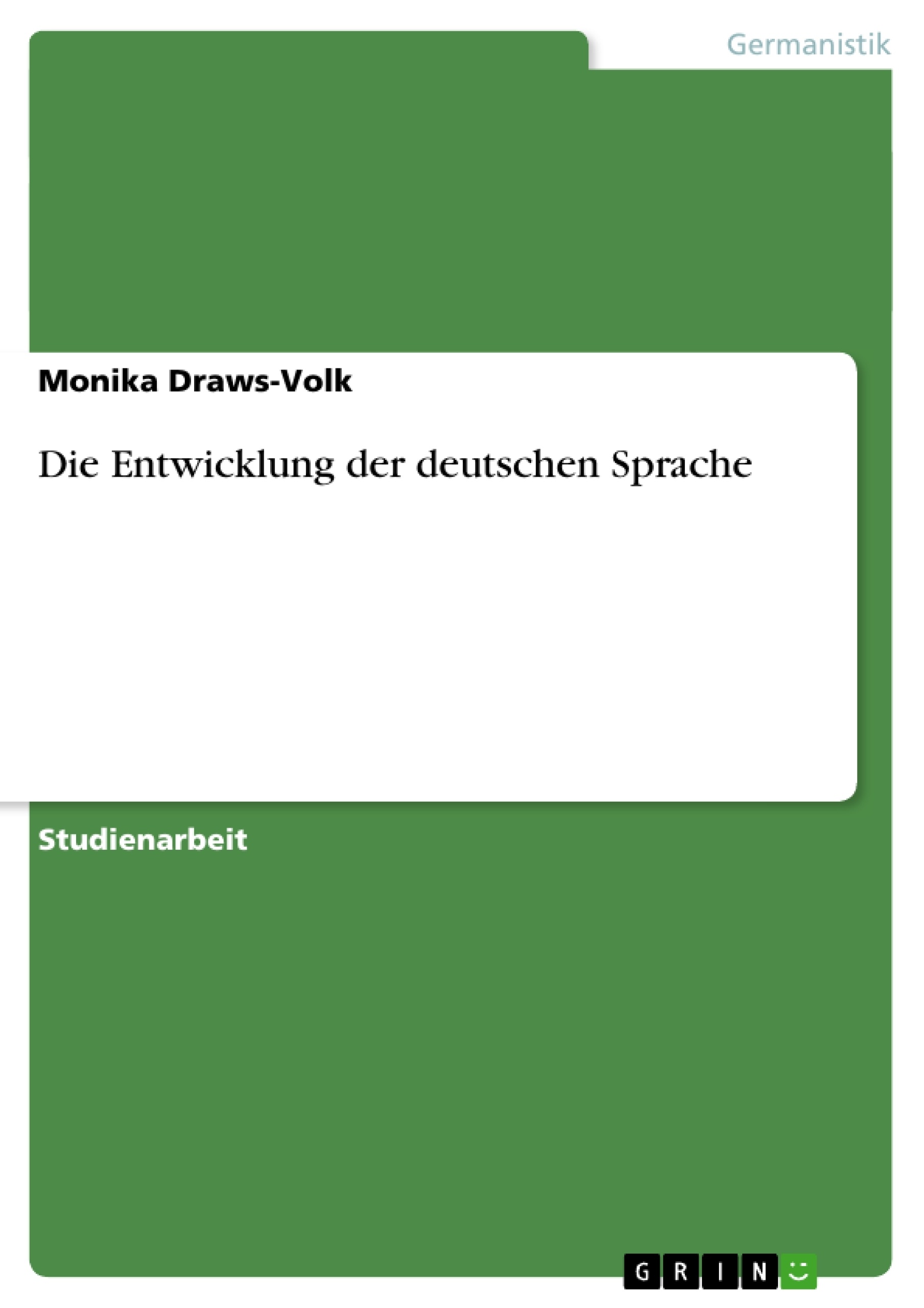Die Kontinuitätstheorie von Karl Viktor Müllenhoff
Karl Müllenhoff (1818-1884) entwickelte 1863 die Theorie von der Kontinuität der Schriftsprache seit althochdeutscher Zeit. Laut Müllenhoff hat sich die deutsche Sprache der Gegenwart kontinuierlich in fünf Etappen, vom 9.-16. Jahrhundert, entwickelt. Diese Entwicklung steht für Müllenhoff in einem engen Zusammenhang zwischen der Abfolge der kaiserlichen Machtzentren und den entsprechenden politisch-kulturellen Höhepunkten, die eine geographische Reihung von Nordwest, Südwest, Mittelost und der jeweiligen landschaftlichen Prägung der Schriftsprache erkennen lassen. Die Hauptträger seiner Theorie sind die Kaiserhöfe und die Kanzleien. Seine These zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache erschien zunächst in der Vorrede zur 2. Auflage seiner Textsammlung „ Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem 8. - 12. Jahrhunder“.3 Die karolingische Hofsprache
Karl Müllenhoff setzt voraus, dass Sprache mit Schriftlichkeit verbunden ist und die Anfänge der deutschen Sprache, die über den Mundarten steht, auf Karl den Großen (768-814) und seinen Hof zurückzuführen sind. Er stützt seine These darauf, dass durch die Bildungsreform Karl des Großen und dem fränkisch-angelsächsischen Gelehrtenkreis an seinem Aachener Hof, die Kluft zwischen Latein und Volkssprache überbrückt wird. Weil der Frankenherrscher 794, im Zuge seiner Reform, die Geistlichen aufgefordert hat, die wichtigsten kirchlichen Texte in die Volkssprache zu übersetzen. Außerdem hat sich nach 800 eine karolingische Hofsprache herausgebildet. Die Grundlage für diese Sprache ist das Mainfränkische, das durch seine Mittellage günstige Voraussetzungen für die Vermittlung zwischen dem Norden und Süden hat. Um die Heiden effizient zu bekehren, mussten die Mönche sich deren Sprache bedienen, deshalb übersetzten sie ihre religiösen Schriften in die Volkssprache. Dies brachte es mit sich, dass manche Wörter aus dem Lateinischen eine volkstümliche Entsprechung brauchten, allerdings wurde nicht jeder Sprachvorschlag von der Bevölkerung verstanden. So wurde das lateinische „spiritus sanctus“ erst mit „ther uiho atu“ (der heilige Atem) wiedergegeben, später setzte sich die angelsächsische Variante „ther heilago geist“ (der heilige Geist) durch.
nen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kontinuitätstheorie von Karl Viktor Müllenhoff
- Die karolingische Hofsprache
- Die Träger der Schriftkultur
- Die althochdeutsche Sprache
- Die mittelhochdeutsche Hofsprache der Staufer
- Die mittelhochdeutsch Sprache
- Die Erweiterung des deutschen Sprachraums
- Das Deutsch der Luxemburger in Prag
- Das Deutsch der Luxemburger in Prag
- Das Deutsch der Luxemburger in Prag
- Das Deutsch der Luxemburger in Prag
- Das Deutsch der Luxemburger in Prag
- Der französische Spracheinfluss auf das Neuhochdeutsche
- Martin Luther
- Kritik
- Resümee
- Die karolingische Hofsprache
- Konrad Burdachs Theorie von der Prager Kanzleisprache
- Der Einfluss der italienischen Humanisten
- Rhetorische Elemente treten in den Vordergrund
- Kritik
- Resümee
- Der Einfluss der italienischen Humanisten
- Frings Theorie der Sprachentwicklung im mitteldeutschen Osten
- Kritik
- Resümee
- W. Beschs Theorie: Zur Entstehung der nhd. Schriftsprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der deutschen Sprache und den Theorien zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Die Arbeit analysiert die wichtigsten Theorien von Karl Viktor Müllenhoff, Konrad Burdach, Theodor Frings und Werner Besch und untersucht deren Stärken und Schwächen. Die Arbeit zeigt, wie sich die deutsche Sprache im Laufe der Geschichte entwickelt hat und welche Faktoren zu ihrer Einigung beigetragen haben.
- Die Kontinuitätstheorie von Karl Viktor Müllenhoff und ihre Verbindung zur karolingischen Hofsprache
- Die Rolle des Mittelhochdeutschen und der Luxemburger in Prag bei der Sprachentwicklung
- Der Einfluss der Prager Kanzleisprache und der italienischen Humanisten
- Die Theorie der Sprachentwicklung im mitteldeutschen Osten nach Frings
- Die Bedeutung der Schriftlichkeit und der Bildung für die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik der Sprachentwicklung und die Bedeutung der neuhochdeutschen Schriftsprache dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Sprachvereinigung und führt die wichtigsten Theorien der Sprachgeschichte ein.
- Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Kontinuitätstheorie von Karl Viktor Müllenhoff. Die Theorie geht von einer kontinuierlichen Entwicklung der deutschen Sprache seit der karolingischen Zeit aus und betont die Rolle der Kaiserhöfe und Kanzleien. Die karolingische Hofsprache wird im Detail beleuchtet, sowie der Einfluss des lateinischen auf die Volkssprache.
- Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf Konrad Burdachs Theorie der Prager Kanzleisprache. Hier wird die Rolle der italienischen Humanisten und der rhetorischen Elemente in der deutschen Sprache untersucht.
- Der dritte Teil analysiert Frings Theorie der Sprachentwicklung im mitteldeutschen Osten und untersucht die Kritik an dieser Theorie.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen Sprachgeschichte, Sprachentwicklung, neuhochdeutsche Schriftsprache, karolingische Hofsprache, mittelhochdeutsche Sprache, Prager Kanzleisprache, italienische Humanisten, Sprachwandel, Sprachvereinigung, Kontinuitätstheorie, Theorie der Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Kontinuitätstheorie von Karl Viktor Müllenhoff?
Sie besagt, dass sich die deutsche Schriftsprache seit der althochdeutschen Zeit kontinuierlich in Verbindung mit kaiserlichen Machtzentren entwickelt hat.
Welche Rolle spielte Karl der Große für die deutsche Sprache?
Durch seine Bildungsreform wurde die Kluft zwischen Latein und Volkssprache überbrückt und eine karolingische Hofsprache geschaffen.
Was ist die Theorie der Prager Kanzleisprache?
Konrad Burdach vertrat die Ansicht, dass die moderne Schriftsprache maßgeblich durch die Kanzlei der Luxemburger in Prag und italienische Humanisten geprägt wurde.
Wie beeinflusste Martin Luther die Sprachentwicklung?
Luther nutzte eine volksnahe Sprache für seine Bibelübersetzung, was wesentlich zur Vereinheitlichung der neuhochdeutschen Schriftsprache beitrug.
Was war der Beitrag von Theodor Frings zur Sprachforschung?
Frings untersuchte die Sprachentwicklung im mitteldeutschen Osten und deren Einfluss auf das heutige Deutsch.
Warum mussten kirchliche Texte übersetzt werden?
Um die Heiden effizient bekehren zu können, mussten Mönche die Volkssprache nutzen, was zur Entstehung vieler neuer deutscher Begriffe führte.
- Citar trabajo
- Monika Draws-Volk (Autor), 2001, Die Entwicklung der deutschen Sprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32375