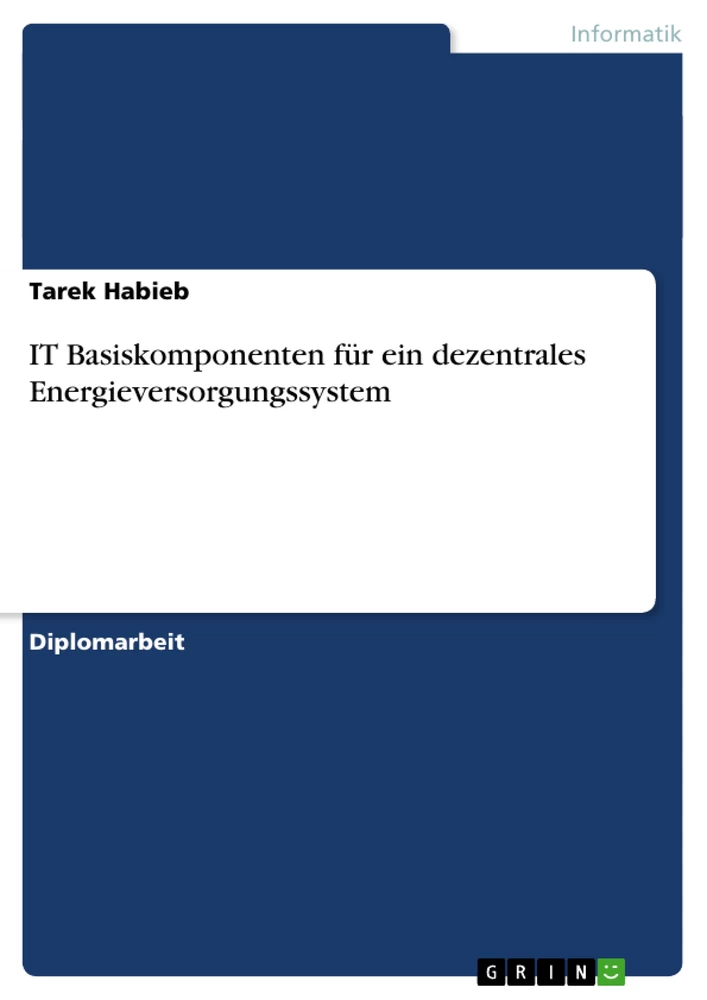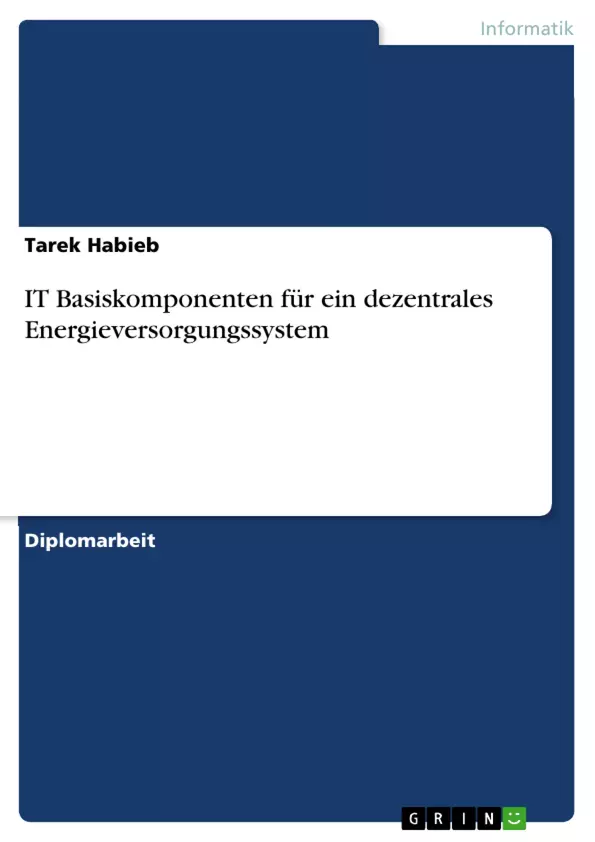Durch den von der Bundesregierung angestrebten Ausstieg aus der Atomenergie und die angestrebte Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern hat die Nutzung regenerativer Energiequellen in den letzten Jahren vermehrt zugenommen. Intensive Forschungen wurden im Vergleich zu anderen regenerativen Energiequellen vor allem in der Windenergienutzung und in der Entwicklung von Brennstoffzellen betrieben, um auf dezentraler Ebene einen wirtschaftlichen Ertrag an elektrischer Energie zu gewinnen. Die Liberalisierung des gesamten Energiemarktes und die Förderung regenerativer Energieerzeugung tragen dazu bei, dass dieser Sektor für weitere Marktteilnehmer wirtschaftlich attraktiv wird. Verbrauchern wird die Möglichkeit gegeben, sich einen für sie günstigen Energielieferanten auszuwählen. Dabei stellen sich die Energieversorger auf einen künftig steigenden Wettbewerb ein und sind bemüht, sich durch präventive Maßnahmen langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Durch den Einsatz dezentraler Energieerzeuger sollen künftig nicht nur autonome Inselsysteme, sondern auch flächendeckend Haushalte und gewerbliche Kleinunternehmen sowohl mit elektrischer als auch mit thermischer Energie versorgt werden. Hierzu bedarf es der Entwicklung sowie des Ausbaus vorhandener Infrastruktur von Energieversorgungssystemen mit dem Ziel der optimalen Eingliederung dezentraler Energieerzeuger.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Dezentrale Energieversorgung
- 1.1 Entwicklungen der Energienutzung
- 1.2 Ziel und Gang der Arbeit
- 2 Grundlagen des Energiemanagements
- 2.1 Energieversorgungsstrukturen
- 2.1.1 Zentrale Struktur
- 2.1.2 Dezentrale Struktur
- 2.1.3 Zukünftige Entwicklungen
- 2.2 Dezentrales Energiemanagement
- 2.3 Lastmanagement
- 2.4 Dezentrale Energieerzeugung
- 2.4.1 Windkraft
- 2.4.2 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
- 2.4.2.1 Blockheizkraftwerke (BHKW)
- 2.4.2.2 Brennstoffzellen
- 2.4.3 Wasserkraft
- 2.4.4 Sonnenenergie
- 2.4.4.1 Photovoltaik-Anlagen
- 2.4.4.2 Solarthermien
- 2.5 Energiespeicher
- 2.6 Zusammenfassung
- 3 Kommunikationsmechanismen für dezentrale Energieerzeugungsanlagen
- 3.1 Architektur von Kommunikationssystemen
- 3.1.1 Kommunikationsmedien und -techniken
- 3.1.2 Übersicht der Kommunikationstechniken
- 3.1.3 Technische Schnittstellen
- 3.1.4 Standardisierung
- 3.1.5 IT-Sicherheitsmanagement
- 3.2 Kommunikation mit dezentralen Energieerzeugungsanlagen
- 3.2.1 Kommunikationsaufbau
- 3.2.2 Steuerung und Regelung
- 3.2.2.1 Windkraftanlage
- 3.2.2.2 Photovoltaik-Anlage
- 3.2.2.3 Solarthermien
- 3.2.2.4 Wasserkraftwerke
- 3.2.2.5 Blockheizkraftwerke
- 3.2.2.6 Brennstoffzellen
- 3.2.3 Offene Systeme
- 3.2.4 Energiedatenerfassung und -auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die IT-Basiskomponenten für ein dezentrales Energieversorgungssystem. Das Hauptziel ist die Analyse der notwendigen Kommunikationsmechanismen und -techniken für die effiziente Steuerung und Regelung dezentraler Energieerzeugungsanlagen.
- Dezentrale Energieversorgung und deren Vorteile
- Grundlagen des Energiemanagements in dezentralen Systemen
- Kommunikationsarchitekturen für dezentrale Energieerzeuger
- Steuerung und Regelung von verschiedenen Energieerzeugungsformen
- IT-Sicherheitsaspekte in dezentralen Energiesystemen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Dezentrale Energieversorgung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der dezentralen Energieversorgung ein und beleuchtet die aktuellen Entwicklungen in der Energienutzung. Es beschreibt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den weiteren Verlauf.
2 Grundlagen des Energiemanagements: Das Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Strukturen der Energieversorgung, sowohl zentral als auch dezentral, und analysiert zukünftige Entwicklungstrends. Es untersucht das dezentrale Energiemanagement, Lastmanagement und verschiedene dezentrale Energieerzeugungsformen wie Windkraft, Kraft-Wärme-Kopplung (inkl. BHKW und Brennstoffzellen), Wasserkraft und Sonnenenergie (Photovoltaik und Solarthermie). Schließlich werden Energiespeicher und eine zusammenfassende Betrachtung der behandelten Themen präsentiert.
3 Kommunikationsmechanismen für dezentrale Energieerzeugungsanlagen: Dieses Kapitel analysiert die Architektur von Kommunikationssystemen im Kontext dezentraler Energieerzeugung. Es befasst sich mit verschiedenen Kommunikationsmedien und -techniken, technischen Schnittstellen, Standardisierung und IT-Sicherheitsmanagement. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Kommunikationsaufbau, der Steuerung und Regelung verschiedener Energieerzeugungsanlagen (Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Wasserkraft, BHKW, Brennstoffzellen), sowie offenen Systemen und der Energiedatenerfassung und -auswertung. Die detaillierte Betrachtung der einzelnen Technologien und deren Integration in ein übergreifendes System steht im Mittelpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Dezentrale Energieversorgung, Energiemanagement, Kommunikationstechniken, IT-Sicherheit, Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung, Brennstoffzellen, Wasserkraft, Energiespeicher, Steuerung, Regelung, Standardisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Dezentrale Energieversorgung
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der IT-Basis für dezentrale Energieversorgungssysteme. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Kommunikationsmechanismen und -techniken zur effizienten Steuerung und Regelung dezentraler Energieerzeugungsanlagen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Dezentrale Energieversorgung und deren Vorteile, Grundlagen des Energiemanagements in dezentralen Systemen, Kommunikationsarchitekturen für dezentrale Energieerzeuger, Steuerung und Regelung verschiedener Energieerzeugungsformen (Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung, Brennstoffzellen, Wasserkraft) und IT-Sicherheitsaspekte in dezentralen Energiesystemen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 führt in die dezentrale Energieversorgung und die Zielsetzung der Arbeit ein. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen des Energiemanagements, einschließlich verschiedener dezentraler Energieerzeugungsformen und Energiespeicher. Kapitel 3 analysiert die Kommunikationsarchitektur, -techniken und das Sicherheitsmanagement für dezentrale Energieerzeugungsanlagen, einschließlich der Steuerung und Regelung der einzelnen Technologien.
Welche Arten der dezentralen Energieerzeugung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Arten der dezentralen Energieerzeugung, darunter Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung (inkl. Blockheizkraftwerke und Brennstoffzellen) und Wasserkraft.
Welche Rolle spielt die Kommunikation in der dezentralen Energieversorgung?
Die Kommunikation spielt eine zentrale Rolle, da sie die effiziente Steuerung und Regelung der verschiedenen dezentralen Energieerzeugungsanlagen ermöglicht. Die Arbeit analysiert verschiedene Kommunikationsmedien, -techniken und -architekturen sowie das IT-Sicherheitsmanagement.
Welche Kommunikationstechniken werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Kommunikationsmedien und -techniken, die für die Interaktion zwischen den dezentralen Energieerzeugungsanlagen und dem übergeordneten System notwendig sind. Es wird auf die Architektur dieser Systeme, Schnittstellen, Standardisierung und IT-Sicherheit eingegangen.
Welche Sicherheitsaspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die IT-Sicherheitsaspekte im Kontext dezentraler Energiesysteme. Dies umfasst die Sicherung der Kommunikation und den Schutz vor Cyberangriffen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Dezentrale Energieversorgung, Energiemanagement, Kommunikationstechniken, IT-Sicherheit, Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung, Brennstoffzellen, Wasserkraft, Energiespeicher, Steuerung, Regelung, Standardisierung.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Kapitelzusammenfassungen im Inhaltsverzeichnis bieten eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kapitel und deren Inhalte. Die Arbeit selbst bietet eine ausführliche Analyse der jeweiligen Themen.
- Citar trabajo
- Tarek Habieb (Autor), 2004, IT Basiskomponenten für ein dezentrales Energieversorgungssystem, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32384