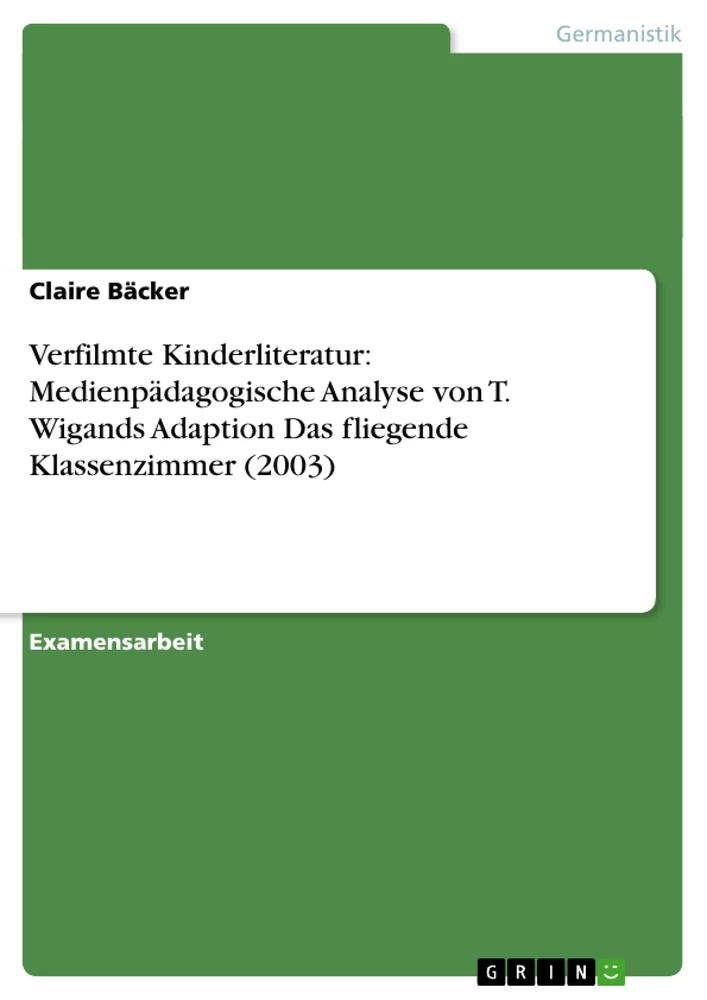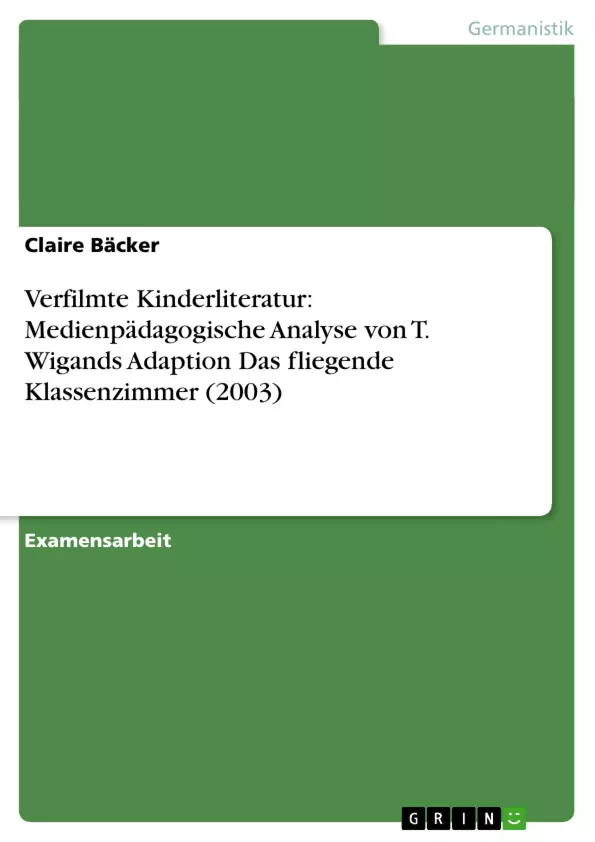Medien bestimmen unseren Alltag, unser Leben – und natürlich auch das der Kinder. Fernsehen, Video und Computer gehören ebenso dazu wie das Buch, die Zeitung oder die Zeitschrift. Hier ist vor allem der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) von Interesse, ihre besondere Wichtigkeit und herausgehobene Stellung ist unumstritten. Zum einen wird die Kinder- und Jugendliteratur als eine Art Sozialisationsmittel verstanden. Dabei sollen Kinder über Literatur dahingehend „erzogen“ werden, dass sie ihre eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten weiterentwickeln, indem sie an Erlebnissen, emotionalen Einstellungen und Erkenntnissen literarischer „Helden“ teilhaben und diese verarbeiten. Zum anderen wird Kinder- und Jugendliteratur als kindgemäße Literatur definiert. „Dazu gehört dann, dass solche Stoffe und Themen eine Rolle spielen, die jeweils aktuelle kindliche Bedürfnisse, Wünsche erfüllen: Spiel, Abenteuer, Tierfreundschaften, erste Liebe.“ Es gilt in diesem Bereich, die Freude und das Interesse der Schüler an Kinder- und Jugendliteratur zu bewahren bzw. zunächst zu wecken. „Kinder zum Lesen und zur Literatur hinzuführen gehört zu den zentralen Aufgaben des Deutschunterrichts. Angesichts einer sich rapide verändernden Medienumwelt steht die Schule heute vor einer schwer zu bewältigenden Aufgabe.“ Diese besteht darin, die Lesesozialisation von Kindern zu übernehmen, und das macht die Einbeziehung umfangreicher Texte, (insbesondere von Kinder- und Jugendliteratur) in den Grundschulunterricht erforderlich. Im häuslichen Bereich wie auch in der Schule hat sich mittlerweile allerdings ein spezielles Medium durchgesetzt, das die Kindheit in besonderer Weise begleitet: das Fernsehen. Es fasziniert durch eine Vielzahl von bewegten Bildern, eine Gleichzeitigkeit von Ereignis und Affekt, faszinierende Rasanz in der Präsentation und eine Vielzahl visueller Effekte.
Aufgrund dieser Tatsache stellt sich die Frage: Wie leitet man Kinder - in einer zunehmend visuell bestimmten Welt - zum richtigen Umgang mit solchen Bildern an?
Denn Bilder im Fernsehen erscheinen in besonderer Weise unmittelbar, sinnlich, überzeugend und wahr, aber sie können auch manipulieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zum Autor Erich Kästner
- 1.1 Über seine Kindheit
- 1.2 Über die Entstehung und die Entstehungszeit des Kinderromans „Das fliegende Klassenzimmer“
- 1.3 Weitere Werke
- 2. Der Film
- 2.1 Sequenzplan
- 2.2 Strukturelemente
- 2.2.1 Kameraführung
- 2.2.2 Filmische Erzählweise und Erzählerfunktion
- 2.2.3 Spannung
- 2.2.4 Sprache
- 2.2.5 Musik
- 2.3 Personen und Personenkonstellation
- 2.3.1 Kinder
- 2.3.2 Erwachsene
- 3. Buch und Film
- 3.1 Das Buch zum Film
- 3.2 Vergleich von Buch und Film (Buch - Film - Synopse)
- 3.2.1 Handlungsverlauf
- 4. Detailanalyse
- 4.1 Die Darstellung des Jonathan Trotz
- 4.1.1 Johnny als Erzähler: Sequenz 1.2 – 1.3
- 4.1.2 Johnny als Vertrauensperson: Sequenz 10.3
- 4.1.3 Johnny im Umgang mit Konflikten: Sequenz 11.0
- 4.1.4 Johnny als Freund: Sequenz 14.2
- 4.2 Abweichungen von der Romanvorlage
- 4.2.1 Johnny, der Neuankömmling: Sequenz 4.2
- 4.2.2 Monas Geburtstagsfeier: Sequenz 10.2 – 10.2.1
- 4.2.3 Justus und der Nichtraucher: Sequenz 11.3 – 11.3.1
- 4.2.4 „Das fliegende Klassenzimmer“: Sequenz 14.0
- 5. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Verfilmung des bekannten Kinderbuchs „Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich Kästner durch Thomas Wigand im Jahr 2003. Sie untersucht den Film aus medienpädagogischer Sicht, indem sie die literarische Vorlage mit der filmischen Adaption vergleicht und Schwerpunkte auf die Charakterisierung von Figuren und den Vergleich der Handlungsstränge legt.
- Verfilmung des Kinderbuchs „Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich Kästner
- Medienpädagogische Analyse der filmischen Adaption
- Vergleich der literarischen Vorlage mit der filmischen Adaption
- Charakterisierung der Figuren in Buch und Film
- Vergleich der Handlungsstränge in Buch und Film
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Kinder- und Jugendliteratur sowie den Einfluss von Medien auf die kindliche Entwicklung. Kapitel 1 gibt Einblicke in das Leben und Werk des Autors Erich Kästner und beleuchtet die Entstehung des Romans „Das fliegende Klassenzimmer“. Kapitel 2 widmet sich der filmischen Adaption, indem es den Sequenzplan, Strukturelemente wie Kameraführung und filmische Erzählweise, Spannungselemente, die Sprache des Films sowie die Musik analysiert. Außerdem werden die Personen und ihre Konstellation im Film detailliert betrachtet.
Kapitel 3 setzt sich mit dem Vergleich zwischen Buch und Film auseinander, wobei es auf die Handlungsstränge und die Unterschiede zwischen beiden Medienformen eingeht. Kapitel 4 analysiert die Darstellung der Figur des Jonathan Trotz im Film, untersucht verschiedene Sequenzen und zeigt Abweichungen von der Romanvorlage auf. Abschließend bietet Kapitel 5 eine zusammenfassende Betrachtung der Arbeit.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendliteratur, Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer, Filmanalyse, Medienpädagogik, Verfilmung, Thomas Wigand, Charakterisierung, Handlungsverlauf, Vergleich, Abweichungen, Spannung, Erzählweise, Kameraführung, Musik, Kinderfiguren, Erwachsene.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Verfilmung von Thomas Wigand veröffentlicht?
Die moderne Adaption von Erich Kästners Roman „Das fliegende Klassenzimmer“ kam im Jahr 2003 in die Kinos.
Was sind die zentralen medienpädagogischen Aspekte der Analyse?
Die Analyse untersucht, wie Kinder in einer visuell geprägten Welt zum kritischen Umgang mit Filmbildern angeleitet werden können und wie Literatur filmisch umgesetzt wird.
Wie unterscheidet sich der Film von der Buchvorlage?
Die Verfilmung von 2003 modernisiert den Stoff, passt die Sprache an die heutige Zeit an und verändert teilweise die Hintergrundgeschichten der Charaktere wie Jonathan Trotz.
Welche Rolle spielt Johnny (Jonathan Trotz) im Film?
Johnny fungiert im Film als Erzähler, Vertrauensperson und wichtiger Teil der Freundesgruppe, dessen persönliche Entwicklung im Fokus der Detailanalyse steht.
Warum ist die Einbeziehung von KJL-Verfilmungen im Unterricht sinnvoll?
Sie weckt das Interesse an Literatur, fördert die Lesesozialisation und ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen Text und Bildsprache.
- Citar trabajo
- Claire Bäcker (Autor), 2003, Verfilmte Kinderliteratur: Medienpädagogische Analyse von T. Wigands Adaption Das fliegende Klassenzimmer (2003), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32389