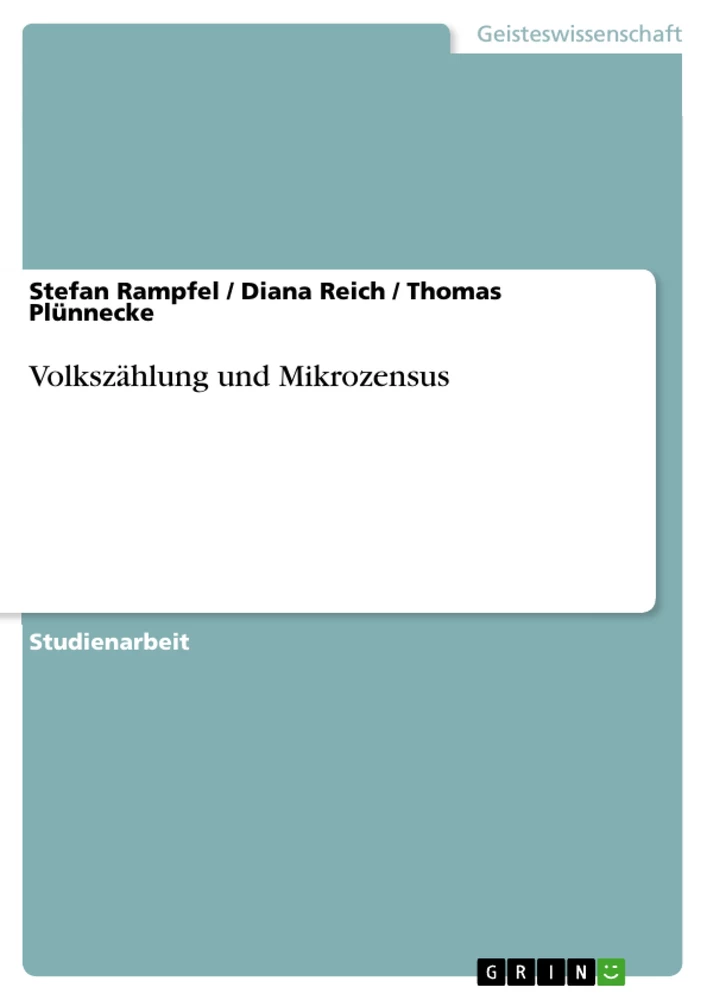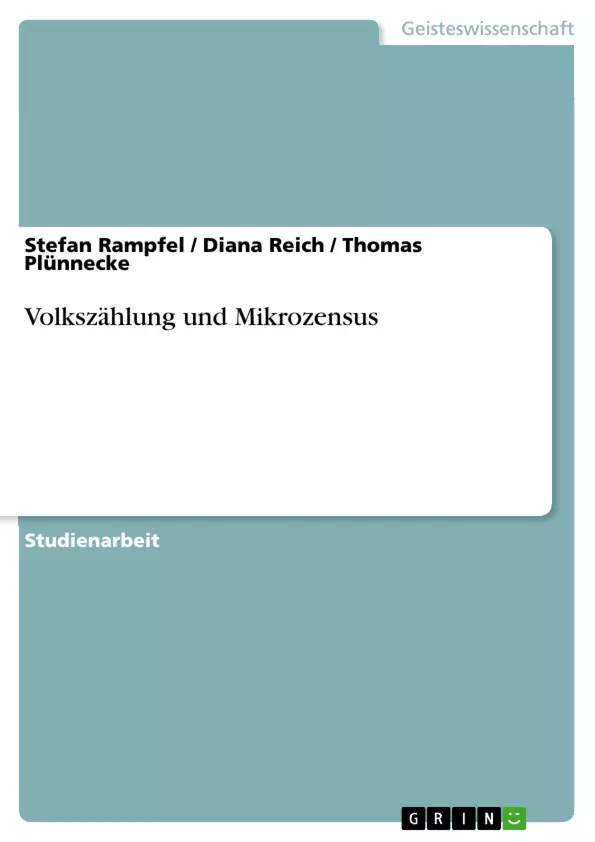Einleitung
Die systematische oder gezielte Datenerhebung der Bevölkerung ist keine neuzeitliche Errungenschaft. In verschiedenen Kulturen ist das Sammeln von Informationen über die Bevölkerung schon seit der Antike bekannt. Regelmäßige Volkszählungen fanden unter anderem im alten Ägypten oder dem Römischen Reich statt. Das bekannteste Beispiel ist die Bevölkerungserhebung zu Beginn der traditionellen Weihnachtsgeschichte. Für Maria und Josef ist sie Anlass, nach Palästina zu kommen. Im Jahre sieben vor Christus dienten die gewonnenen Daten nicht zu Zwecken der Sozialforschung. Sie waren administrativer Natur und sollten dem damaligen Kaiser Herodes Auskunft über die Zahl der Kriegstauglichen und Steuerzahler geben (Diekmann, 1999, Seite 78).
Bedeutung und Umfang sozioökonomischer Daten haben nicht zuletzt durch den rasanten Fortschritt im Technologiebereich kontinuierlich zugenommen. Heute beruhen wichtige Planungsentscheidungen des politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens auf den gesammelten Daten. So sind sie unter anderem maßgebend für die Verteilung der Steuern, wie wir im Verlauf unseres Referates noch aufzeigen werden. Dieses beschäftigt sich mit der Volkszählung und dem Mikrozensus. Im ersten Abschnitt des Referates zeichnen wir die Geschichte und Entwicklung der beiden Erhebungsinstrumente nach. Im anschließenden Themenkomplex wenden wir uns der Methode zu. Hierbei behandeln wir vor allem Vorgehensweise, Ablauf und Inhalte der Erhebungen. Obwohl der Focus unseres Referates auf den Instrumenten Volkszählung und Mikrozensus liegt, wenden wir uns aus Gründen der Vollständigkeit in einem weiteren Punkt der personenbezogenen Fortschreibung zu. Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der erhobenen Daten leiten einen weiteren Gliederungspunkt ein: die „pro-und-contra-Argumente“ der Volkszählung.
Die Debatte um das Für und Wider einer Volkszählung schlug vor allem im Vorfeld der für 1983 geplanten Erhebung hohe Wellen. Kontroverse Diskussionen und Verfassungsbeschwerden führten zum Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, das wir im Rahmen unseres Referates ebenfalls behandeln.
Ehe wir unsere Arbeit mit einem Fazit abschließen, geben wir noch einen Ausblick auf die für das Jahr 2001 geplante Volkszählung innerhalb der Europäischen Union. Ferner stellen wir im Schlussteil des Referates die Praxis des Erhebungsinstruments Volkszählung am Beispiel der Türkei und China auf.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Geschichte der Erhebungsinstrumente
- 2.1. Die Volkszählung
- 2.2. Der Mikrozensus
- 3. Methode
- 3.1. Die Volkszählung
- 3.2. Der Mikrozensus
- 3.3. Die Fortschreibung
- 4. Nutzen und Gründe der Erhebungen
- 4.1. Die Volkszählung
- 4.2. Der Mikrozensus
- 5. Mikrozensus versus Volkszählung
- 6. Das BverfG-Urteil
- 7. Die Volkszählung 2001
- 7.1. Allgemeines
- 7.2. Das Bundesmodell
- 7.3. Das Ländermodell
- 8. Aktuelle Volkszählungen im Ausland (Beispiele Türkei und China)
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit den Erhebungsinstrumenten Volkszählung und Mikrozensus und beleuchtet deren Geschichte, Methode, Nutzen und die Debatte um das Für und Wider einer Volkszählung. Ziel ist es, einen Überblick über diese wichtigen Instrumente der Sozialforschung zu geben und ihre Bedeutung für die Planung in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu verdeutlichen.
- Geschichte und Entwicklung der Volkszählung und des Mikrozensus
- Methoden und Inhalte der Erhebungen
- Die Bedeutung der Daten für politische und gesellschaftliche Entscheidungen
- Die Kontroverse um die Volkszählung und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
- Aktuelle Volkszählungen im internationalen Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beschreibt die historische Bedeutung der Datenerhebung für verschiedene Kulturen. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Volkszählung und des Mikrozensus in Deutschland, inklusive der Kontroversen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Kapitel 3 befasst sich mit der Methode der beiden Erhebungsinstrumente, inklusive der Vorgehensweise, dem Ablauf und den Inhalten der Erhebungen. Kapitel 4 behandelt die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der erhobenen Daten für politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entscheidungen. Kapitel 5 setzt sich mit den Vor- und Nachteilen der Volkszählung und des Mikrozensus auseinander. Kapitel 6 erläutert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung. Kapitel 7 gibt einen Ausblick auf die für das Jahr 2001 geplante Volkszählung innerhalb der Europäischen Union und stellt verschiedene Modelle vor. Kapitel 8 veranschaulicht die Praxis der Volkszählung am Beispiel der Türkei und China.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Referats sind Volkszählung, Mikrozensus, Datenerhebung, Sozialforschung, Bevölkerungserhebung, Methoden, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Datenschutz, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Planung, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer Volkszählung und einem Mikrozensus?
Die Volkszählung ist eine Vollerhebung der gesamten Bevölkerung, während der Mikrozensus eine repräsentative Stichprobe (meist 1%) der Haushalte befragt.
Warum sind diese Daten für den Staat so wichtig?
Die Daten dienen als Grundlage für Planungsentscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wie etwa die Verteilung von Steuergeldern oder die Planung von Infrastruktur.
Was besagt das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts?
Das Urteil von 1983 etablierte das Grundrecht auf "informationelle Selbstbestimmung" und setzte enge Grenzen für die staatliche Datenerhebung.
Seit wann gibt es Volkszählungen?
Datenerhebungen sind bereits aus der Antike bekannt, etwa aus dem alten Ägypten oder dem Römischen Reich, damals oft zu Zwecken der Steuererhebung oder Wehrfähigkeit.
Wie wird die Bevölkerung zwischen den Zählungen ermittelt?
Dies geschieht durch die sogenannte "personenbezogene Fortschreibung", bei der Geburten, Sterbefälle und Umzüge statistisch erfasst werden.
- Quote paper
- Stefan Rampfel (Author), Diana Reich (Author), Thomas Plünnecke (Author), 2001, Volkszählung und Mikrozensus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3239