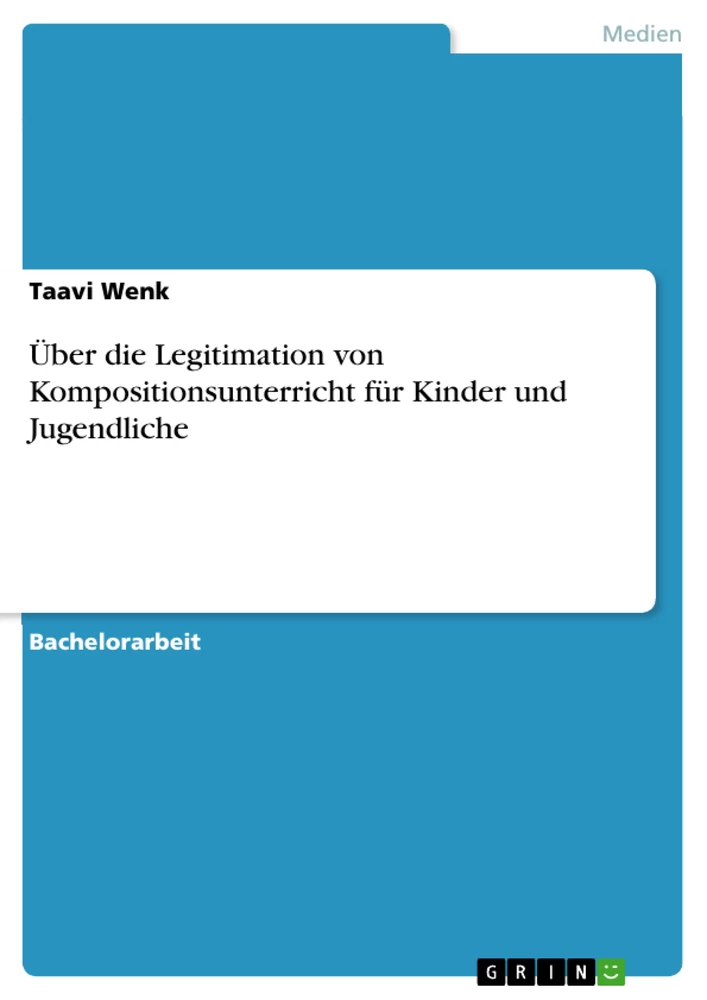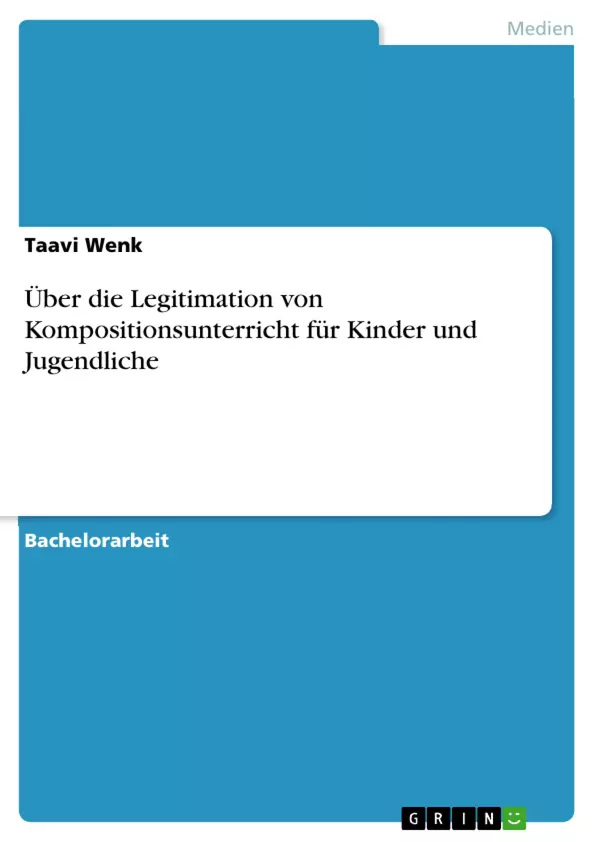Während es sich in der systematischen Musikwissenschaft etabliert hat, dass die musikalische Kreativität als allgemein menschliche Fähigkeit angesehen werden kann, ist es häufig nicht Teil des eigenen Persönlichkeitskonzeptes.
Auch anhand der enormen Anzahl an Autoren, die sich für Kompositionsunterricht aussprechen, lässt sich ableiten, dass der Glaube an die generativen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen doch vorhanden ist. Dennoch liegt die Annahme, jeder verfüge über eine gewisse musikalisch-kreative Begabung und habe das Potential zum Komponieren eines eigenen Werkes, vielen Menschen fern.
Dabei kann aber die nur wenig stattfindende Förderung von produktiv-musikalischen Fähigkeiten in Form von Kompositionsunterricht zu dem fehlenden Glauben an die eigene Kreativität führen, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass die generativ-musikalischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen in der Musikpädagogik an Musikschulen, allgemeinbildenden Schulen, Hochschulen und sonstigen musikpädagogischen Anwendungsbereichen zu wenig beachtet wird.
Somit stellt sich die Frage nach der Relevanz von Kompositionsunterricht. Auch ist zu fragen, ob nicht der Kompositionsunterricht eine aktiveres, tieferes und mit mehr Spaß verbundenes Lernen ermöglicht, welches darüber hinaus zu besseren musikalischen Lernergebnissen führt. Es lassen sich weiterhin mehrere außermusikalische Faktoren nennen, welche dem Kompositionsunterricht Legitimation zukommen lassen. Hierzu zählt die durch das Ausleben der Kreativität mögliche voranschreitende Persönlichkeits- und Sozialkompetenzentwicklung.
Daher lautet die These dieser Arbeit, dass der Kompositionsunterricht einen wertvollen Teil der Musikpädagogik einnehmen sollte und bisher zu wenig Beachtung findet. Im Gegensatz zum einseitig, auf Reproduktion konzentriertem Musikunterricht, sollte der Kompositionsunterricht stärker in der Musikpädagogik an Hochschulen, Musikschulen, Musikprojekten, sowie an allgemeinbildenden Schulen gefördert werden. Welche Vorteile der Kompositionsunterricht im Einzelnen hat, soll daher neben der Darstellung der aktuellen Situation des Kompositionsunterrichtes in Deutschland erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Ansätze zur musikalischen Kreativität
- 2.1. Allgemein psychologische Grundlagen zur musikalischen Kreativität
- 2.2. Abgrenzung: Improvisation und Komposition
- 2.3. Entwicklung der musikalischen Kreativität
- 2.4. Kreativer Prozess
- 2.5. Bedeutung von sozialem Umfeld, Kultur und Domäne
- 2.6. Persönlichkeit des kreativen Künstlers
- 3. Aktuelle Situation in Deutschland
- 3.1. Kompositionsunterricht an Musikschulen
- 3.2. Kompositionsunterricht an Hochschulen
- 3.3. Kompositionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen
- 3.4. Kompositionsprojekte, -klassen und -wettbewerbe
- 3.5. Zusammenfassung
- 4. Über die Legitimation von Kompositionsunterricht
- 4.1. Allgemeinpädagogische und individualpsychologische Aspekte
- 4.1.1 Pädagogische Aspekte
- 4.1.2. Persönlichkeitsbildung
- 4.2. Musikpädagogische Aspekte
- 4.2.1. Musikalische Bildung
- 4.2.2. Rezeptionsbereitschaft und ästhetische Bildung
- 4.2.3. Kritische Aspekte und Diskussion
- 4.3. Der Aspekt des sozialen Lernens
- 4.4. Kulturpolitische Aspekte
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimation von Kompositionsunterricht für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, die Vorteile von Kompositionsunterricht im Kontext der Musikpädagogik darzustellen und dessen bisherige Unterrepräsentation zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen der musikalischen Kreativität und analysiert die aktuelle Situation des Kompositionsunterrichts in Deutschland.
- Theoretische Grundlagen musikalischer Kreativität
- Aktuelle Situation des Kompositionsunterrichts in Deutschland
- Allgemeinpädagogische und individualpsychologische Aspekte des Kompositionsunterrichts
- Musikpädagogische Aspekte des Kompositionsunterrichts
- Soziale und kulturpolitische Relevanz des Kompositionsunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass Kompositionsunterricht einen wertvollen, aber bisher zu wenig beachteten Teil der Musikpädagogik darstellt. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen der wissenschaftlichen Anerkennung musikalischer Kreativität als allgemeinmenschlicher Fähigkeit und dem verbreiteten Mangel an Glauben an die eigenen kompositorischen Fähigkeiten. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zu behandelnden Aspekte, wie die theoretischen Grundlagen der musikalischen Kreativität und die aktuelle Situation des Kompositionsunterrichts in Deutschland.
2. Theoretische Ansätze zur musikalischen Kreativität: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene theoretische Ansätze zur musikalischen Kreativität. Es werden allgemein psychologische Grundlagen, die Abgrenzung von Improvisation und Komposition, der kreative Prozess, die Entwicklung musikalischer Kreativität, die „Künstlerpersönlichkeit“ sowie die Bedeutung des sozialen Umfelds, der Gesellschaft und der Kultur behandelt. Das Kapitel dient als theoretische Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit der Legitimation von Kompositionsunterricht.
3. Aktuelle Situation in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Situation des Kompositionsunterrichts in verschiedenen Kontexten in Deutschland, darunter Musikschulen, Hochschulen und allgemeinbildende Schulen. Es betrachtet auch Kompositionsprojekte, -klassen und -wettbewerbe. Die Zusammenfassung dieses Kapitels wird einen Überblick über die Verbreitung und den Umfang des Kompositionsunterrichts in Deutschland liefern, um den Bedarf an weiterer Förderung zu belegen.
4. Über die Legitimation von Kompositionsunterricht: Dieses Kapitel widmet sich der zentralen Fragestellung der Arbeit: der Legitimation von Kompositionsunterricht. Es werden allgemein-pädagogische und individualpsychologische Aspekte (insbesondere Persönlichkeitsbildung) sowie musikpädagogische Aspekte (musikalische Bildung, Rezeptionsbereitschaft und ästhetische Bildung) diskutiert. Kritische Aspekte und Diskussionen werden ebenfalls einbezogen. Zusätzlich werden der Aspekt des sozialen Lernens und kulturpolitische Implikationen beleuchtet. Dieses Kapitel synthetisiert die vorherigen Kapitel und liefert Argumente für die verstärkte Förderung von Kompositionsunterricht.
Schlüsselwörter
Kompositionsunterricht, musikalische Kreativität, Musikpädagogik, Persönlichkeitsbildung, ästhetische Bildung, soziales Lernen, Deutschland, Musikschulen, Hochschulen, allgemeinbildende Schulen, Kreativprozess, Improvisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Legitimation von Kompositionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Legitimation von Kompositionsunterricht für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Sie beleuchtet die Vorteile des Kompositionsunterrichts im Kontext der Musikpädagogik und analysiert dessen bisherige Unterrepräsentation.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt theoretische Grundlagen der musikalischen Kreativität, die aktuelle Situation des Kompositionsunterrichts in Deutschland (an Musikschulen, Hochschulen und allgemeinbildenden Schulen), allgemein- und individualpsychologische Aspekte (Persönlichkeitsbildung), musikpädagogische Aspekte (musikalische Bildung, Rezeptionsbereitschaft, ästhetische Bildung), soziale Aspekte und kulturpolitische Implikationen des Kompositionsunterrichts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Theoretische Ansätze zur musikalischen Kreativität, 3. Aktuelle Situation in Deutschland, 4. Über die Legitimation von Kompositionsunterricht, 5. Zusammenfassung und Ausblick.
Welche theoretischen Ansätze zur musikalischen Kreativität werden behandelt?
Kapitel 2 behandelt allgemeinpsychologische Grundlagen, die Abgrenzung von Improvisation und Komposition, die Entwicklung musikalischer Kreativität, den kreativen Prozess, die Bedeutung des sozialen Umfelds, der Kultur und die Persönlichkeit des kreativen Künstlers.
Wie wird die aktuelle Situation des Kompositionsunterrichts in Deutschland dargestellt?
Kapitel 3 analysiert den Kompositionsunterricht an Musikschulen, Hochschulen und allgemeinbildenden Schulen sowie Kompositionsprojekte, -klassen und -wettbewerbe in Deutschland. Es liefert einen Überblick über Verbreitung und Umfang des Kompositionsunterrichts.
Welche Argumente werden für die Legitimation von Kompositionsunterricht angeführt?
Kapitel 4 argumentiert für die Legitimation von Kompositionsunterricht aus allgemein- und individualpsychologischen Perspektiven (z.B. Persönlichkeitsbildung), musikpädagogischen Perspektiven (musikalische Bildung, Rezeptionsbereitschaft, ästhetische Bildung), sowie unter Berücksichtigung sozialer Lernaspekte und kulturpolitischer Implikationen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kompositionsunterricht, musikalische Kreativität, Musikpädagogik, Persönlichkeitsbildung, ästhetische Bildung, soziales Lernen, Deutschland, Musikschulen, Hochschulen, allgemeinbildende Schulen, Kreativprozess, Improvisation.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, die Vorteile von Kompositionsunterricht im Kontext der Musikpädagogik darzustellen und dessen bisherige Unterrepräsentation zu beleuchten, um dessen verstärkte Förderung zu rechtfertigen.
- Quote paper
- Taavi Wenk (Author), 2015, Über die Legitimation von Kompositionsunterricht für Kinder und Jugendliche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323934