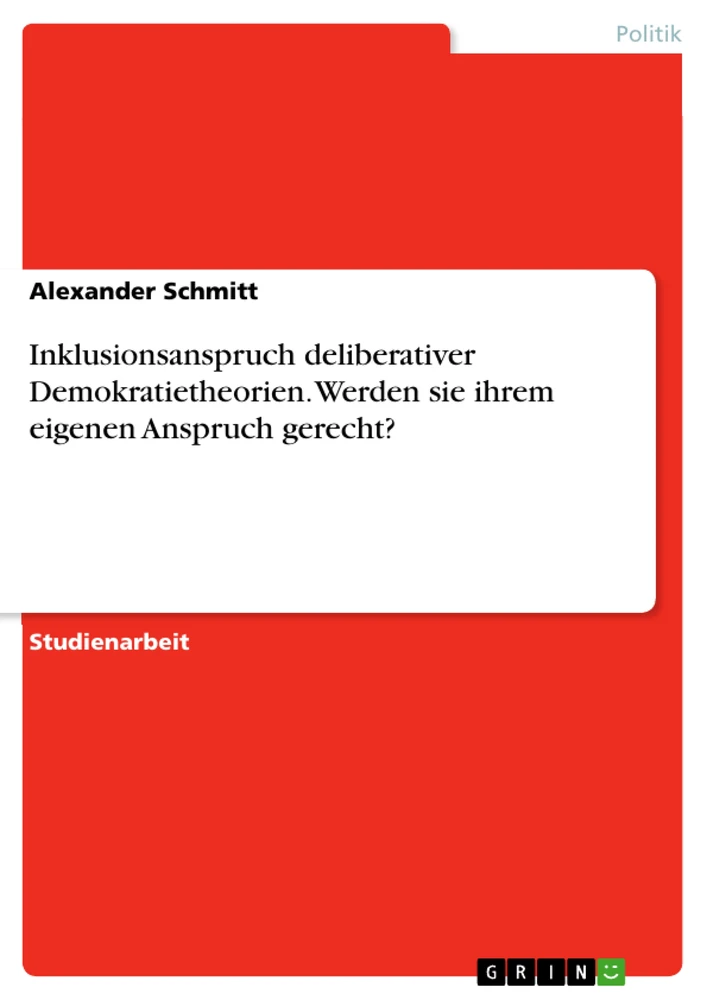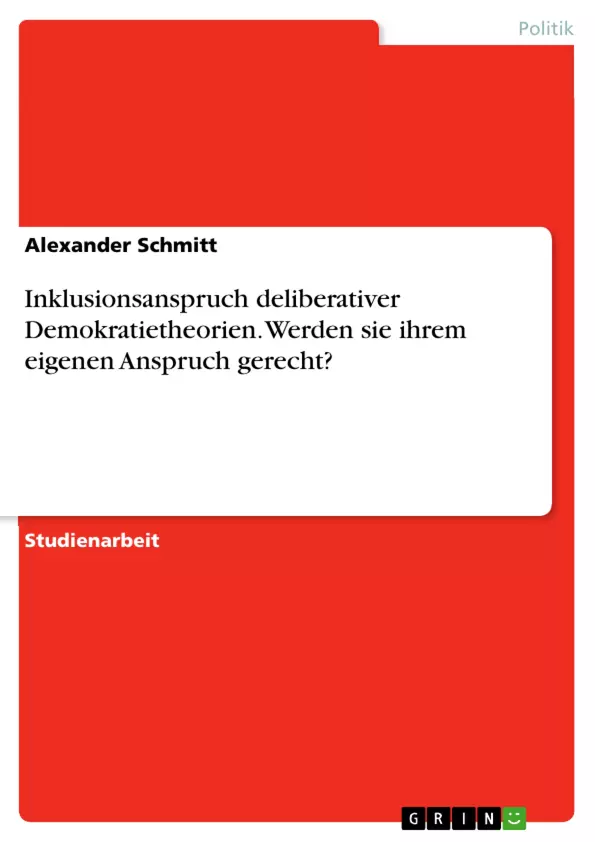Deliberative Demokratietheorien postulieren ein Höchstmaß an Inklusion bzgl. des Inputprozesses politischer Programmentwicklungen und einen konsensorientierten Output. Doch werden Sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht? Diese Frage steht im Fokus der vorliegenden Seminararbeit.
Zuerst werde ich Grundzüge deliberativer Demokratietheorien allgemein darstellen und vor allem auf den Begriff der Repräsentation in deliberativen Demokratietheorien eingehen.
Im zweiten Punkt erläutere ich das Modell deliberativer Politik nach Jürgen Habermas, der als Hauptvertreter eines prozeduralistischen Demokratieverständnisses gilt, welches Volkssouveränität substanziell entkoppelt vom Vorhandensein eines materiell greifbaren oder symbolisch repräsentierten Subjekts (wie z.B. Nation oder Volk) und „verflüssigt“, das heißt auf die „höherstufige Intersubjektivität von Verständigungsprozessen“ überträgt (vgl. Habermas 1992).
Auf den Begriff der deliberativen Politik werde ich eingehen, elementare Grundzüge des Modells von Jürgen Habermas vorstellen und dann die Volkssouveränität als prozeduralistisch zu verstehende in den Blick nehmen.
Anschließend gehe ich auf die Kritik von Winfried Thaa am Projekt der Kognitivierung und Informalisierung politischer Meinungs- und Willensbildung ein. Dieses führt in letzter Konsequenz dazu, dass aus Sicht Thaas das Verständnis politischer Repräsentation sich zuungunsten einer inklusionstheoretisch-adäquaten hin zu einer den politischen Raum schließenden und damit neue Exklusionsmechanismen nach sich ziehenden Praxis verschiebe, was demokratietheoretisch hinsichtlich des eigenen Einschließungsanspruches dieser deliberativen Theorien höchst problematisch sei.
Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt darauf, inwieweit deliberative Demokratietheorien, hier exemplarisch vertreten durch den diskurstheoretisch rekonstruierten Ansatz politischer Deliberation durch Habermas, ihrem ureigenen Inklusionsanspruch gerecht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Inklusionsanspruch deliberativer Demokratietheorien
- Grundzüge deliberativer Demokratietheorien
- Der Begriff der Repräsentation in deliberativen Demokratiemodellen
- Das Modell deliberativer Politik nach Habermas
- Der Begriff der deliberativen Politik
- Grundzüge des Habermasschen Modells
- Kritik von Winfried Thaa
- Die normativen Versprechungen deliberativer Demokratietheorien
- Reformulierung des Rousseau- Projektes
- Unterschied Differenz- und Einheitsrepräsentation
- Das Repräsentationsprinzip und seine deliberative Umdeutung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Inklusionsansprüche deliberativer Demokratietheorien und untersucht, ob diese ihrem eigenen Anspruch gerecht werden. Sie beleuchtet die Kernprinzipien dieser Theorien und untersucht, wie der Begriff der Repräsentation innerhalb dieser Modelle verstanden wird.
- Grundzüge deliberativer Demokratietheorien und deren Abgrenzung zu anderen Demokratiemodellen
- Der Begriff der Repräsentation im Kontext deliberativer Demokratietheorien
- Das Modell deliberativer Politik nach Jürgen Habermas und dessen prozedurales Verständnis von Volkssouveränität
- Die Kritik von Winfried Thaa an den normativen Versprechungen und der möglichen Exklusion in deliberativen Demokratietheorien
- Die Frage, ob deliberative Demokratietheorien tatsächlich Inklusion gewährleisten oder neue Exklusionsmechanismen schaffen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der deliberativen Demokratietheorien und deren Inklusionsansprüche ein. Sie erläutert den Wandel von partizipatorischen hin zu deliberativen Theorien und beschreibt die zentrale Rolle des besseren Arguments in deliberativen Entscheidungsfindungen. Der Fokus liegt auf der Inklusion aller potenziell Betroffenen im Entscheidungsprozess.
Kapitel 2 präsentiert die Grundzüge deliberativer Demokratietheorien und untersucht den Begriff der Repräsentation in diesem Kontext. Es wird deutlich, dass Repräsentation nicht nur in formalen Institutionen, sondern auch in informellen Gremien stattfinden kann.
Kapitel 3 beleuchtet das Modell der deliberativen Politik nach Jürgen Habermas. Es werden die Grundzüge seines Modells, insbesondere das prozedurale Verständnis von Volkssouveränität, erläutert.
Kapitel 4 widmet sich der Kritik von Winfried Thaa an deliberativen Demokratietheorien. Thaa argumentiert, dass die Fokussierung auf Rationalität zu einer Verdrängung der Bürgerbeteiligung und zu neuen Exklusionsmechanismen führen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie deliberative Demokratietheorien, Inklusion, Repräsentation, prozedurales Demokratieverständnis, Jürgen Habermas, Winfried Thaa, Kognitivierung, Informalisierung und Exklusionsmechanismen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel deliberativer Demokratietheorien?
Sie streben ein Höchstmaß an Inklusion und eine politische Willensbildung an, die auf dem „besseren Argument“ und Konsens basiert.
Wie versteht Jürgen Habermas Volkssouveränität?
Habermas entkoppelt Volkssouveränität von einem konkreten Subjekt (wie „dem Volk“) und verlagert sie in die Intersubjektivität von Verständigungsprozessen.
Was kritisiert Winfried Thaa an diesem Modell?
Thaa warnt vor einer „Kognitivierung“ der Politik, die neue Exklusionsmechanismen schafft und den politischen Raum für Bürger ohne Expertenwissen schließen könnte.
Werden deliberative Theorien ihrem Inklusionsanspruch gerecht?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die informelle und diskursive Willensbildung tatsächlich alle Betroffenen einschließt oder eher elitäre Züge trägt.
Was bedeutet Repräsentation im deliberativen Kontext?
Repräsentation wird hier nicht nur formal-institutionell, sondern auch als diskursive Vertretung von Interessen in der Öffentlichkeit verstanden.
- Quote paper
- Alexander Schmitt (Author), 2013, Inklusionsanspruch deliberativer Demokratietheorien. Werden sie ihrem eigenen Anspruch gerecht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324017