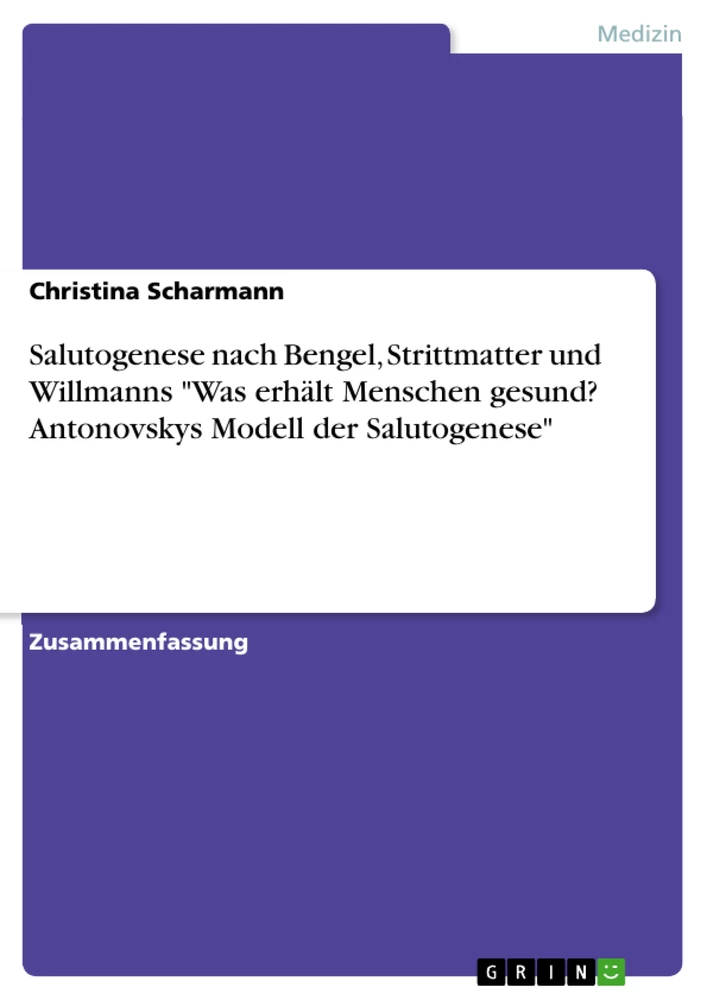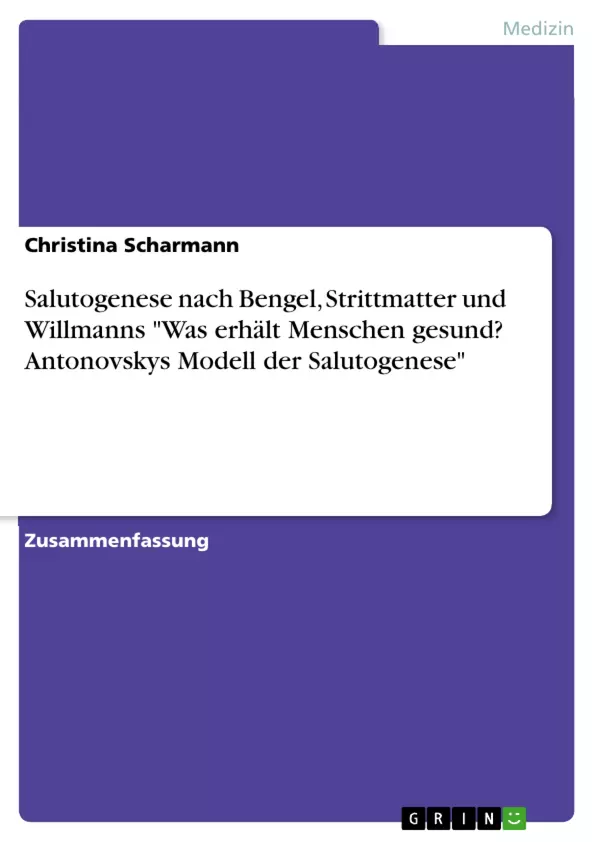Das Konzept der Salutogenese nach dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923-1994) kritisiert die rein pathogenetisch- kurative Betrachtungsweise, die Frage nach den Ursachen von Krankheiten und Risikofaktoren. Demgegenüber stellt Antonovsky in seinem Konzept der Salutogenese die Frage nach den Bedingungen von Gesundheit und nach den Faktoren, die Gesundheit schützen, in den Vordergrund. Die Frage, warum Menschen gesund bleiben, die Wirkfaktoren für die Erhaltung von Gesundheit, gewinnt hier an zentraler Bedeutung. Warum bleiben eigentlich Menschen gesund trotz vieler gesundheitsgefährdender Einflüsse, wie schaffen sie es, sich wieder zu erholen von Erkrankungen und warum werden Menschen, die extremen Belastungen unterworfen sind, gar nicht krank?
Hinzuzufügen ist, dass das Konzept der Salutogenese nicht als Gegenteil der Pathogenese, also die Beschäftigung mit der Entstehung und Behandlung von Krankheiten, zu verstehen ist, sondern es gilt nach Antonovsky, alle Menschen als mehr oder weniger gesund und mehr oder weniger krank zu betrachten. Diesbezüglich steht die zentrale Frage im Vordergrund, wie ein Mensch mehr gesund und weniger krank wird. Diese Denkweise Antonovskys lässt sich besonders gut metaphorisch darstellen. Während die pathogenetische Blickweise Menschen aus einem reißenden Fluss retten will, ohne darüber nachzudenken, wie diese Menschen in den Fluss hineingeraten sind und warum sie nicht besser schwimmen können, hebt die salutogenetische Sichtweise die Frage hervor, wie man in diesem Fluss als Strom des Lebens ein guter Schwimmer wird.
Inhaltsverzeichnis
- Das Konzept der Salutogenese
- Die salutogenetische Fragestellung
- Das Kohärenzgefühl
- Stressoren und Spannungszustand
- Generalisierte Widerstandsressourcen
- Kohärenzgefühl im Vergleich mit verwandten Konzepten
- Gesundheitliche Kontrollüberzeugungen
- Dispositioneller Optimismus
- Stellenwert und Nutzung des Konzepts
- Salutogenese in der Gesundheitsförderung und Prävention
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Modell der Salutogenese, entwickelt vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky. Im Zentrum steht die Frage, welche Faktoren dazu beitragen, dass Menschen trotz gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund bleiben und sich von Erkrankungen erholen. Das Konzept der Salutogenese stellt die traditionelle, rein pathogenetische Betrachtungsweise von Krankheiten in Frage und rückt die Bedingungen für Gesundheit und die Faktoren, die Gesundheit schützen, in den Vordergrund.
- Das Konzept der Salutogenese und seine Kritik an der rein pathogenetischen Sichtweise
- Das Kohärenzgefühl als Kernstück des salutogenetischen Modells und seine drei Komponenten
- Der Vergleich des Kohärenzgefühls mit verwandten Konzepten wie gesundheitlichen Kontrollüberzeugungen und dispositionellem Optimismus
- Der Stellenwert und die Nutzung des Konzepts der Salutogenese in der Gesundheitsförderung und Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Konzept der Salutogenese
Dieses Kapitel stellt das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky vor und beleuchtet die salutogenetische Fragestellung. Es wird erläutert, wie Antonovsky die rein pathogenetisch-kurative Betrachtungsweise von Krankheiten kritisiert und stattdessen die Frage nach den Bedingungen von Gesundheit und den Faktoren, die Gesundheit schützen, in den Vordergrund stellt.
1.2 Das Kohärenzgefühl
Der Abschnitt behandelt das Kohärenzgefühl als Kernstück des salutogenetischen Modells. Es wird erklärt, wie das Kohärenzgefühl als Grundhaltung verstanden werden kann, die beschreibt, wie gut Menschen in der Lage sind, vorhandene Ressourcen zum Erhalt ihres Wohlbefindens und ihrer Gesundheit zu nutzen. Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls werden vorgestellt und erläutert.
2. Kohärenzgefühl im Vergleich mit verwandten Konzepten
Dieses Kapitel vergleicht das Kohärenzgefühl mit verwandten Konzepten wie gesundheitlichen Kontrollüberzeugungen und dispositionellem Optimismus. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Konzepten herausgestellt und ihre Relevanz für das Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden diskutiert.
3. Stellenwert und Nutzung des Konzepts
Der letzte Abschnitt befasst sich mit dem Stellenwert und der Nutzung des Konzepts der Salutogenese in der Gesundheitsförderung und Prävention. Es wird gezeigt, wie das salutogenetische Modell in der Praxis angewendet werden kann, um Gesundheitsförderungsprogramme zu entwickeln und die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
Schlüsselwörter
Salutogenese, Kohärenzgefühl, Gesundheit, Krankheit, Antonovsky, Pathogenese, Gesundheitsförderung, Prävention, Ressourcen, Stressoren, Kontrollüberzeugungen, Optimismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der Salutogenese?
Es ist ein von Aaron Antonovsky entwickeltes Modell, das nicht nach den Ursachen von Krankheiten fragt (Pathogenese), sondern danach, was Menschen gesund erhält.
Was bedeutet "Kohärenzgefühl"?
Das Kohärenzgefühl (Sense of Coherence) ist eine Grundhaltung, die das Leben als verstehbar, handhabbar und bedeutsam ansieht. Es ist der Kern der Salutogenese.
Was sind generalisierte Widerstandsressourcen?
Das sind Faktoren wie soziale Unterstützung, finanzielle Mittel, Wissen oder ein stabiles Selbstwertgefühl, die helfen, Spannungszustände erfolgreich zu bewältigen.
Wie unterscheidet sich Salutogenese von Pathogenese?
Pathogenese will Menschen aus dem "reißenden Fluss" (Krankheit) retten; Salutogenese will sie zu "guten Schwimmern" machen, damit sie im Strom des Lebens gesund bleiben.
Wo wird das Modell der Salutogenese angewendet?
Es findet breite Anwendung in der Gesundheitsförderung, Prävention und Psychotherapie, um die individuellen Ressourcen der Menschen zu stärken.
- Citar trabajo
- Christina Scharmann (Autor), 2008, Salutogenese nach Bengel, Strittmatter und Willmanns "Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324148