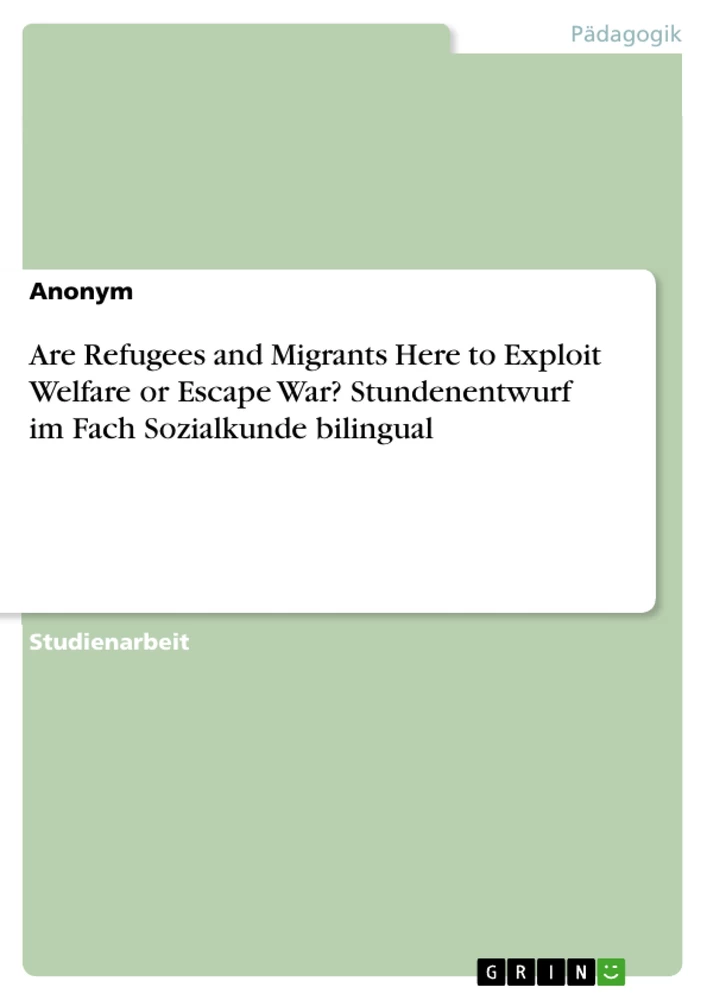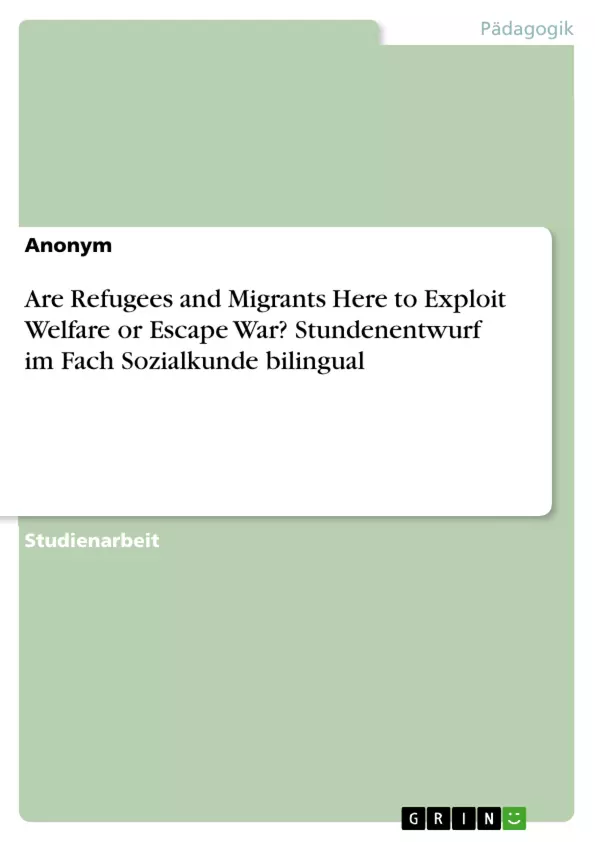Dieser Text ist ein vollständiger Unterrichtsentwurf zum Thema "Warum verlassen Menschen Ihre Heimat und entscheiden sich, in ein anderes Land zu fliehen/zu gehen". In der Stunde soll aufgezeigt werden, dass die Gründe hierfür unterschiedlich sind, da manche beispielsweise vor Krieg und Verfolgung fliehen, während andere die schlechten Lebensstandards im Heimatland hinter sich lassen wollen.
Der Text ist in folgende Teile gegliedert:
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse mit didaktischer Perspektive, methodischer und didaktischer Begründung und
- Kompetenzbeschreibung
- Stundenverlaufsplan
- Reflexion der Stunde nach dem Unterrichten an einer Schule
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Begriffserklärungen
- Flüchtling
- Migrant
- Aufnahmeland
- Wohlfahrt
- Gesetzliche Regelungen zum Asyl
- Motive und Erwartungen der Flüchtlinge und Migranten
- Reiseerfahrungen der Flüchtlinge und Migranten
- Überblick über die öffentliche Diskussion um Flüchtlinge und Migranten
- Umgang der Aufnahmeländer mit Flüchtlingen und Migranten
- Didaktische Analyse
- Didaktische Perspektive
- Bedingungsfelderanalyse
- Lehrplanbezug
- Überblick über den Verlauf der Einheit
- Didaktische Begründung
- Methodische Begründung
- Kompetenzen
- Fachkompetenz
- Kommunikationskompetenz
- Methodenkompetenz
- Urteilskompetenz
- Stundenplanung
- Reflexion
- Reflexion von A
- Reflexion von B
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf im Fach Sozialkunde bilingual befasst sich mit dem Thema der Flucht und Migration. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern ein tieferes Verständnis für die komplexen Ursachen und Folgen der Flüchtlingskrise zu vermitteln. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven von Flüchtlingen, Migranten und Aufnahmegesellschaften beleuchtet.
- Definitionen und gesetzliche Rahmenbedingungen von Flucht und Migration
- Motive und Erwartungen von Flüchtlingen und Migranten
- Herausforderungen der Integration und des Zusammenlebens in Aufnahmegesellschaften
- Die Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung im Kontext der Flüchtlingskrise
- Die Bedeutung von interkulturellem Verständnis und Toleranz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Sachanalyse beleuchtet zunächst die Begrifflichkeiten von Flüchtlingen, Migranten, Aufnahmeland und Wohlfahrt. Es werden die rechtlichen Grundlagen des Asylrechts in Deutschland und Europa erläutert, sowie die Motive und Erwartungen von Menschen, die ihr Heimatland verlassen. Die didaktische Analyse befasst sich mit der Unterrichtsplanung, dem Lehrplanbezug, den methodischen und didaktischen Begründungen, sowie den Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler durch den Unterricht erwerben sollen. Im Anschluss an die Stundenplanung werden Reflexionen von A und B zum Unterricht dargestellt.
Schlüsselwörter
Flüchtlingskrise, Migration, Asyl, Integration, Interkulturelles Verständnis, Aufnahmeland, Wohlfahrt, Sozialkunde, bilingualer Unterricht, Medien, öffentliche Meinung, Toleranz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem Migranten?
Flüchtlinge verlassen ihre Heimat meist aufgrund von Krieg oder Verfolgung, während Migranten oft aus wirtschaftlichen Gründen oder zur Verbesserung ihres Lebensstandards in ein anderes Land ziehen.
Welche Motive haben Menschen, ihre Heimat zu verlassen?
Die Gründe sind vielfältig: Sie reichen von der Flucht vor Gewalt und politischer Verfolgung bis hin zur Suche nach besseren Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten.
Wie sind die gesetzlichen Regelungen zum Asyl in Deutschland?
Der Unterrichtsentwurf beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und das Asylrecht, die den Umgang mit Schutzsuchenden in Aufnahmeländern regeln.
Welche Kompetenzen sollen Schüler in dieser Sozialkundestunde erwerben?
Gefördert werden Fach-, Kommunikations-, Methoden- und Urteilskompetenz im Kontext von Flucht, Migration und interkulturellem Verständnis.
Wie wird das Thema in einem bilingualen Unterricht behandelt?
Das Thema wird in englischer Sprache (bilingual) aufbereitet, um sowohl fachliche Inhalte als auch die fremdsprachliche Ausdrucksfähigkeit zu schulen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Are Refugees and Migrants Here to Exploit Welfare or Escape War? Stundenentwurf im Fach Sozialkunde bilingual, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324246