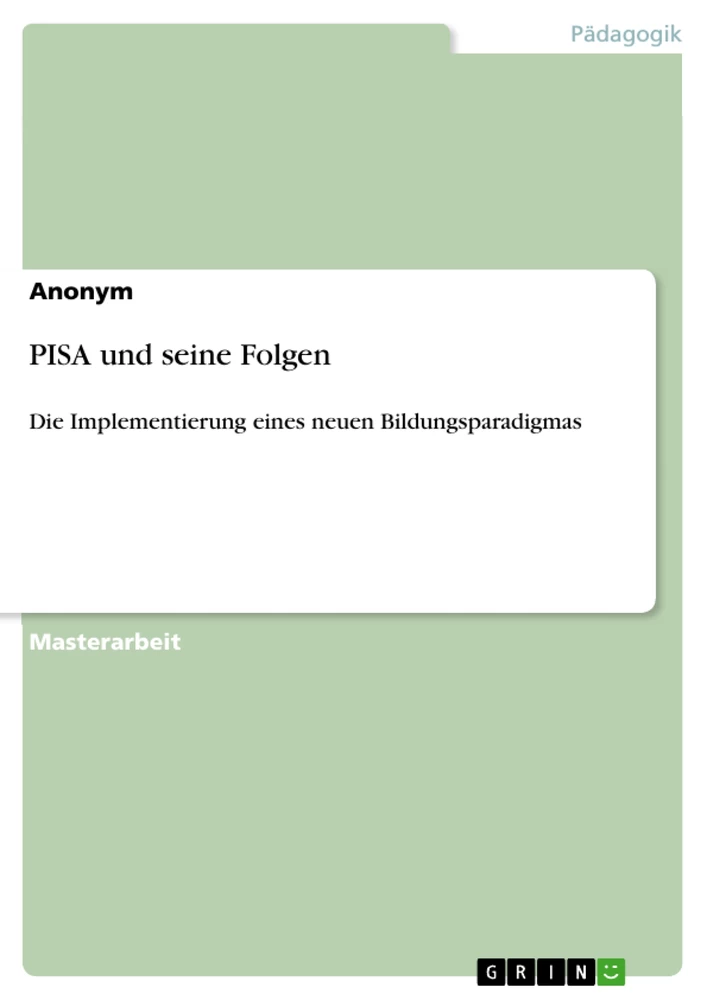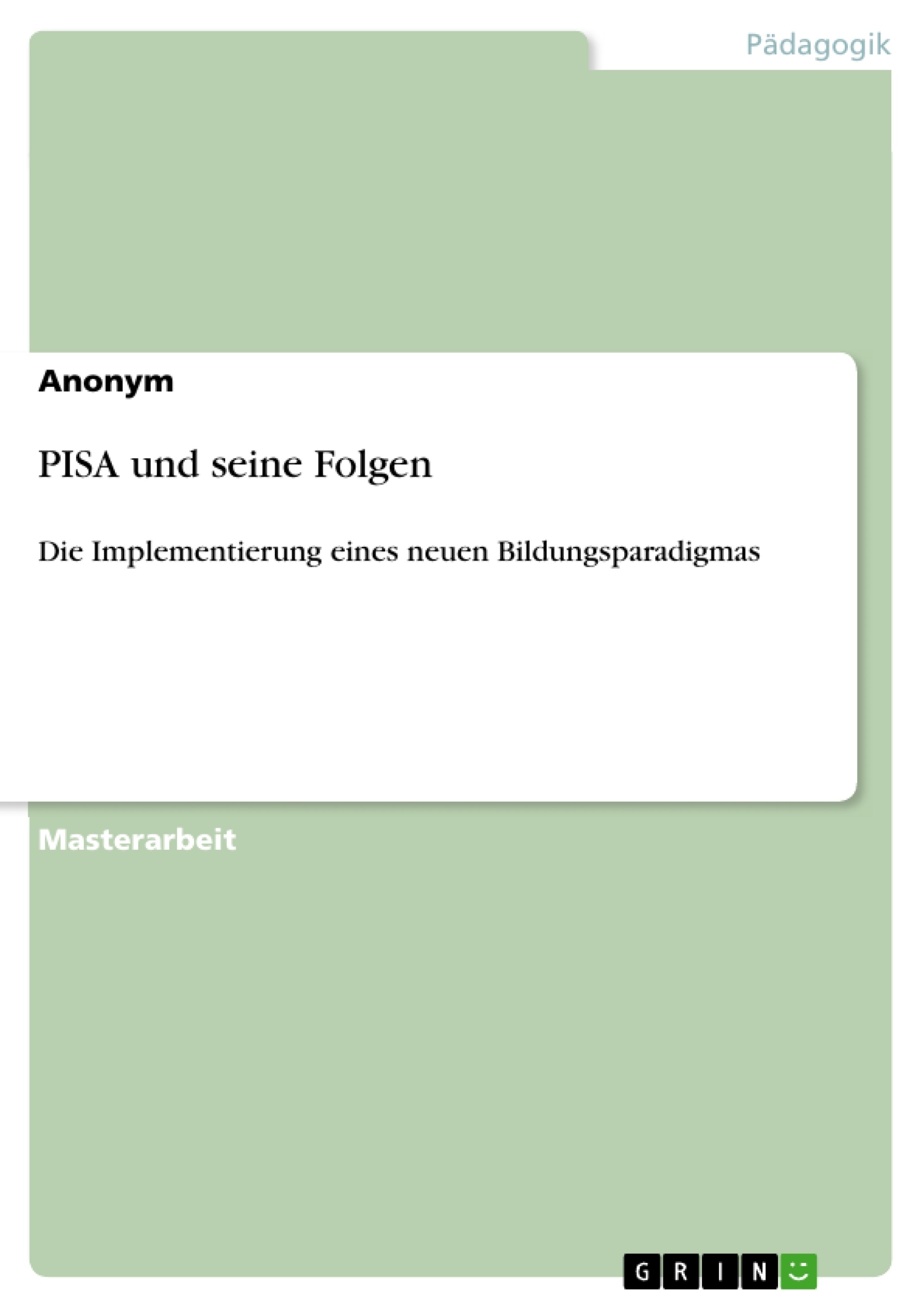Betrachtet man das deutsche Bildungssystem und dessen Veränderungen in den letzten Jahren, markiert der mediale Aufschrei Anfang der 2010er Jahre, der der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Erhebung (Programme for international Student Assessment) aus dem Jahr 2001 folgte, durchaus einen bedeutenden Wendepunkt in der modernen Bildungsgeschichte. Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler und Schülerinnen im internationalen Vergleich mit denen der damals teilnehmenden OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Mitgliedsstaaten hatte weitreichende Folgen für das hiesige Bildungssystem.
Im Auftrag der OECD hat PISA es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit Bildungssysteme miteinander zu vergleichen und die Ergebnisse dieser Untersuchungen in einem Länderranking festzuhalten. Insbesondere diese Art der Präsentation der Ergebnisse löste im Jahr 2001 den „PISA-Schock“ (Huisken 2005) in Deutschland aus. Die deutsche Selbswahrnehmung, die durch den wirtschaftlichen Erfolg und das bis dahin international angesehene Bildungs- und Berufsbildungssystem, geprägt war, bekam aufgrund vermeintlich wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse einen erheblichen Dämpfer. Deutschland lag bei der Untersuchung deutlich unter dem OECD-Durchschnitt, was laut der Bildungspolitik selbstverständlich nicht mit dem nationalen Anspruch vereinbar sein könnte.
Aus diesem Resultat wurden (der OECD-Logik folgend) umgehend negative Prognosen für die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit Deutschlands abgeleitet. Werde das deutsche Bildungssystem nicht umgehend reformiert, stünde man in nächster Zukunft wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand.
In einem nicht zu vergleichenden Aktionismus und einem enormen Tempo wurden deshalb in den zentralen Institutionen des Bildungswesens – in erster Linie der Kultusministerkonferenz – neue Regelungen und Reformen verabschiedet, die Deutschland wieder auf die ökonomische Siegerstrasse führen sollten. Dabei kam es zu einem massiven Bruch mit dem bis dahin vorherrschenden deutschen Bildungsverständnis: Es wurden Bildungsstandards eingeführt, deren ständige Überprüfung verordnet wurde, da man dem Beispiel von Ländern, die Bestplatzierungen bei PISA eingenommen hatten, folgen wollte. Auf diese Weise verabschiedete man sich von der bis dahin anerkannten Input-Orientierung zugunsten einer Output-Orientierung und folgte damit sowohl dem transnationalen Trend als auch der modernen Vorstellung alles quantifizierbar machen zu können.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- PISA & Co.
- Das Programm
- PISA im Vergleich zu anderen internationalen Schulleistungsvergleichen
- PISA versus TIMSS
- Die PISA Debatte
- Konsequenzen aus PISA
- Die Reformdebatte
- Die Einführung von Bildungsstandards
- Bildungsstandards und Output-Orientierung
- Teaching to the Test
- Die Entstehung eines Schulmarktes
- Die Entstehung einer Testindustrie
- Öffentliche Ausgaben
- PISA als kulturindustrielles Phänomen
- PISA als einflussreiches Unternehmen
- Kritik und Medien
- Methodische Kritik
- Der Einfluss der Medien
- PISA und Bologna als legitime Programme in einer neuen Weltkultur
- Der Bologna-Prozess
- Die Umstrukturierung des Hochschulstudiums nach marktwirtschaftlichen Prinzipien
- Die unvermeidliche Anpassung an Makrobedingungen
- Die Implementierung des Bologna-Prozesses in Deutschland
- Der Legitimationsschwund nationaler Traditionen
- Die Entwicklung einer modernen Weltkultur
- PISA und Bologna als Instrumente transnationaler Regime
- Der Bologna-Prozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit den Auswirkungen und Implikationen der PISA-Studien auf das deutsche Schulsystem und die deutsche Hochschullandschaft. Sie analysiert die Faktoren, die PISA zu einem so einflussreichen Programm gemacht haben, und hinterfragt die Legitimität dieses Einflusses im Kontext der methodischen und methodologischen Schwächen sowie der mangelnden demokratischen Legitimation. Die Arbeit untersucht auch die Folgen des Bologna-Prozesses und dessen Einfluss auf die deutsche Universitätslandschaft.
- Die Entstehung und Implementierung eines neuen Bildungsparadigmas in Deutschland
- Die Rolle von PISA und Bologna als Instrumente transnationaler Regime
- Die Ökonomisierung von Bildung und die Transformation von Bildung in Humankapitalproduktion
- Die Folgen der Einführung von Bildungsstandards und Output-Orientierung
- Die Kritik an PISA und Bologna sowie der Einfluss der Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beschreibt den „PISA-Schock“ in Deutschland im Jahr 2001. Die negative Wahrnehmung der deutschen Schülerleistungen im Vergleich zu anderen OECD-Mitgliedsstaaten führte zu weitreichenden Reformen im deutschen Bildungssystem. Die Arbeit untersucht die Folgen dieser Reformen und die Implementierung eines neuen Bildungsparadigmas.
PISA & Co.
Dieses Kapitel befasst sich mit den PISA-Studien und deren Einfluss auf das deutsche Bildungssystem. Es analysiert die Methodik der PISA-Studien, die PISA-Debatte, die Konsequenzen aus den PISA-Ergebnissen und die Entstehung einer Testindustrie.
Kritik und Medien
Dieses Kapitel beleuchtet die Kritik an PISA und die Rolle der Medien im Kontext der PISA-Debatte. Es untersucht methodische Kritikpunkte an den PISA-Studien und analysiert den Einfluss der Medien auf die öffentliche Wahrnehmung von PISA.
PISA und Bologna als legitime Programme in einer neuen Weltkultur
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bologna-Prozess und dessen Einfluss auf die deutsche Hochschullandschaft. Es untersucht die Umstrukturierung des Hochschulstudiums nach marktwirtschaftlichen Prinzipien und die Implementierung des Bologna-Prozesses in Deutschland.
Schlüsselwörter
PISA, Bologna-Prozess, Bildungsparadigma, Bildungsstandards, Output-Orientierung, Humankapital, Testindustrie, transnationale Regime, Ökonomisierung von Bildung, Medien, Kritik, Legitimation, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „PISA-Schock“ in Deutschland?
Der PISA-Schock bezeichnet die öffentliche Bestürzung nach der Veröffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse im Jahr 2001, bei denen deutsche Schüler deutlich schlechter abschnitten als erwartet.
Welche Konsequenzen hatte PISA für das deutsche Schulsystem?
Es kam zur Einführung von Bildungsstandards, einer Abkehr von der Input- hin zur Output-Orientierung und verstärkten Reformbemühungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Was ist der Bologna-Prozess und wie hängt er mit PISA zusammen?
Der Bologna-Prozess strukturierte das Hochschulstudium nach marktwirtschaftlichen Prinzipien um. Beide Programme werden in der Arbeit als Instrumente transnationaler Regime zur Ökonomisierung von Bildung betrachtet.
Was bedeutet „Output-Orientierung“ im Bildungswesen?
Output-Orientierung bedeutet, dass der Erfolg eines Bildungssystems an messbaren Ergebnissen (Leistungen der Schüler) statt an den investierten Ressourcen (Lehrpläne, Lehrerstunden) gemessen wird.
Welche Kritik wird an den PISA-Studien geübt?
Kritisiert werden methodische Schwächen, der enorme Einfluss der Medien und die fehlende demokratische Legitimation der OECD als treibende Kraft hinter den Tests.
Was ist mit der „Entstehung einer Testindustrie“ gemeint?
Durch die ständige Überprüfung von Bildungsstandards ist ein neuer Markt für Testmaterialien und Evaluierungen entstanden, der oft marktwirtschaftlichen Interessen folgt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, PISA und seine Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324317