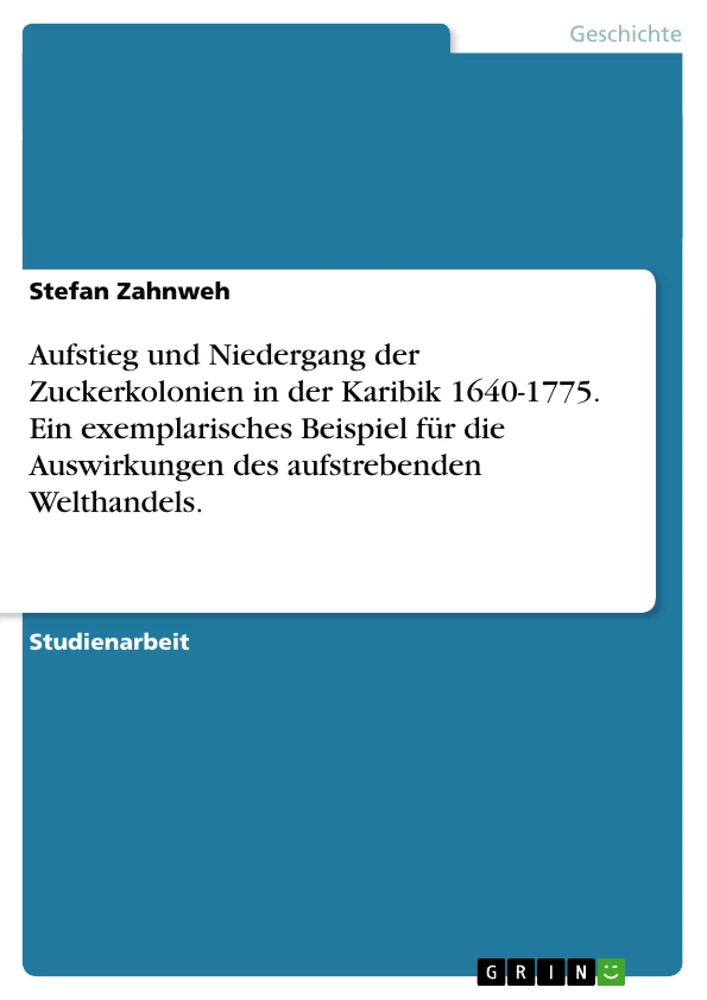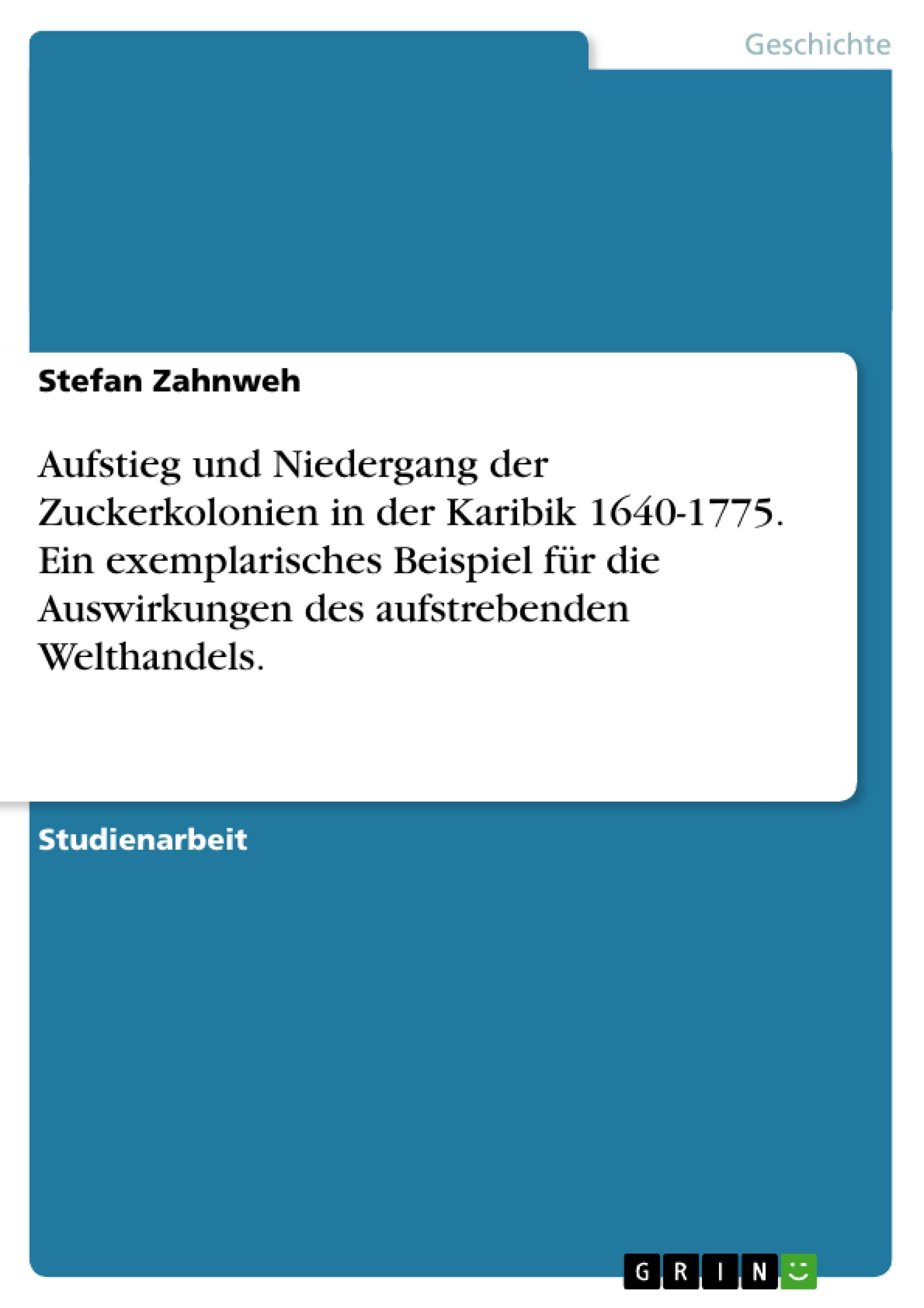„The eighteenth century marked the heyday of Caribbean colonies when they not only generated great wealth but were the hub of a commercial system involving three continents. The sugar colonies bought slaves from Africa, manufactured goods and luxuries for the planter elite from Europe and basic foods – wheat, maize, beef, pork – and timber from North America. They exported in return sugar, rum and molasses.“1 Das 18. Jahrhundert markierte eine Zeit der stürmischen Entwicklung der Zuckerindustrie. Die europäischen Importe wuchsen rasant an und Zucker wurde erstmals in seiner Geschichte zu einem Massengut. Wie bei kaum einem anderen Nahrungsmittel ging ein sinkender Zuckerpreis auch immer mit einer stark steigenden Nachfrage nach Zucker einher. So konnte sich der süße Stoff schnell eine wichtige Stellung im Alltagsleben vieler Europäer und Nordamerikaner erobern. Noch heute liegt der Zuckerkonsum in den wohlhabenden Ländern deutlich über jenem der ärmeren Nationen. Für diese stellt Zucker noch immer dar, was er bis ins 17. Jahrhundert für die ganze Weltbevölkerung war: ein Luxusgut.
Diese Arbeit versucht den Weg des Zuckers vom Mittelmeer in die Karibik nachzuzeichnen. Dabei sollen die Zuckerkolonien der Karibik im 18. Jahrhundert als ein wichtiger Baustein des aufstrebenden Welthandels dargestellt werden. Die Zuckerkolonien handelten mit mehreren Kontinenten über große Entfernungen hinweg. Noch im 15. Jahrhundert wäre dieser ausgeprägte Handel kaum möglich gewesen. Im 19. Jahrhundert hingegen hatte sich der Handel schon soweit intensiviert und ausgeweitet, dass viele der ehemals reichen Zuckerkolonien unter dem großen Konkurrenzdruck von neuen, aufstrebenden Zuckeranbauregionen litten und zusammenbrachen. Die Zeit vom späten 17. Jahrhundert bis ins späte 18. Jahrhundert stellte für die Karibikinseln eine Zeit großer Prosperität und enormen Wachstums dar. Die Region kann somit als ein Musterbeispiel für den Wandel gelten, der durch den Welthandel möglich gemacht wurde.
Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten Teil wird eine kurze Geschichte des Zuckers wiedergegeben. Es soll erklärt werden, wie und unter welchen Umständen der Zucker nach Amerika gelangte. Der Zweite Teil der Arbeit widmet sich der Transformation der Karibikinseln in enorm spezialisierte Zuckerkolonien. Im dritten Teil werden die Grundlagen der karibischen Plantagenwirtschaft beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Kleine Geschichte des Zuckers bis ins 17. Jh.
- 2. Die Entstehung der Zuckerplantagen in der Karibik
- 3. Grundlagen des Plantagensystems
- 3.1 Exporte nach Europa und Nordamerika.
- 3.2 Versorgung durch Nordamerika und Europa
- 3.3 Sklaverei
- 4. Probleme gegen Ende des 18 Jh. .
- Welthandel und Zucker
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Zuckerindustrie im 18. Jahrhundert nachzuzeichnen und die Zuckerkolonien der Karibik als einen wichtigen Baustein des aufstrebenden Welthandels zu präsentieren. Dabei soll der Wandel, der durch den Welthandel möglich gemacht wurde, am Beispiel der Karibikinseln veranschaulicht werden.
- Die Geschichte des Zuckers vom Mittelmeer in die Karibik
- Die Transformation der Karibikinseln zu spezialisierten Zuckerkolonien
- Die Grundlagen der karibischen Plantagenwirtschaft, insbesondere Sklavenarbeit und der Handel mit Europa und Nordamerika
- Die Faktoren, die zum Niedergang der Zuckerkolonien beitrugen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Zuckerindustrie im 18. Jahrhundert und zeigt die steigende Nachfrage nach Zucker auf, die zu einem Massengut wurde. Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte, die jeweils verschiedene Aspekte der Zuckerproduktion und des Handels behandeln.
Kapitel 1 gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte des Zuckers, beginnend mit seiner Kultivierung in Neuguinea bis hin zur Ausbreitung des Anbaus in Indien und dem Mittelmeerraum. Die Bedeutung von Sklavenarbeit in der Zuckerproduktion wird hervorgehoben, sowie der Transport des Zuckers über weite Strecken. Die Verlagerung der Zuckerproduktion von der Levante auf Inseln im Mittelmeer und schließlich nach Madeira und Sao Tomé wird ebenfalls dargestellt.
Kapitel 2 widmet sich der Entstehung der Zuckerplantagen in der Karibik und den Gründen, warum sich diese Region für den Zuckeranbau eignete. Die Rolle der portugiesischen Kolonialisierung und die Bedeutung der Sklavenmärkte in Afrika werden erläutert.
Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen des Plantagensystems in der Karibik. Hierbei werden die Exporte nach Europa und Nordamerika, die Versorgung der Kolonien durch Güter aus Nordamerika und Europa sowie die Rolle der Sklaverei im Detail behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Zuckerproduktion, Sklavenarbeit, Welthandel, Karibikinseln, Plantagenwirtschaft, 18. Jahrhundert, Europa, Nordamerika, Afrika. Die zentralen Aspekte sind die Entwicklung der Zuckerindustrie, der Handel mit verschiedenen Kontinenten und die Auswirkungen der Sklaverei auf die Zuckerproduktion.
- Arbeit zitieren
- Stefan Zahnweh (Autor:in), 2004, Aufstieg und Niedergang der Zuckerkolonien in der Karibik 1640-1775. Ein exemplarisches Beispiel für die Auswirkungen des aufstrebenden Welthandels., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32445