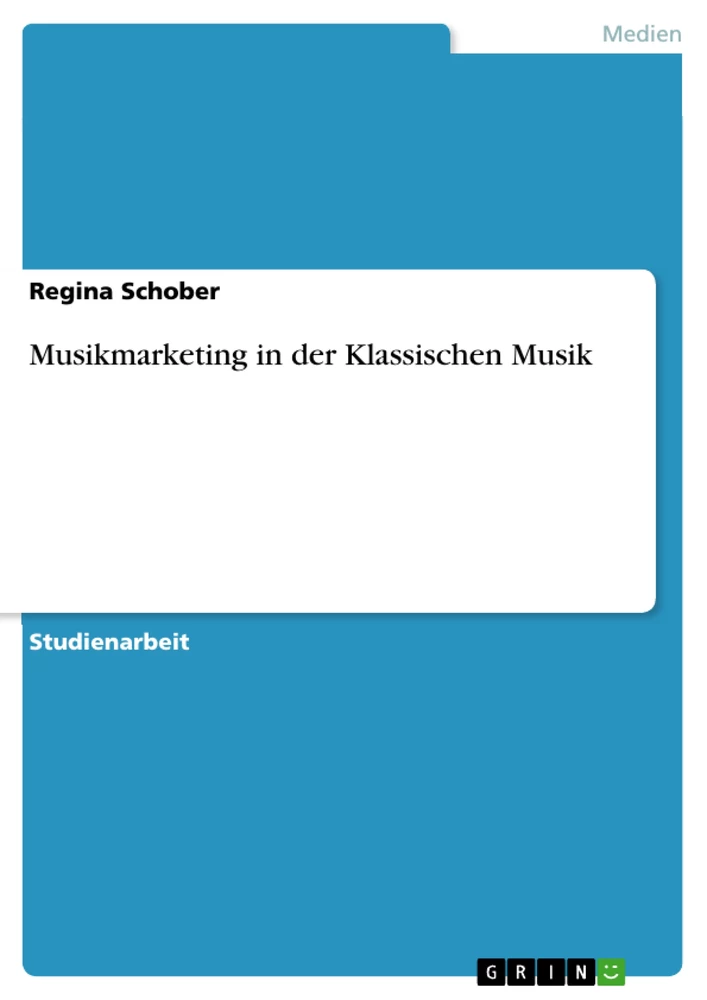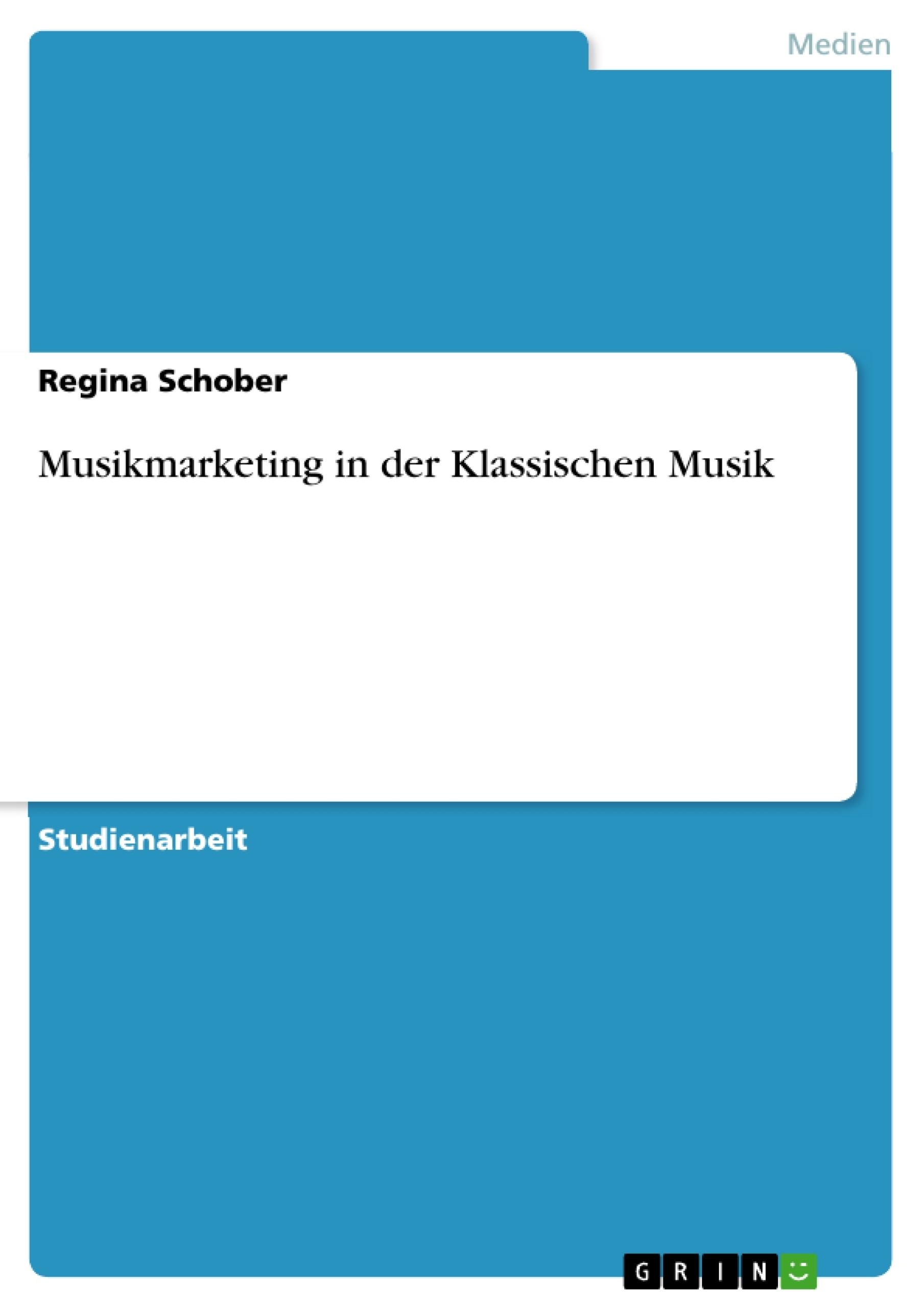Einleitung
Es liegt im Wesen der Musik, dass sie gehört wird. Viele Komponisten behaupten zwar, sie schrieben nicht für das Publikum, doch spätestens wenn Musik als vermittelndes Kulturgut etwas bewirken soll, tritt das Verhältnis von Künstler und Rezipient zum Vorschein. Nicht zuletzt für die Finanzierung der „Arbeit“ – den Lebensunterhalt des Komponisten, Künstlers oder Musikdirektors – ist der Musikhörer ein nicht zu vernachlässigender, ja wesentlicher Faktor. Betrachtet man Musik als Ware, die sich den Gesetzen einer Marktwirtschaft entsprechend verhalten muss, um sich auf dem Markt behaupten zu können, so muss sie, genau wie andere Produkte, „vermarktet“ werden. Ohne das entsprechende Marketing hat auch Musik keine Chance, verkauft und gehört zu werden – weder populäre noch „klassische“ Musik.
In dieser Arbeit möchte ich die Bedeutung des Musikmarketings aufzeigen, indem ich ihr Instrumentarium und ihre Auswirkungen beleuchte. Der Schwerpunkt meiner Untersuchung liegt in der Vermarktung der sogenannten „klassischen“ Musik und der Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten bezüglich der Vermarktung von populärer Musik.
Nach einer allgemeinen Definition des Marketing-Begriffs wird die Notwendigkeit des Musikmarketings erörtert und in einen Zusammenhang mit der Musiklandschaft und -organisation in Deutschland gestellt. Die Unterscheidung von „E-Musik“ und „U-Musik“ wirft nicht nur bezüglich der Begrifflichkeit Probleme auf. Auch in Hinsicht auf ihre Vermarktung sind diese beiden „Musikarten“ oft schwer voneinander abzugrenzen. Nach einer kurzen Darstellung der Marketingkriterien im „U-Musik“-Bereich wird anhand einiger Aspekte die Vermarktung der „E-Musik“ veranschaulicht. Dabei steht das „Marketingobjekt“ sowie das Marketinginstrumentarium im Vordergrund. Es folgen zusätzliche Überlegungen zu dem Thema.
In dem Teil meiner Arbeit, in dem es um die Vermarktung der „klassischen“ Musik geht, habe ich mich vor allem auf das Buch „Geldscheinsonate – Das Millionenspiel mit der Klassik“ von Klaus Umbach berufen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit vermerke ich Zitate aus seinem Werk nur mit einer Seitenzahl. Die genaue Literaturangabe findet sich im Literaturverzeichnis am Ende.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Marketingbegriff und seine Anwendung auf die Musik
- 2.1 Marketing
- 2.2 Musikmarketing
- 2.3 Organisation von Musik in Deutschland
- 2.4 Trennung von U- und E-Musik
- 2.5 Marketingmechanismen im U-Musik Bereich
- 3. Marketing im Bereich der klassischen Musik
- 3.1 Der Interpret als Marketingobjekt
- 3.2 Marketinginstrumente in der „klassischen Musik“
- 3.2.1 Tonträgerproduktion
- 3.2.2 Hörfunk und Fernsehen
- 3.2.3 Konzertveranstaltungen und Festivals
- 3.2.4 Merchandising und andere Formen des Marketings
- 3.3 Musikmarketing und musikalischer Anspruch
- 3.4 Künstlerimage und Publikumswirkung
- 4. Schluss
- 5. Verwendete Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Musikmarketing, insbesondere im Bereich der klassischen Musik. Die Arbeit beleuchtet das Instrumentarium des Musikmarketings und dessen Auswirkungen auf die Verbreitung und den Erfolg von Musik. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Marketingstrategien in der klassischen und der populären Musik.
- Definition und Anwendung des Marketingbegriffs auf Musik
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Marketing von klassischer und populärer Musik
- Analyse der Marketinginstrumente im Bereich der klassischen Musik
- Der Interpret als Marketingobjekt
- Beziehung zwischen Musikmarketing und musikalischem Anspruch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Musikmarketing ein und betont die Notwendigkeit der Vermarktung von Musik, sowohl populärer als auch klassischer, um deren Verbreitung und den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und den Fokus auf die Vermarktung klassischer Musik im Vergleich zur populären Musik. Die Abhängigkeit von der Rezeption der Musik für die Finanzierung der Künstler wird hervorgehoben.
2. Der Marketingbegriff und seine Anwendung auf die Musik: Dieses Kapitel definiert den Marketingbegriff und seine Entwicklung im 20. Jahrhundert im Kontext des Käufermarktes. Es werden die vier Marketing-Mix-Faktoren (Produkt/Qualität, Distribution, Preis, Kommunikation) detailliert erklärt und ihre Interdependenz für eine erfolgreiche Marketingstrategie betont. Die Anwendung dieser Prinzipien auf die Musikbranche wird eingeführt, wobei die Besonderheiten der Musik als Produkt hervorgehoben werden.
3. Marketing im Bereich der klassischen Musik: Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Herausforderungen und Strategien des Musikmarketings im Bereich der klassischen Musik. Es untersucht den Interpreten als Marketingobjekt und beleuchtet verschiedene Marketinginstrumente wie Tonträgerproduktion, Hörfunk- und Fernsehauftritte, Konzertveranstaltungen und Festivals sowie Merchandising. Die Arbeit diskutiert den schwierigen Balanceakt zwischen musikalischem Anspruch und kommerziellen Aspekten des Marketings und analysiert den Einfluss des Künstlerimages auf die Publikumswirkung.
Schlüsselwörter
Musikmarketing, Klassische Musik, Populäre Musik, Marketinginstrumente, Künstlerimage, Publikumswirkung, Marketing-Mix, Tonträgerproduktion, Konzertveranstaltungen, Merchandising, Marktwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Musikmarketing im Bereich der Klassischen Musik
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Musikmarketing, insbesondere im Bereich der klassischen Musik. Sie beleuchtet das Instrumentarium des Musikmarketings und dessen Auswirkungen auf die Verbreitung und den Erfolg von Musik. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Marketingstrategien in der klassischen und der populären Musik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Anwendung des Marketingbegriffs auf Musik; Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Marketing von klassischer und populärer Musik; Analyse der Marketinginstrumente im Bereich der klassischen Musik; Der Interpret als Marketingobjekt; Beziehung zwischen Musikmarketing und musikalischem Anspruch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Marketingbegriff und seine Anwendung auf die Musik, Marketing im Bereich der klassischen Musik, Schlussfolgerung und Verwendete Literatur. Kapitel 2 definiert den Marketingbegriff und seine Anwendung auf Musik, mit Fokus auf den Marketing-Mix. Kapitel 3 analysiert spezifische Marketinginstrumente und -strategien im Bereich der klassischen Musik, einschließlich der Rolle des Interpreten und des Verhältnisses zwischen musikalischem Anspruch und kommerziellen Aspekten.
Welche Marketinginstrumente werden im Bereich der klassischen Musik betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Marketinginstrumente im Bereich der klassischen Musik, darunter Tonträgerproduktion, Hörfunk- und Fernsehauftritte, Konzertveranstaltungen und Festivals sowie Merchandising.
Wie wird der Interpret in der Arbeit betrachtet?
Der Interpret wird als zentrales Marketingobjekt betrachtet. Seine Bedeutung für den Erfolg der Musikverbreitung und die Publikumswirkung wird ausführlich analysiert.
Welchen Schwerpunkt legt die Arbeit?
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Vergleich der Marketingstrategien in der klassischen und der populären Musik, unter Berücksichtigung der spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich der klassischen Musik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Musikmarketing, Klassische Musik, Populäre Musik, Marketinginstrumente, Künstlerimage, Publikumswirkung, Marketing-Mix, Tonträgerproduktion, Konzertveranstaltungen, Merchandising, Marktwirtschaft.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Bedeutung von Musikmarketing im Bereich der klassischen Musik und die Analyse der verwendeten Marketinginstrumente und deren Auswirkungen auf die Verbreitung und den Erfolg von klassischer Musik.
Welche Kapitelzusammenfassung wird gegeben?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen zu allen Kapiteln, die die Kernaussagen und die behandelten Themen kurz und prägnant beschreiben. Die Einleitung führt in das Thema ein, Kapitel 2 definiert den Marketingbegriff und seine Anwendung auf Musik, Kapitel 3 analysiert das Marketing im Bereich der klassischen Musik, und das Schlusskapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
- Arbeit zitieren
- Regina Schober (Autor:in), 2000, Musikmarketing in der Klassischen Musik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3245