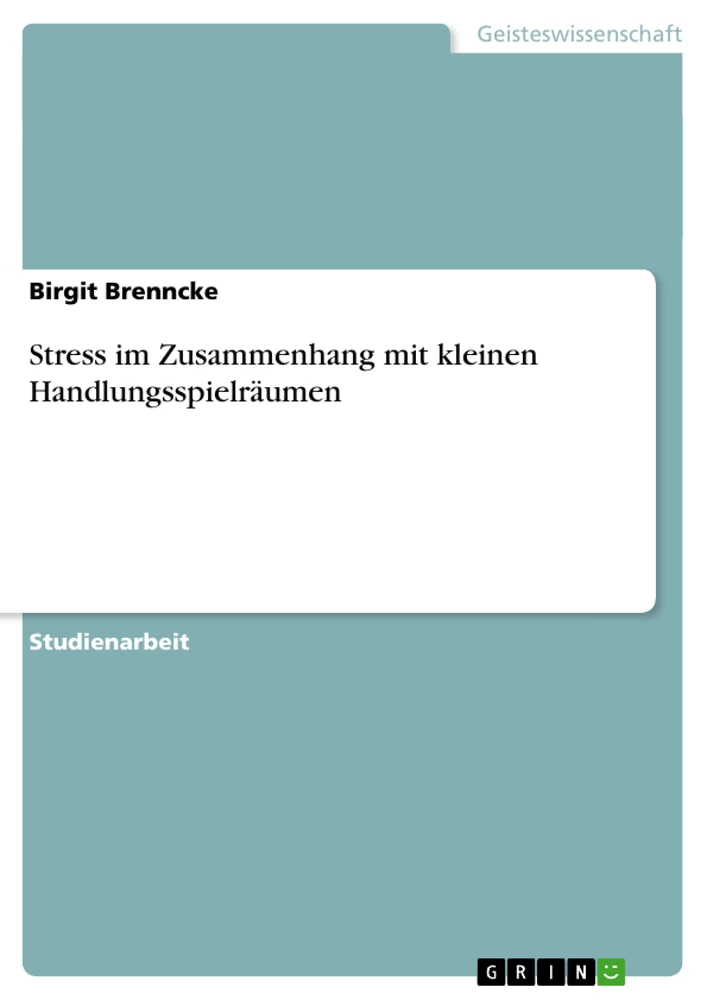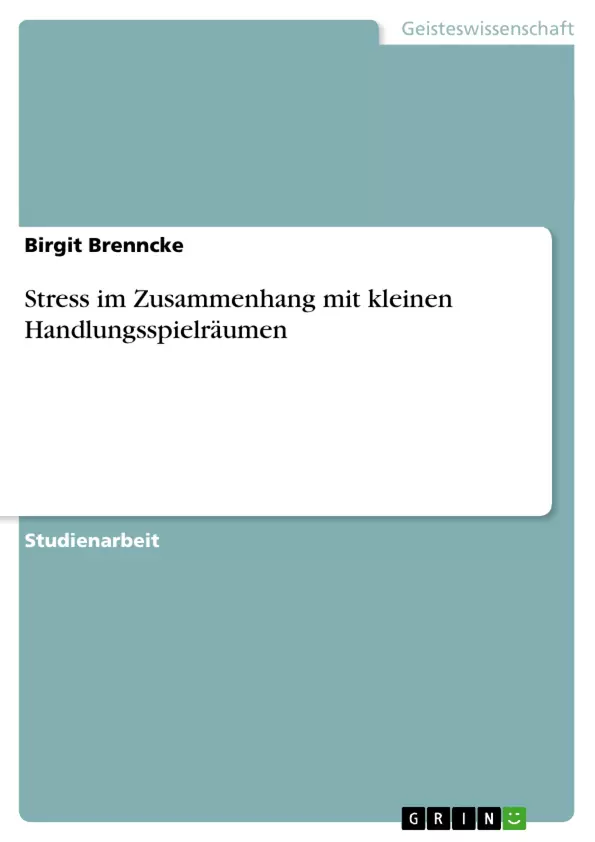In der heutigen Gesellschaft klagen unzählige Menschen über Stress. Im modernen Arbeitsleben ist der Stress sowohl durch die eigene Persönlichkeitsstrukur als auch durch Arbeitssituationen bedingt, die sich für die Beschaffenheit des menschlichen Organismus als belastend erweisen. Die individuelle Lebenssituation aber vor allem auch die Belastungsintensität der Anforderungen, die an den Einzelnen gestellt werden, wirken sich in ihrer Bedeutsamkeit unterschiedlich auf den jeweiligen Menschen aus. Belastungen oder Gefahrensituationen können Prozesse des Körpers in ihren Zusammenwirken beieinträchtigen. Der menschliche Organismus hat die Fähigkeit auf belastende Situationen mit Abwehrmechanismen zu reagieren, die den Körper in einen angeregten Zustand versetzen, um mögliche Gefahren abzuwenden. Diese Maßnahmen sind in vielen Fällen zweckmäßig, um den Organismus vor zu starker Beeinträchtigung zu schützen.
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, in wie fern das Ausmaß des Handlungsspielraums einer Arbeitstätigkeit einen Einfluss auf das Empfinden oder auf die Verarbeitung von Stress hat. Da für die Arbeitseffizienz die Arbeitszufriedenheit und - motivation im Unternehmen eine große Rolle spielt, haben Vorüberlegungen zur Arbeitsgestaltung eine wichtige Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit.
In Hinblick auf die Fragestellung nach den Bedingungen einer persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung nimmt die Diskussion um die Flexibilitätsförderung durch Erweiterung der Handlungsspielräume eine Schlüsselstellung ein. Monotonie, Einseitigkeit und hohe Fremdbestimmung - die Kennzeichen einer Tätigkeit mit geringem Handlungsspielraum - begünstigen die Empfindung, einer belastenden Situation ausgesetzt zu sein und somit die Entstehung von Stress.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stress und seine Wirkungen
- 2.1. Definitorische Eingrenzung des Begriffes „Stress“
- 2.2. Belastungen und Stressoren am Arbeitsplatz
- 2.3. Die Auseinandersetzung der Person mit den Belastungen
- 3. Die Charakterisierung des Handlungsspielraums
- 3.1. Definitorische Eingrenzung des Begriffes „Handlungsspielraum“
- 3.2. Bestehende Konzepte zur Charakterisierung des Handlungsspielraums
- 3.3. Auswirkungen einer Handlungsspielraumerweiterung
- 4. Stress als Folgeerscheinung eines kleinen Handlungsspielraums
- 4.1. Kennzeichen eines kleinen Handlungsspielraums
- 4.2. Auswirkungen eines kleinen Handlungsspielraums auf die Arbeitstätigkeit
- 4.3. Belastende Faktoren einer Arbeitstätigkeit mit kleinem Handlungsspielraum
- 4.4. Die Ergebnisse von Untersuchungen zum Thema Stress und kleiner Handlungsspielraum
- 4.5. Der Zusammenhang zwischen Anforderungen der Arbeit und dem Handlungsspielraum nach Karasek
- 5. Vorstellung geeigneter Tests zur empirischen Untersuchung
- 5.1. Methodische Probleme bei der empirischen Untersuchung
- 5.2. Tests zur empirischen Untersuchung
- 5.2.1. Der Fragebogen zur Arbeitsanalyse (FAA) und das Arbeitswissenschaftliche Erhebungsverfahren zur Tätigkeitsanalyse (AET)
- 5.2.2. Das Job Diagnostic Survey (JDS)
- 5.2.3. Das Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit (VERA)
- 6. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Stress und einem kleinen Handlungsspielraum. Ziel ist es, zu untersuchen, ob und inwiefern eine Arbeit, die durch geringe Entscheidungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie hohe Fremdbestimmung gekennzeichnet ist, Stress verursacht.
- Stressreaktionen des menschlichen Organismus
- Belastungen und Stressoren am Arbeitsplatz
- Definitorische Einordnung des Handlungsspielraums
- Auswirkungen eines kleinen Handlungsspielraums auf die Arbeitstätigkeit
- Empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Stress und Handlungsspielraum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Stresses im Zusammenhang mit kleinen Handlungsspielräumen ein und beleuchtet die Bedeutung der Arbeitsgestaltung für die Arbeitszufriedenheit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Stress und seinen Wirkungen. Es definiert den Begriff „Stress“ und beleuchtet die verschiedenen Belastungen und Stressoren, die am Arbeitsplatz auftreten können. Außerdem wird die Auseinandersetzung der Person mit den Belastungen thematisiert. Das dritte Kapitel widmet sich der Charakterisierung des Handlungsspielraums. Es erfolgt eine definitorische Eingrenzung des Begriffs „Handlungsspielraum“ sowie eine Vorstellung bestehender Konzepte zur Charakterisierung des Handlungsspielraums. Auch die Auswirkungen einer Handlungsspielraumerweiterung werden betrachtet. Das vierte Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Stress und einem kleinen Handlungsspielraum. Es werden die Kennzeichen eines kleinen Handlungsspielraums, die Auswirkungen eines kleinen Handlungsspielraums auf die Arbeitstätigkeit und die belastenden Faktoren einer Arbeitstätigkeit mit kleinem Handlungsspielraum beleuchtet. Außerdem werden die Ergebnisse von Untersuchungen zum Thema Stress und kleiner Handlungsspielraum sowie der Zusammenhang zwischen Anforderungen der Arbeit und dem Handlungsspielraum nach Karasek dargestellt. Das fünfte Kapitel stellt geeignete Tests für eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Stress und Handlungsspielraum vor. Es werden methodische Probleme der empirischen Untersuchung sowie verschiedene Tests, wie der Fragebogen zur Arbeitsanalyse (FAA), das Job Diagnostic Survey (JDS) und das Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit (VERA) vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Stress, Handlungsspielraum, Arbeitsgestaltung, Belastungen, Stressoren, Arbeitszufriedenheit und empirische Untersuchung. Weitere wichtige Begriffe sind: Tayloristische Arbeitszerstückelung, Fremdbestimmung, Entscheidungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, Allgemeine Adaptationssyndrom (AAS), Belastungsintensität, Arbeitswissenschaftliche Erhebungsverfahren zur Tätigkeitsanalyse (AET), Job Diagnostic Survey (JDS), Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit (VERA).
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Handlungsspielraum und Stress zusammen?
Ein geringer Handlungsspielraum führt oft zu Monotonie und Fremdbestimmung, was das Stressempfinden signifikant erhöht.
Was ist das Karasek-Modell?
Ein Modell, das den Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und dem Entscheidungsspielraum zur Erklärung von Stressbelastung nutzt.
Was sind typische Stressoren am Arbeitsplatz?
Hoher Zeitdruck, geringe Kontrolle über Aufgaben, soziale Konflikte und mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten.
Welche Tests messen den Handlungsspielraum?
Instrumente wie der Fragebogen zur Arbeitsanalyse (FAA) oder das Job Diagnostic Survey (JDS).
Wie wirkt sich eine Erweiterung des Handlungsspielraums aus?
Sie fördert die Arbeitszufriedenheit, die Motivation und reduziert das Risiko für stressbedingte Erkrankungen.
- Citation du texte
- Birgit Brenncke (Auteur), 2003, Stress im Zusammenhang mit kleinen Handlungsspielräumen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32591