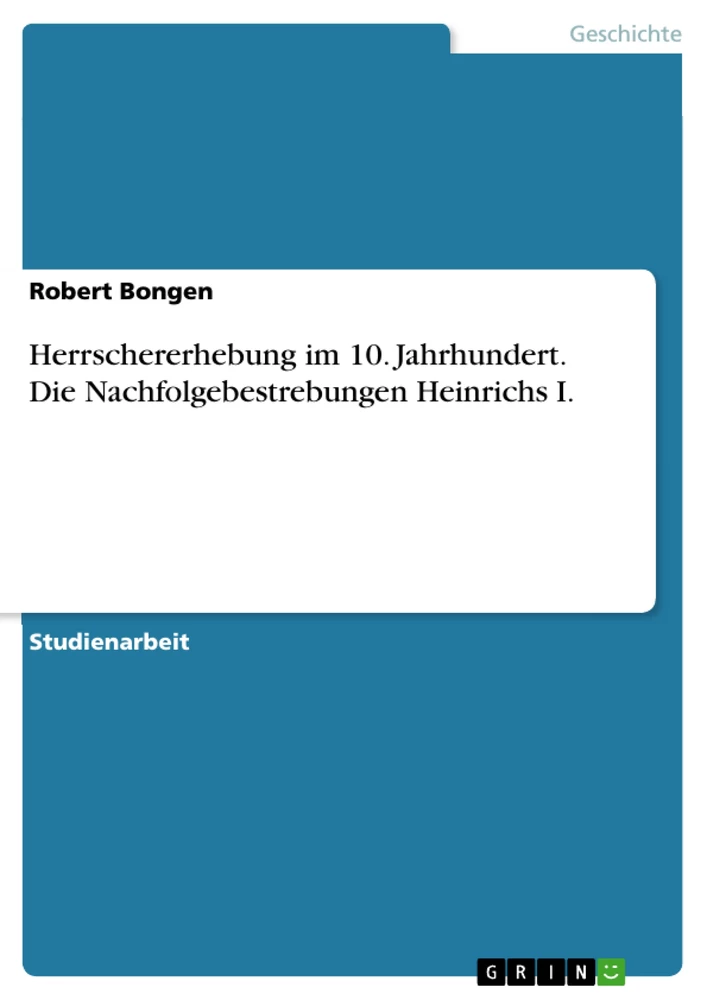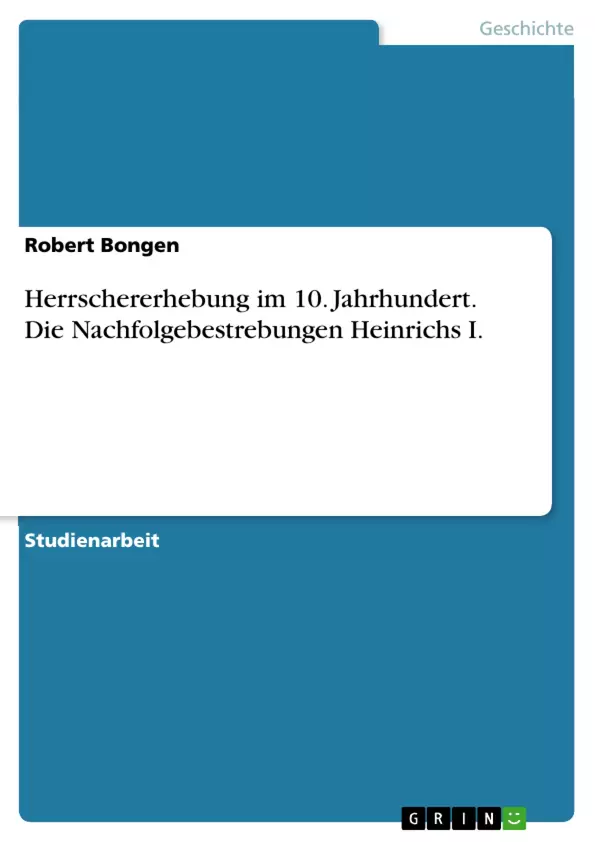Die Ernennung Ottos zum Nachfolger Heinrichs I. und die anschließende Krönungszeremonie in Aachen stehen am Anfang einer Rebellion, die erst fünf Jahre später, am Weihnachtsabend 941, ihren Abschluss finden sollte. Im Zentrum dieser Aufstände, die Otto vorübergehend in den Zustand einer nicht zu überwindenden Lähmung versetzten, sieht man stets Heinrich, den jüngeren Bruder Ottos. Dessen ehrgeizige Nachfolgebestrebungen sollten ihm ein Recht zurückgeben, was ihm seiner Ansicht nach zu Unrecht verwehrt worden war: das Recht auf die Königswürde.
Diese Arbeit will in diesem Zusammenhang wichtigen Fragen nachgehen: Warum wurde Otto und nicht Heinrich zum Thronfolger ernannt? Mit welcher Legitimation versuchte Heinrich dennoch die Krone zu erlangen? Und warum konnten seine Nachfolgebestrebungen letztlich nicht erfolgreich sein?
Die Quellenlage für den zu behandelnden Zeitraum ist breit gefächert – allerdings ist es oft schwierig zu entscheiden, was Wirklichkeit, was Topos, was Tatsache und was übertragenes Geschehen ist.
Die Intensität der Verwendung einer Quelle in dieser Arbeit ist von ihrer Glaubwürdigkeit sowie ihrer Brauchbarkeit abhängig gemacht worden. Der Lesbarkeit halber ist darauf verzichtet worden, im Text die Quellen lateinisch zu zitieren; dies wird in den Fußnoten nachgeholt. Die verwendete Literatur wird nicht nur als Quellenergänzung verstanden, sondern als Möglichkeit, bestimmte Problemfelder kompetent und kontrovers zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Nachfolge Heinrichs I.
- 1. Von der Reichsteilung zur Unteilbarkeit
- 2. Heinrich als Opfer der Unteilbarkeit
- 3. Designation Ottos
- 4. Legitimer Anspruch Heinrichs?
- 4.1. Der in Purpur Geborene
- 4.2. Legitimität des Anspruchs in den Quellen
- III. Bruderkrieg - Heinrichs Aufstände
- 1. Möglichkeiten Heinrichs nach der Krönung Ottos
- 2. Ottos Feinde im Reich
- 3. Verlauf der Aufstände
- 3.1. 938 - Entführung und Verschwörung
- 3.2. 939 - Erster Aufstand und Schlacht bei Birten
- 3.3. 939 - Zweiter Aufstand und das pactum mutuum
- 3.4. 941 - Verratener Mordanschlag
- IV. Heinrich und die Königsherrschaft
- 1. Zur Stärke Heinrichs
- 2. Zur Aussichtslosigkeit des Aufstandes
- 2.1.1. Heinrich als Herzog von Bayern
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Nachfolgebestrebungen Heinrichs, des jüngeren Bruders Ottos I., nach dem Tod Heinrichs I. Die zentralen Fragen sind die Gründe für Ottos Ernennung zum Nachfolger, die Legitimation von Heinrichs Anspruch auf die Krone und die Ursachen für das letztliche Scheitern seiner Rebellion. Die Arbeit analysiert die komplexe Quellenlage und diskutiert verschiedene Interpretationen der Ereignisse.
- Die Prinzipien der Thronfolge im 10. Jahrhundert und die Abkehr von der Reichsteilung.
- Die Legitimität der Herrschaft und die Rolle der Designation durch den Vater.
- Die Machtkämpfe zwischen Otto I. und Heinrich sowie deren strategische und politische Hintergründe.
- Die Bewertung der Quellen und die Herausforderungen ihrer Interpretation.
- Die Analyse der Erfolgsaussichten von Heinrichs Aufstand.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Rebellion Heinrichs gegen seinen Bruder Otto I. nach der Krönung des Letzteren im Jahre 936. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen: Warum wurde Otto und nicht Heinrich zum Nachfolger ernannt? Wie versuchte Heinrich, die Krone zu erlangen? Und warum scheiterte er? Die Arbeit betont die Herausforderungen bei der Interpretation der Quellen und erläutert die methodische Herangehensweise.
II. Die Nachfolge Heinrichs I.: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Thronfolge im 10. Jahrhundert. Es beschreibt den Wandel von der traditionellen Reichsteilung unter den Söhnen des Königs hin zur Unteilbarkeit der Herrschaft, die durch den Machtkampf unter den Karolingern erzwungen wurde. Heinrich I. entschied sich aufgrund der Machtverhältnisse im Reich gegen eine Teilung und designierte seinen älteren Sohn Otto als Nachfolger. Heinrichs Ausschluss vom Thron wird als Konsequenz dieses Prinzips der Unteilbarkeit interpretiert, ein Prinzip, das für den jüngeren Bruder gravierende Folgen hatte. Die Debatte um den genauen Zeitpunkt der Designation Ottos wird ebenfalls thematisiert.
III. Bruderkrieg - Heinrichs Aufstände: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Aufstände Heinrichs gegen Otto I. Es analysiert Heinrichs Handlungsoptionen nach Ottos Krönung und die Konstellation der politischen Gegner Ottos im Reich. Der Verlauf der Aufstände wird chronologisch dargestellt, inklusive der Entführung Ottos im Jahre 938, der Schlachten und des schließlich gescheiterten Mordanschlags von 941. Die Kapitel beleuchten die strategischen Entscheidungen und das militärische Geschehen, die zu Heinrichs Niederlage führten.
IV. Heinrich und die Königsherrschaft: Dieses Kapitel untersucht die Stärken Heinrichs und die Gründe für das Scheitern seines Aufstands. Es analysiert Heinrichs Position als Herzog von Bayern und die politischen und militärischen Faktoren, die letztendlich zu seiner Unterwerfung führten. Die Kapitel analysiert, warum trotz möglicher Stärken Heinrichs Aufstand letztendlich keine Chance auf Erfolg hatte.
Schlüsselwörter
Heinrich I., Otto I., Thronfolge, Reichsteilung, Unteilbarkeit der Herrschaft, Designation, Legitimität, Bruderkrieg, Aufstände, Königsherrschaft, Sachsen, Liudolfinger, Ottonen, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Die Nachfolge Heinrichs I.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Nachfolgebestrebungen Heinrichs, des jüngeren Bruders Ottos I., nach dem Tod Heinrichs I. Im Mittelpunkt stehen die Gründe für Ottos Ernennung zum Nachfolger, die Legitimation von Heinrichs Anspruch auf die Krone und die Ursachen für das Scheitern seiner Rebellion. Analysiert wird die komplexe Quellenlage und verschiedene Interpretationen der Ereignisse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Prinzipien der Thronfolge im 10. Jahrhundert und der Abkehr von der Reichsteilung, der Legitimität der Herrschaft und der Rolle der Designation durch den Vater, den Machtkämpfen zwischen Otto I. und Heinrich, der Bewertung der Quellen und den Herausforderungen ihrer Interpretation sowie der Analyse der Erfolgsaussichten von Heinrichs Aufstand.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
I. Einleitung: Skizziert die Rebellion Heinrichs gegen Otto I. und benennt die zentralen Forschungsfragen (Warum Otto und nicht Heinrich? Wie versuchte Heinrich, die Krone zu erlangen? Warum scheiterte er?). Es wird die methodische Herangehensweise erläutert.
II. Die Nachfolge Heinrichs I.: Analysiert die Entwicklung der Thronfolge im 10. Jahrhundert, den Wandel von der Reichsteilung zur Unteilbarkeit der Herrschaft und Heinrichs I. Entscheidung für Otto als Nachfolger. Die Debatte um den Zeitpunkt der Designation Ottos wird thematisiert.
III. Bruderkrieg - Heinrichs Aufstände: Beschreibt detailliert die Aufstände Heinrichs gegen Otto I., seine Handlungsoptionen nach Ottos Krönung, die politischen Gegner Ottos und den chronologischen Verlauf der Aufstände (Entführung Ottos, Schlachten, Mordanschlag). Strategische Entscheidungen und militärisches Geschehen werden beleuchtet.
IV. Heinrich und die Königsherrschaft: Untersucht Heinrichs Stärken und die Gründe für das Scheitern seines Aufstands. Es analysiert Heinrichs Position als Herzog von Bayern und die politischen und militärischen Faktoren, die zu seiner Unterwerfung führten.
V. Fazit: (Der Inhalt des Fazits wird nicht explizit in der Zusammenfassung genannt, lässt sich aber aus den vorherigen Kapiteln ableiten).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Heinrich I., Otto I., Thronfolge, Reichsteilung, Unteilbarkeit der Herrschaft, Designation, Legitimität, Bruderkrieg, Aufstände, Königsherrschaft, Sachsen, Liudolfinger, Ottonen, Quellenkritik.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die konkreten Quellen werden nicht explizit genannt, aber die Arbeit betont die komplexe Quellenlage und die Herausforderungen bei deren Interpretation.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit der Geschichte des 10. Jahrhunderts, insbesondere der ottonischen Dynastie, auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Analyse der Thematik.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit ist aufgebaut mit Einleitung, Kapiteln zur Nachfolge Heinrichs I., den Aufständen Heinrichs, Heinrichs Rolle und der Königsherrschaft und einem Fazit. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
- Citar trabajo
- Robert Bongen (Autor), 1999, Herrschererhebung im 10. Jahrhundert. Die Nachfolgebestrebungen Heinrichs I., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32611