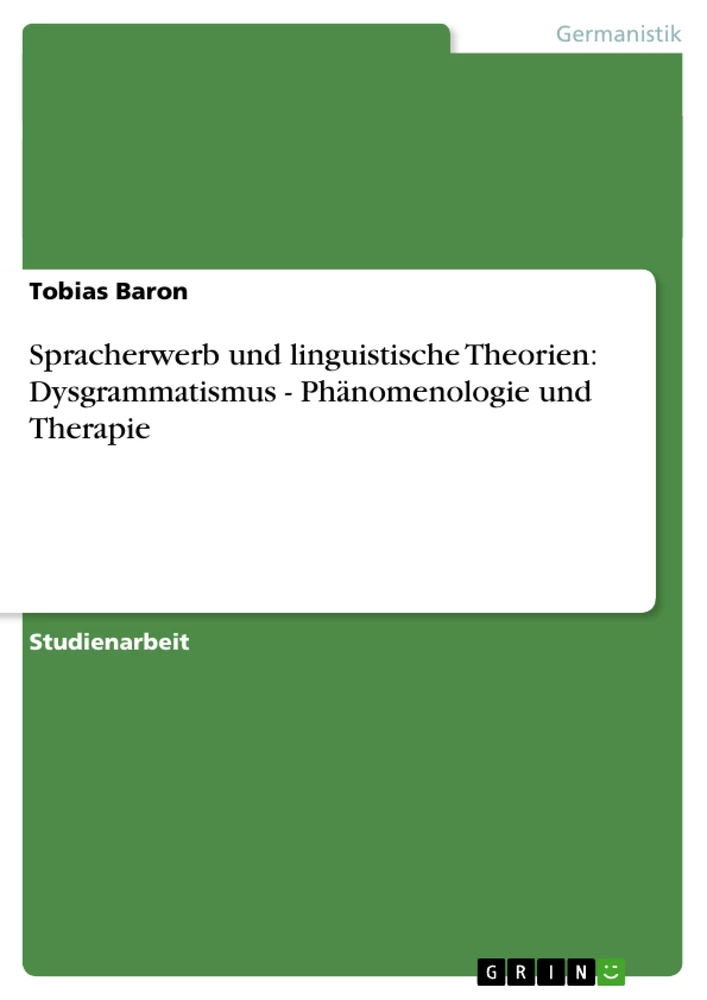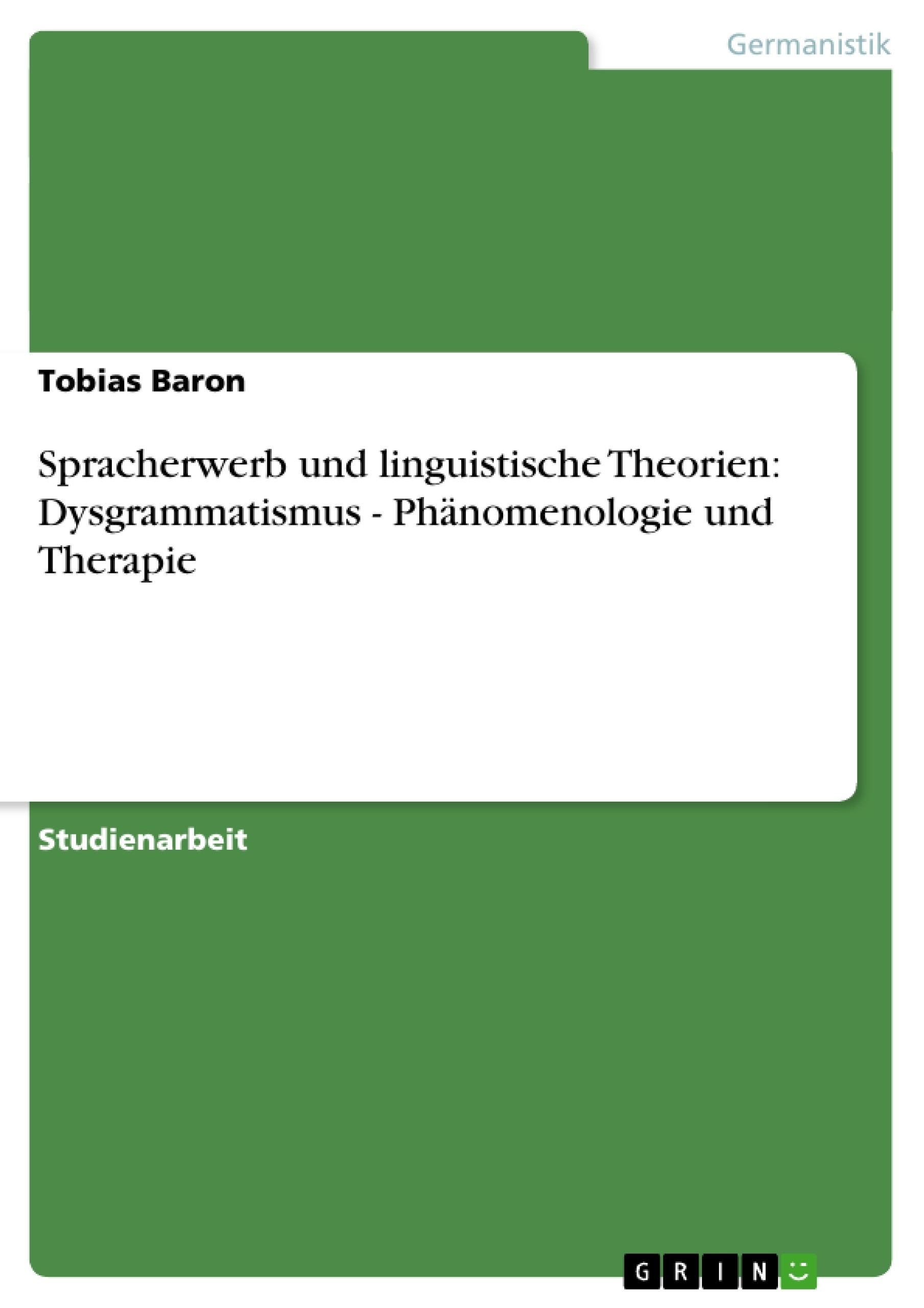Bei den Literaturrecherchen für mein Referat über >Dysgrammatismus< wurde ich mit dreierlei Sachverhalten konfrontiert, die für die (sprach)wissenschaftliche Auseinandersetzung und Diskussion innerhalb des Seminars von großer Wichtigkeit sind: i) keine einheitliche Terminologie; ii) unterschiedliche Phänomenologie sowie iii) unterschiedliche Therapieformen. Und auf die ich deshalb hier (wie im mündlichen Vortrag bereits referiert!) kurz eingehen werde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Beschreibung des Erscheinungsbildes
- 1.1 Grundmuster für die dysphasische Sprache
- 2. Sprachtherapeutische Implikationen
- 2.1 Digitale Medien als Strukturierungshilfen
- 2.2 Die Entwicklungsproximale Sprachtherapie
- 3. Gedanken zum Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Dysgrammatismus bei Kindern. Ziel ist es, die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Definitionen des Dysgrammatismus in der sprachwissenschaftlichen und sprachtherapeutischen Literatur aufzuzeigen und verschiedene Therapieansätze zu beleuchten. Die Arbeit verzichtet auf abschließende Bewertungen oder Empfehlungen.
- Unterschiedliche Terminologien und Definitionen von Dysgrammatismus
- Vielfalt der Phänomenologie des Dysgrammatismus
- Unterschiedliche Therapieformen für Dysgrammatismus
- Grundmuster dysphasischer Sprache nach Clahsen und anderen Forschern
- Empirische Befunde zu Sprachentwicklung bei Kindern mit Dysgrammatismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Beschreibung des Erscheinungsbildes (sprachliche Phänomene): Dieses Kapitel befasst sich mit der heterogenen Verwendung von Terminologie im Umgang mit Dysgrammatismus. Es werden verschiedene Definitionen und Beschreibungen des Phänomens aus der Literatur vorgestellt, von „Entwicklungsdysphasie“ bis „Agrammatismus“, und verdeutlicht die Herausforderungen, die sich aus der mangelnden einheitlichen Terminologie ergeben. Weiterhin werden unterschiedliche Phänomenologien des Dysgrammatismus und die Entwicklung der Definitionen von Liebmann (1901) bis in die 1980er Jahre diskutiert, wobei die Arbeiten von Knura und Dannenbauer hervorgehoben werden. Schließlich werden die unterschiedlichen Therapieansätze, grob eingeteilt in spezifische und unspezifische Therapien, angesprochen.
1.1 Grundmuster für die dysphasische Sprache: Dieses Kapitel befasst sich mit den Forschungsfragen zur dysgrammatischen Sprache: Wie spricht ein dysgrammatisches Kind? Wann kann von Dysgrammatismus gesprochen werden? Welche Verbindungen zu anderen Entwicklungspsychologischen Theorien existieren? Ein zentraler Punkt ist die Feststellung, dass Dysgrammatiker keine homogene Gruppe bilden. Die Arbeit von Clahsen wird zitiert, der argumentiert, dass Kinder mit Dysgrammatismus keine bizarren, sondern universelle Sprachgrammatiken entwickeln. Anhand von Beispielen wird die Störung der Wahrnehmungsorganisation und der Zerlegung und Bündelung von Sprache verdeutlicht. Die Untersuchungen von Kany und Kaltenbacher sowie Schöler, Dalbert und Schäle werden vorgestellt, die empirisch belegte Phänomene wie das Auslassen obligatorischer Wörter, häufigeres Auftreten der Satzstellung S-O-V, fehlerhafte Wortbeugung und Probleme mit der Verb-Zweitstellung und der morphologischen Markierung von Subjekt und Verb aufzeigen.
Schlüsselwörter
Dysgrammatismus, Sprachentwicklungsstörung, Sprachtherapie, Entwicklungsdysphasie, Agrammatismus, Linguistik, Phänomenologie, Therapieformen, Sprachentwicklung, Morphologie, Syntax, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung des Dysgrammatismus bei Kindern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Dysgrammatismus bei Kindern. Sie beleuchtet verschiedene Betrachtungsweisen und Definitionen von Dysgrammatismus aus sprachwissenschaftlicher und sprachtherapeutischer Literatur und analysiert verschiedene Therapieansätze. Die Arbeit enthält keine abschließenden Bewertungen oder Empfehlungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unterschiedliche Terminologien und Definitionen von Dysgrammatismus, die Vielfalt der Phänomenologie des Dysgrammatismus, verschiedene Therapieformen, Grundmuster dysphasischer Sprache nach Clahsen und anderen Forschern sowie empirische Befunde zur Sprachentwicklung bei Kindern mit Dysgrammatismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 beschreibt das Erscheinungsbild des Dysgrammatismus (sprachliche Phänomene), inklusive der heterogenen Terminologie und unterschiedlicher Definitionen des Phänomens. Kapitel 1.1 befasst sich mit den Grundmustern dysphasischer Sprache, den Forschungsfragen dazu und der Arbeit von Clahsen. Kapitel 2 behandelt sprachtherapeutische Implikationen, Kapitel 3 enthält abschließende Gedanken.
Welche zentralen Aspekte werden im Kapitel "Beschreibung des Erscheinungsbildes" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die heterogene Verwendung der Terminologie rund um Dysgrammatismus, stellt verschiedene Definitionen und Beschreibungen vor (von „Entwicklungsdysphasie“ bis „Agrammatismus“) und diskutiert die daraus resultierenden Herausforderungen. Es werden unterschiedliche Phänomenologien des Dysgrammatismus und die Entwicklung der Definitionen von Liebmann (1901) bis in die 1980er Jahre diskutiert (mit Fokus auf Knura und Dannenbauer), sowie verschiedene Therapieansätze (spezifische und unspezifische).
Was sind die Kernaussagen von Kapitel 1.1 "Grundmuster für die dysphasische Sprache"?
Dieses Kapitel untersucht die Forschungsfragen zur dysgrammatischen Sprache (Wie spricht ein dysgrammatisches Kind? Wann liegt Dysgrammatismus vor? Welche Verbindungen zu anderen Theorien bestehen?). Es betont, dass Dysgrammatiker keine homogene Gruppe sind und bezieht sich auf Clahsens Argumentation, dass Kinder mit Dysgrammatismus keine bizarren, sondern universelle Sprachgrammatiken entwickeln. Anhand von Beispielen werden Störungen der Wahrnehmungsorganisation und der Zerlegung/Bündelung von Sprache verdeutlicht. Die Arbeiten von Kany und Kaltenbacher sowie Schöler, Dalbert und Schäle mit empirisch belegten Phänomenen (Auslassen obligatorischer Wörter, S-O-V-Stellung, fehlerhafte Wortbeugung etc.) werden vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Dysgrammatismus, Sprachentwicklungsstörung, Sprachtherapie, Entwicklungsdysphasie, Agrammatismus, Linguistik, Phänomenologie, Therapieformen, Sprachentwicklung, Morphologie, Syntax und empirische Forschung.
Welche Therapieansätze werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt verschiedene Therapieansätze für Dysgrammatismus, wobei eine grobe Einteilung in spezifische und unspezifische Therapien vorgenommen wird. Konkrete Therapiemethoden werden jedoch nicht detailliert beschrieben.
- Citar trabajo
- Gesamtschullehrer Tobias Baron (Autor), 2004, Spracherwerb und linguistische Theorien: Dysgrammatismus - Phänomenologie und Therapie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32682