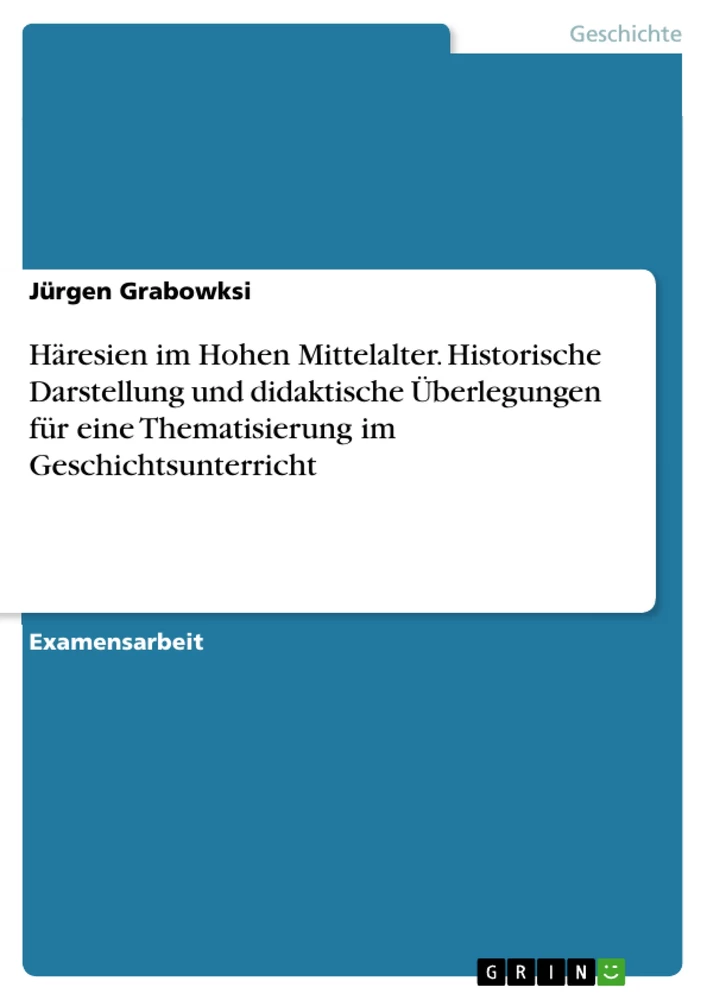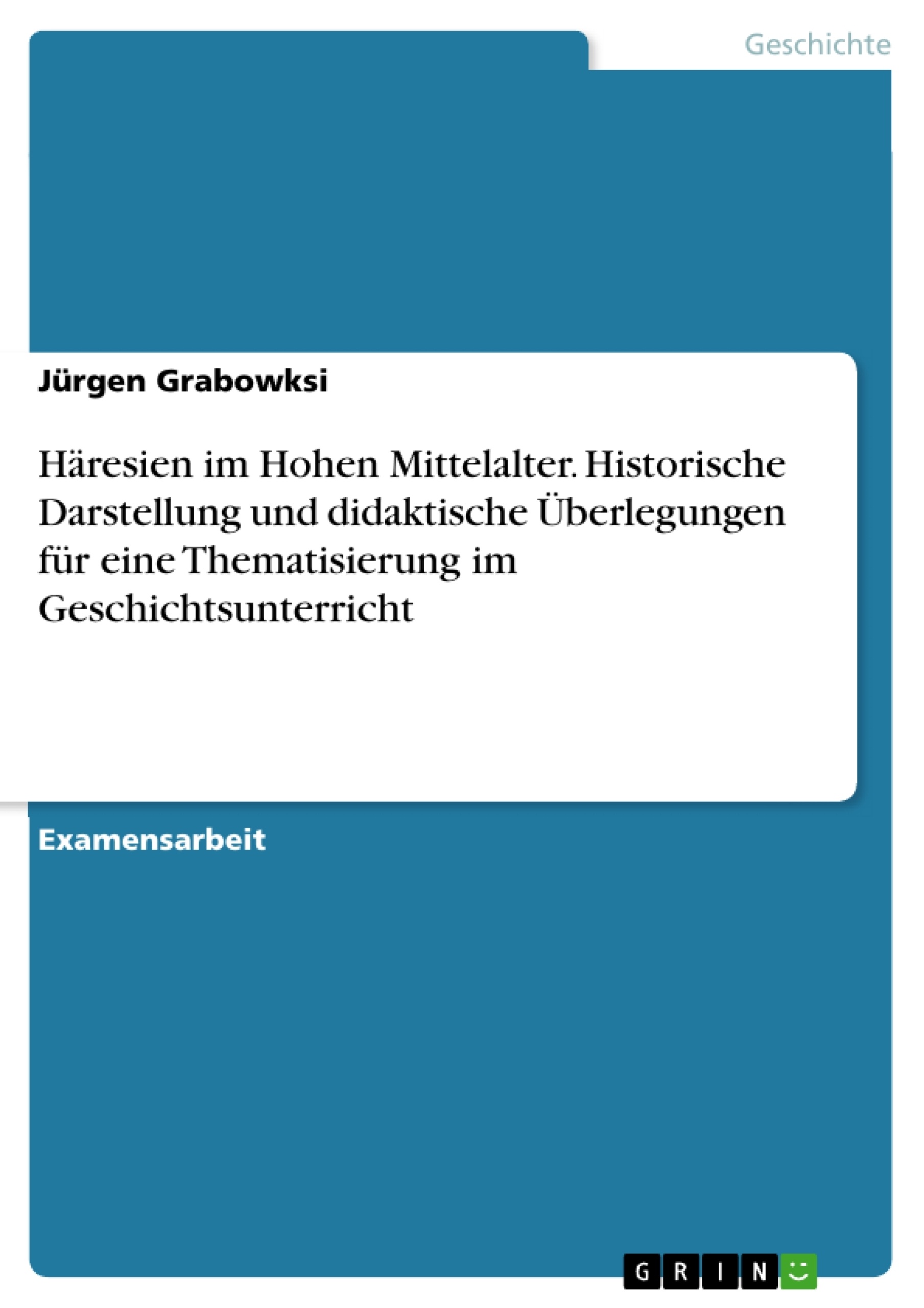Einleitung
Der Begriff Ketzer ist auch heute noch eine gängige Bezeichnung für Personen, die von einer herrschenden Meinung abweichen. Daß dieser Begriff aus dem Mittelalter stammt, ist dabei weitgehend bekannt, assoziiert man mit ihm doch auch diese finstere Zeit, in der solche Abweichler noch von der Kirche verurteilt und verbrannt wurden. Neben den weiteren Schlagwörtern die man damit verbindet, wie etwa Inquisition, Scheiterhaufen oder Hexenverfolgung, wobei man häufig vergißt, daß das klassische Zeitalter der Hexenjagden in Europa erst 1430 begann und noch bis 1780 reichte, kommen einem schließlich auch die positiven Bestandteile dieses Begriffs in den Sinn. Man denkt an Menschen wie Galileo Galilei (1564-1642)(1), die dazu beitrugen, daß sich die Wissenschaft gegenüber „mittelalterlichem“ und „einfältigem“ Denken durchsetzte, und somit der Rationalität und der Logik den Weg ebneten, welche schließlich zu den Errungenschaften der modernen Zivilisation führten.
Die vorliegende Arbeit befaßt sich aber nicht mit jenen Ketzern des Spätmittelalters oder der frühen Neuzeit, sondern mit den weitaus weniger bekannten Häresien des hohen Mittelalters. Dabei soll eine Auseinandersetzung mit diesen früheren Ketzern keineswegs dazu beitragen, die Wurzeln neuzeitlicher Genialität um einige Jahrhunderte zurückzuverlegen. Gerade im Gegenteil kann die Beschäftigung mit diesen Menschen eventuell dazu verhelfen, mittelalterliches Denken und Handeln besser zu verstehen, um dadurch Vorurteile gegen diese Epoche abzubauen und darüber hinaus ein kritischeres Verhältnis zur eigenen Gegenwart aufzubauen.
Es geht aber nicht nur um eine mögliche Widerlegung vorgefertigter Geschichtsbilder heutiger Zeit. Gerade auch in Hinsicht auf die traurige, fast zeitlose Aktualität der Begriffe Intoleranz, Verfolgung und Unterdrückung von Minderheiten lohnt sich die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden und Verfolgten in vergangenen Zeiten, da damit aus einer unbeteiligten Beobachterposition möglicherweise Erkenntnisse gewonnen werden, die helfen können, Probleme der Gegenwart zu lösen.
[...]
______
1 Bedeutender italienischer Physiker und Astronom, der sich für die Lehre des Nikolaus Kopernikus (1473-1543) einsetze, daß sich die Erde um die Sonne bewege. Geriet dadurch in Widerspruch zur katholischen Kirche und mußte seine Anschauungen gegen besseres Wissen widerrufen. Erst 1983 wurde das Fehlurteil von Rom aufgehoben.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- I. FACHWISSENSCHAFTLICHER TEIL
- 1. HÄRESIEN IM HOHEN MITTELALTER
- 1.1. Begriffserklärung Ketzerei/Häresie
- 1.2. Forschungsstand und Quellenlage
- 1.2.1. Zur Forschung
- 1.2.2. Zu den Quellen
- 2. DIE HÄRESIEN IM ÜBERBLICK
- 2.1. Häresien des 11. Jahrhunderts
- 2.2. Wiederaufleben im 12. Jahrhundert
- 2.3. Die Waldenser
- 2.4. Die Katharer
- 3. ERKLÄRUNGSVERSUCHE
- 3.1. Marxistische Interpretation
- 3.2. Bürgerliche Deutung
- 3.3. Gesellschaft und Kirche im hohen Mittelalter
- 4. REAKTIONEN DER KIRCHE
- 4.1. Bettelorden
- II. DIDAKTISCHER TEIL
- 1. MITTELALTER IM GESCHICHTSUNTERRICHT
- 1.1. Ziele des Geschichtsunterrichts
- 1.2. Warum Mittelalter? Prüfung eines historischen Gegenstandes
- 2. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN FÜR EINE THEMATISIERUNG IM UNTERRICHT
- 2.1. Was kann eine Unterrichtseinheit Ketzer im hohen Mittelalter leisten?
- 2.2. Vorschläge zur Umsetzung
- SCHLUBBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Häresien des hohen Mittelalters, sowohl historisch als auch unter didaktischen Gesichtspunkten für den Geschichtsunterricht. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dieser Phänomene zu entwickeln und deren Relevanz für den Unterricht aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die historischen Hintergründe, die verschiedenen Häresiebewegungen und die Reaktionen der Kirche darauf.
- Definition und historische Einordnung von Ketzerei/Häresie
- Analyse verschiedener Häresiebewegungen des 11. und 12. Jahrhunderts
- Untersuchung gesellschaftlicher und kirchlicher Faktoren, die zum Aufkommen von Häresien beitrugen
- Die Reaktion der Kirche auf Häresien (Inquisition, Bettelorden)
- Didaktische Überlegungen zur Thematisierung von Häresien im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie den Begriff „Ketzer“ in seinen historischen und modernen Kontexten beleuchtet. Sie betont die Bedeutung des Verständnisses mittelalterlichen Denkens und Handelns sowie die Aktualität von Intoleranz und Verfolgung. Die Arbeit gliedert sich in einen fachwissenschaftlichen und einen fachdidaktischen Teil.
1. HÄRESIEN IM HOHEN MITTELALTER: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Häresie“ und beleuchtet den Forschungsstand und die Quellenlage zur Erforschung mittelalterlicher Häresien. Es legt die Grundlage für die anschließende detaillierte Betrachtung verschiedener Häresiebewegungen.
2. DIE HÄRESIEN IM ÜBERBLICK: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über verschiedene Häresiebewegungen des 11. und 12. Jahrhunderts, wie die Bewegungen um Leuthard, Tanchelm, Peter von Bruis und Arnold von Brescia, sowie die Waldenser und Katharer. Es werden die jeweiligen Lehren, Organisationen und Verfolgungen beschrieben.
3. ERKLÄRUNGSVERSUCHE: In diesem Kapitel werden verschiedene Erklärungsansätze für das Aufkommen von Häresien im hohen Mittelalter vorgestellt und kritisch bewertet. Es werden marxistische, bürgerliche und sozialgeschichtliche Interpretationen diskutiert, die den Kontext von Gesellschaft und Kirche im hohen Mittelalter beleuchten.
4. REAKTIONEN DER KIRCHE: Dieses Kapitel behandelt die Reaktionen der Kirche auf die Häresien, insbesondere die Rolle der Bettelorden (Dominikaner und Franziskaner) und der Inquisition in der Bekämpfung der Häresien.
1. MITTELALTER IM GESCHICHTSUNTERRICHT: Dieses Kapitel befasst sich mit den Zielen des Geschichtsunterrichts und der Bedeutung des Mittelalters als Unterrichtsgegenstand. Es beleuchtet die Relevanz des Themas für Schüler und Schülerinnen und die Herausforderungen bei der Vermittlung.
2. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN FÜR EINE THEMATISIERUNG IM UNTERRICHT: In diesem Abschnitt werden didaktische Überlegungen zur Gestaltung einer Unterrichtseinheit zu Häresien im hohen Mittelalter angestellt. Es werden Möglichkeiten zur Vermittlung des Stoffes und zur Förderung des kritischen Denkens der Schüler und Schülerinnen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Häresie, Ketzerei, hohes Mittelalter, Waldenser, Katharer, Inquisition, Bettelorden, Geschichtsunterricht, Didaktik, Mittelalterliche Gesellschaft, Religiosität, Intoleranz, Verfolgung.
Häufige Fragen zu: Häresien im Hohen Mittelalter - Eine fachwissenschaftliche und fachdidaktische Untersuchung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Häresien des hohen Mittelalters aus zwei Perspektiven: fachwissenschaftlich (historische Hintergründe, verschiedene Häresiebewegungen und Reaktionen der Kirche) und fachdidaktisch (geeignete Unterrichtsmethoden für die Vermittlung dieses Themas im Geschichtsunterricht).
Welche Häresiebewegungen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Häresiebewegungen des 11. und 12. Jahrhunderts, darunter die Bewegungen um Leuthard, Tanchelm, Peter von Bruis und Arnold von Brescia, sowie die Waldenser und Katharer. Es werden deren Lehren, Organisationen und Verfolgungen beschrieben.
Wie wird der Begriff „Häresie“ definiert?
Das Dokument definiert den Begriff „Häresie“ und beleuchtet den Forschungsstand und die Quellenlage zur Erforschung mittelalterlicher Häresien. Es wird ein Verständnis des Begriffs im historischen Kontext geschaffen.
Welche Erklärungsansätze für das Aufkommen von Häresien werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und bewertet kritisch verschiedene Erklärungsansätze, darunter marxistische, bürgerliche und sozialgeschichtliche Interpretationen, um den Kontext von Gesellschaft und Kirche im hohen Mittelalter zu beleuchten.
Welche Rolle spielte die Kirche in Bezug auf die Häresien?
Die Arbeit beschreibt die Reaktionen der Kirche auf die Häresien, insbesondere die Rolle der Bettelorden (Dominikaner und Franziskaner) und der Inquisition bei der Bekämpfung der Häresien.
Wie kann das Thema Häresien im Geschichtsunterricht behandelt werden?
Der fachdidaktische Teil der Arbeit bietet didaktische Überlegungen zur Gestaltung einer Unterrichtseinheit zu Häresien im hohen Mittelalter. Es werden Möglichkeiten zur Vermittlung des Stoffes und zur Förderung des kritischen Denkens der Schüler und Schülerinnen aufgezeigt. Die Ziele des Geschichtsunterrichts und die Relevanz des Mittelalters als Unterrichtsgegenstand werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Häresie, Ketzerei, hohes Mittelalter, Waldenser, Katharer, Inquisition, Bettelorden, Geschichtsunterricht, Didaktik, Mittelalterliche Gesellschaft, Religiosität, Intoleranz, Verfolgung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen fachwissenschaftlichen Teil (mit Kapiteln zu Häresien im Hohen Mittelalter, Überblick über Häresiebewegungen, Erklärungsversuche und Reaktionen der Kirche) und einen fachdidaktischen Teil (mit Kapiteln zum Mittelalter im Geschichtsunterricht und didaktischen Überlegungen zur Thematisierung im Unterricht), sowie eine Schlussbetrachtung.
- Citation du texte
- Jürgen Grabowksi (Auteur), 2001, Häresien im Hohen Mittelalter. Historische Darstellung und didaktische Überlegungen für eine Thematisierung im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3273