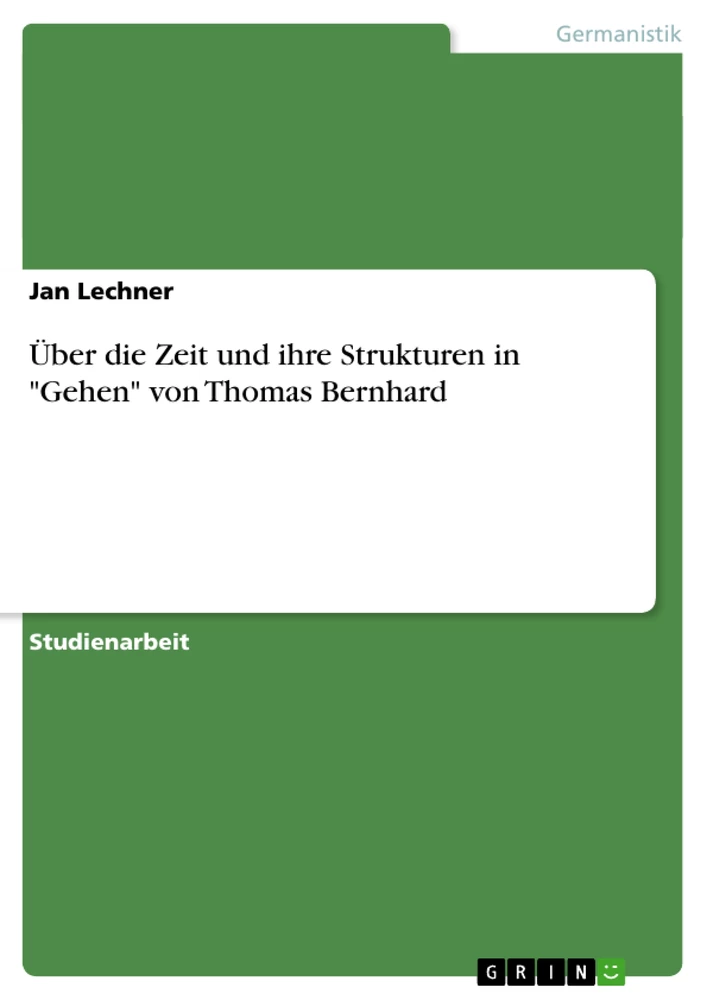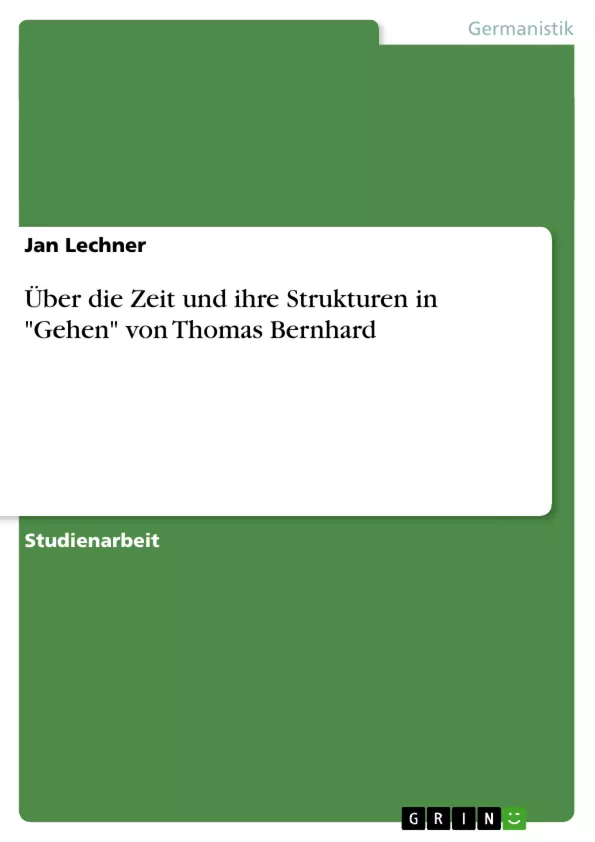"Die Erzählung", so konstatierte schon Thomas Mann in seinem Roman „Der Zauberberg“, "hat zweierlei Zeit: ihre eigene erstens, die musikalisch-reale, die ihren Ablauf, ihre Erscheinung bedingt; zweitens aber die ihres Inhalts, die perspektivisch ist, und zwar in so verschiedenem Maße, daß die imaginäre Zeit der Erzählung fast, ja völlig mit ihrer musikalischen zusammenfallen, sich aber auch sternenweit von ihr entfernen kann." Und während die musikalisch-reale Zeit individuell und subjektiv ist und so nur bedingt zum Thema analytischer Arbeit werden kann, ist zumindest die Betrachtung der imaginären Zeit der Erzählung auch unter streng wissenschaftlichen Maßstäben möglich. Jeder Text, der nicht nur eine bloße Zustandsbeschreibung ist, schildert einen Verlauf, eine Zeitspanne zwischen zwei Punkten und wird so zu einer Erzählung. Normalerweise wird Zeitlichkeit über konkrete Begriffe der Zeit transportiert, entweder durch die Verwendung von Temporalwörtern, oder die bildliche Beschreibung wachsender und fortschreitender Prozesse. Wenn Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Verlauf nimmt, wird der entstehende Fortschritt auf der Zeitlinie gekennzeichnet.
Eine Erzählung, die frei von Begrifflichkeiten bleibt, die einen konkreten Zeitbezug haben, muss Zeitlichkeit über andere Wege vermitteln. „Gehen“ von Thomas Bernhard ist ein Text, dem eben jene genannten direkten Zugriffe auf die ihm inne wohnende Zeitlichkeit fehlen und sich einer Analyse unter diesem Gesichtspunkt zu entziehen scheint. Dass sich aber trotzdem Möglichkeiten für eine solche Interpretation bieten, will diese Arbeit zeigen. Dabei sollen die Begriffe, die von Gérard Genette in seinem Werk „Die Erzählung“ definiert wurden, die Funktion übernehmen, den Bezug zu einer anerkannten Zeitlichkeitstheorie zu stellen. Gerade weil eine strikte Analyse nach den Maßstäben von Genette aber scheitern muss, dient dieser Bezug mehr dazu sich definierter und bekannter Begrifflichkeiten bedienen zu können. Diese Arbeit versucht den zeitlichen Rahmen der Erzählung herauszuarbeiten, um damit ein Instrumentarium zu liefern, über das dann grundsätzliche Angaben zur erzählten Zeit gemacht werden können. Dabei soll die Entwicklung, die im Mittelpunkt von „Gehen“ steht, auf ihren linearen Ablauf hin geprüft werden und nach Hinweisen gesucht werden, die eine genauere zeitliche Ordnung des Geschehens ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Zugang zur Zeitlichkeit
- Ebenen der zeitlichen Staffelungen
- Der Standpunkt des Erzählers
- Der Ursprung des Gesprächs
- Die Unmittelbarkeit des Geschehens
- Bewegung als Ausdruck von Zeit
- Die Wiederholung als Takt
- Die Unterbrechung der Bewegung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Zeit und ihren Strukturen in Thomas Bernhards „Gehen“. Das Hauptziel ist es, die komplexen zeitlichen Ebenen und narrative Strategien des Textes zu analysieren und ein Instrumentarium zur Bestimmung des zeitlichen Rahmens zu entwickeln. Die Arbeit konzentriert sich auf die Herausarbeitung der zeitlichen Ordnung des Geschehens trotz des scheinbar fehlenden direkten Zugriffs auf Zeitangaben im Text.
- Analyse der verschiedenen Erzählebenen und deren Einfluss auf die Zeitgestaltung
- Untersuchung der Rolle von Wiederholung und Unterbrechung in der Konstruktion der Zeitlichkeit
- Interpretation der Bewegung als Ausdruck von Zeit im Kontext des Spaziergangs
- Differenzierung zwischen erzählter Zeit und der Zeit des Erzählens
- Anwendung von Gérard Genettes Zeitlichkeitstheorie auf Bernhards Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Zeitdarstellung in literarischen Texten ein, unter Bezugnahme auf Thomas Mann und seine Unterscheidung zwischen „musikalisch-realer“ und „imaginärer“ Zeit. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Analyse der Zeitlichkeit in Bernhards „Gehen“, welches sich durch den Mangel an expliziten Zeitangaben auszeichnet. Die Arbeit kündigt an, die zeitlichen Ebenen des Textes zu untersuchen und ein Modell zur Bestimmung der zeitlichen Ordnung zu entwickeln, wobei die Konzepte von Gérard Genette als Bezugspunkt dienen sollen.
2. Der Zugang zur Zeitlichkeit: Dieses Kapitel analysiert den erschwerten Zugang zur Zeitlichkeit in Bernhards „Gehen“ aufgrund der verschiedenen Erzählebenen und der sparsamen Verwendung von expliziten Zeitangaben. Es beschreibt die narrative Struktur, die durch die verschachtelten Gespräche zwischen dem Ich-Erzähler, Oehler und Karrer gekennzeichnet ist, und die eine eindeutige zeitliche Zuordnung der Ereignisse erschwert. Die iterative Struktur und die verschiedenen Perspektiven verschwimmen die zeitlichen Grenzen der Handlung.
2.1. Ebenen der zeitlichen Staffelung: Dieser Abschnitt fokussiert auf das Prinzip der iterativen Hintereinanderschaltung von Äußerungen in verschiedenen Erzählebenen, welches die Komplexität der Zeitgestaltung in „Gehen“ verdeutlicht. Durch die Verschachtelung der Erzählperspektiven und das häufige Zitieren innerhalb der Gespräche wird die erzählte Zeit erheblich erweitert. Die Analyse betont die Notwendigkeit, zwischen den verschiedenen Ebenen zu differenzieren und von unterschiedlichen Zeitrahmen auszugehen, um Aussagen über die erzählte Zeit treffen zu können. Das Beispiel des im Bett liegenden Karrers am Ende der Erzählung wird als Illustration der zeitlichen Differenzierung zwischen den Ebenen angeführt.
3. Die Unmittelbarkeit des Geschehens: [Summary would go here. This section needs to be created based on the provided text.]
4. Bewegung als Ausdruck von Zeit: [Summary would go here. This section needs to be created based on the provided text.]
4.1. Die Wiederholung als Takt: [Summary would go here. This section needs to be created based on the provided text.]
4.2. Die Unterbrechung der Bewegung: [Summary would go here. This section needs to be created based on the provided text.]
Schlüsselwörter
Thomas Bernhard, Gehen, Zeitdarstellung, Erzählebenen, iterative Struktur, Zeitlichkeit, narrative Strategien, Wiederholung, Unterbrechung, Spaziergang, Gérard Genette.
Häufig gestellte Fragen zu Thomas Bernhards "Gehen" - Zeitstrukturen und Erzähltechnik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Darstellung von Zeit und ihren Strukturen in Thomas Bernhards Roman "Gehen". Der Fokus liegt auf der Untersuchung der komplexen zeitlichen Ebenen und narrativen Strategien des Textes, insbesondere angesichts des scheinbar fehlenden direkten Zugriffs auf Zeitangaben im Text.
Welche Ziele verfolgt die Analyse?
Das Hauptziel ist die Analyse der komplexen zeitlichen Ebenen und narrativen Strategien in "Gehen". Die Arbeit möchte ein Instrumentarium zur Bestimmung des zeitlichen Rahmens entwickeln und die zeitliche Ordnung des Geschehens trotz des Mangels an expliziten Zeitangaben herausarbeiten. Dabei werden verschiedene Erzählebenen, die Rolle von Wiederholung und Unterbrechung sowie die Bewegung als Ausdruck von Zeit untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der verschiedenen Erzählebenen und deren Einfluss auf die Zeitgestaltung, die Untersuchung der Rolle von Wiederholung und Unterbrechung in der Konstruktion der Zeitlichkeit, die Interpretation der Bewegung als Ausdruck von Zeit im Kontext des Spaziergangs, die Differenzierung zwischen erzählter Zeit und der Zeit des Erzählens und die Anwendung von Gérard Genettes Zeitlichkeitstheorie auf Bernhards Werk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Zugang zur Zeitlichkeit (inkl. Ebenen der zeitlichen Staffelung), zur Unmittelbarkeit des Geschehens, zur Bewegung als Ausdruck von Zeit (inkl. Wiederholung als Takt und Unterbrechung der Bewegung) und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte der Zeitdarstellung in "Gehen".
Wie wird der erschwerte Zugang zur Zeitlichkeit in "Gehen" beschrieben?
Der erschwerte Zugang zur Zeitlichkeit resultiert aus den verschiedenen Erzählebenen und der sparsamen Verwendung expliziter Zeitangaben. Die verschachtelten Gespräche zwischen den Figuren erschweren eine eindeutige zeitliche Zuordnung der Ereignisse. Die iterative Struktur und verschiedenen Perspektiven verschwimmen die zeitlichen Grenzen der Handlung.
Welche Rolle spielen Wiederholung und Unterbrechung?
Wiederholung und Unterbrechung spielen eine zentrale Rolle in der Konstruktion der Zeitlichkeit. Die Wiederholung wirkt wie ein Taktgeber, während Unterbrechungen die lineare Zeitabfolge stören und die Komplexität der Zeitgestaltung unterstreichen. Die Analyse untersucht, wie diese Elemente zur Gestaltung der Zeitlichkeit beitragen.
Welche Bedeutung hat die Bewegung im Roman?
Die Bewegung, insbesondere der Spaziergang, wird als Ausdruck von Zeit interpretiert. Die Analyse untersucht, wie die Bewegung die zeitliche Struktur des Romans beeinflusst und mit den anderen Aspekten der Zeitgestaltung zusammenhängt.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Gérard Genettes Zeitlichkeitstheorie und verwendet diese als analytisches Instrument zur Untersuchung der Zeitstrukturen in "Gehen". Zusätzlich wird auf Thomas Manns Unterscheidung zwischen „musikalisch-realer“ und „imaginärer“ Zeit Bezug genommen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas Bernhard, Gehen, Zeitdarstellung, Erzählebenen, iterative Struktur, Zeitlichkeit, narrative Strategien, Wiederholung, Unterbrechung, Spaziergang, Gérard Genette.
- Citation du texte
- Jan Lechner (Auteur), 2004, Über die Zeit und ihre Strukturen in "Gehen" von Thomas Bernhard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32994