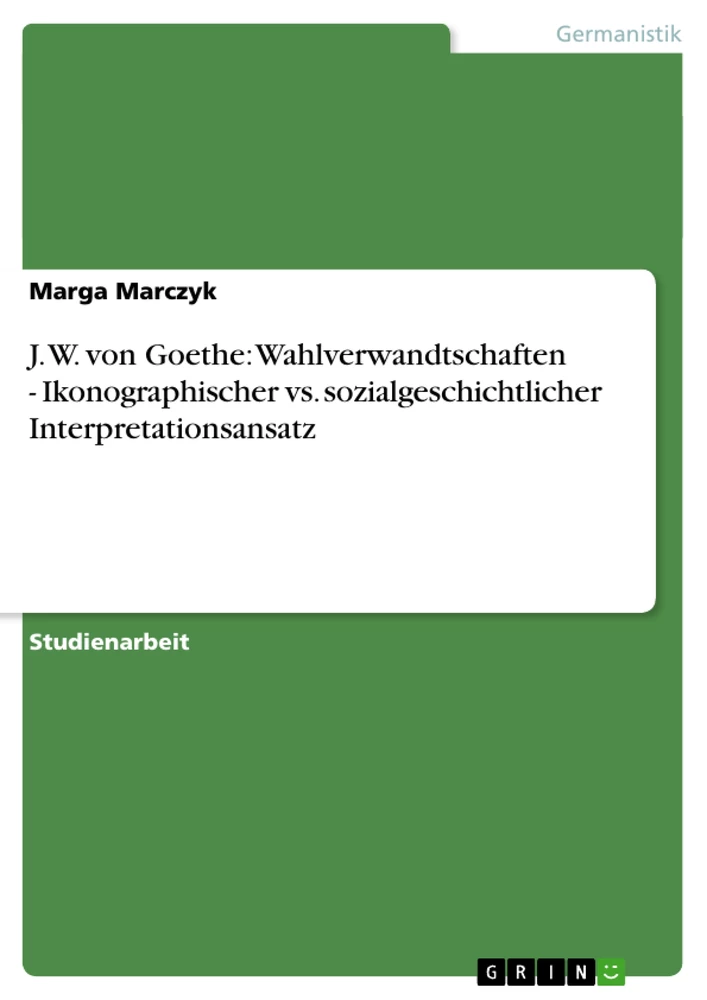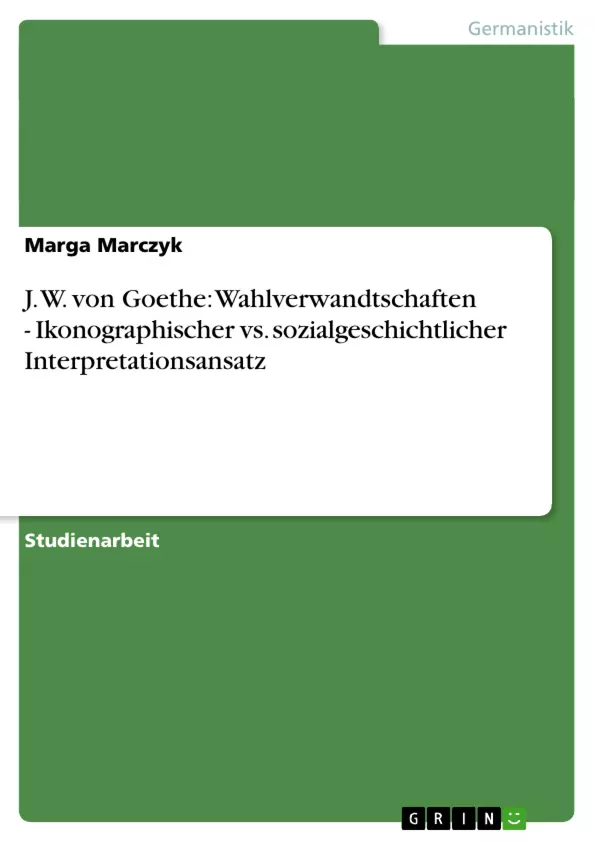Ursprünglich plante Goethe den Roman „Die Wahlverwandtschaften“1 nicht als eigenständiges Werk. „Die Wahlverwandtschaften“ sollten lediglich als Novelle in „Wilhelm Meisters Wanderjahren“ vorkommen. Doch die Novelle gewann dermaßen an Ausmaß, dass Goethe sich schließlich entschloss, sie als einen von „Wilhelm Meisters Wanderjahren“ unabhängigen Roman zu gestalten. „Die Wahlverwandtschaften“ erschienen nach mindestens über einjähriger Arbeit (der erste Beleg datiert auf den 1. 5. 1808) im Herbst des Jahres 1809. Tatsächlich erweist sich der Roman als so gehaltvoll und so vielschichtig, dass es kaum vorstellbar ist, dass seine Grundgedanken im Ursprung nur ein untergeordneter Teil eines anderen Werkes werden sollten.
Schon die Überschrift verweist auf einen naturwissenschaftlichen Kontext, in den der Roman eingebunden werden sollte. Das Hauptaugenmerk des Romans richtet sich auf das Leben der vier Protagonisten Eduard, Charlotte, Ottilie und Hauptmann und weist dem Roman die Funktion sowohl eines psychologischen Romans als auch eines Gesellschaftsromans zu, da alle Figuren in einem gesellschaftlichen Kontext agieren. Dies sind einige wenige, doch sehr verschiedene Aspekte des Romans, die nur beispielhaft seine Vielschichtigkeit darstellen sollen.
Ein so vielschichtiges Werk aber erfordert ebenso viele Methoden zu seiner Erschließung, denn mit einer Methode alleine ist es unmöglich, sein Bedeutungsspektrum auch nur annähernd zu erfassen. Im Folgenden werden zwei der zahlreichen Vorgehensweisen – eine ikonographische und eine sozialgeschichtliche – zur Erschließung des Romans vorgestellt und miteinander verglichen. Der Vergleich soll die Methoden darauf hin untersuchen, ob und inwiefern sie der Vielschichtigkeit des Romans gerecht werden. Dabei wird natürlich nicht außer Acht gelassen, dass keine Methode imstande ist, alle Ebenen des Romans zu eröffnen.
Inhaltsverzeichnis
- ,,DIE WAHLVERWANDTSCHAFTEN\" - EIN VIELSCHICHTIGES WERK
- DARSTELLUNG VON ZWEI DER ZAHLREICHEN METHODEN
- Buschendorfs ikonographischer Ansatz
- Vagets sozialgeschichtlicher Ansatz
- ANWENDUNG DER VORGESTELLTEN METHODEN AUF ZWEI DER ROMANFIGUREN
- Charlotte
- Mittler
- BUSCHENDORF VS. VAGET - VOR- UND NACHTEILE DER BEIDEN METHODEN
- Esoterische vs. exoterische Auffassung der „Wahlverwandtschaften“
- Formaler vs. inhaltlicher Zugang zu den „Wahlverwandtschaften“
- KONKLUSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“ und untersucht, wie verschiedene Interpretationsansätze die Vielschichtigkeit des Werkes erschließen können. Dabei werden zwei Methoden, der ikonographische Ansatz nach Buschendorf und der sozialgeschichtliche Ansatz nach Vaget, einander gegenübergestellt. Die Arbeit analysiert, ob und inwiefern diese Methoden der Komplexität des Romans gerecht werden und welche Vor- und Nachteile sie im Vergleich zueinander aufweisen.
- Die ikonographische Ebene der „Wahlverwandtschaften“
- Der Einfluss der Landschaftsmalerei und des Arkadiens
- Die Funktion der idealen Landschaft im Roman
- Der Roman als arkadisches Zwischenreich
- Der Vergleich von ikonographischem und sozialgeschichtlichem Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Buches stellt „Die Wahlverwandtschaften“ als ein vielschichtiges Werk vor, das sowohl als psychologischer als auch als Gesellschaftsroman gelesen werden kann. Es werden verschiedene Aspekte des Romans beleuchtet, die seine Vielschichtigkeit verdeutlichen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Buschendorfs ikonographischem Ansatz und erklärt den Begriff der „Ikonographie“. Es wird dargelegt, wie Buschendorf Motive aus der bildenden Kunst in den „Wahlverwandtschaften“ identifiziert und analog zur ikonographischen Deutung von Bildwerken interpretiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Vagets sozialgeschichtlichem Ansatz, der die „Wahlverwandtschaften“ in einen historischen Kontext einordnet und den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen auf die Romanfiguren untersucht.
Schlüsselwörter
„Wahlverwandtschaften“, Goethe, Ikonographie, Landschaftsmalerei, Arkadien, ideal Landschaft, sozialgeschichte, Gesellschaft, psychologischer Roman, Interpretationsansatz, Buschendorf, Vaget
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“?
Der Roman behandelt das Leben von vier Protagonisten, deren Beziehungen durch naturwissenschaftliche Analogien und gesellschaftliche Zwänge beeinflusst werden.
Was ist der ikonographische Interpretationsansatz nach Buschendorf?
Dieser Ansatz identifiziert Motive aus der bildenden Kunst im Roman und deutet sie analog zur ikonographischen Analyse von Gemälden.
Was untersucht der sozialgeschichtliche Ansatz nach Vaget?
Vaget ordnet den Roman in seinen historischen Kontext ein und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen auf das Handeln der Figuren.
Welche Bedeutung hat das „Arkadien“-Motiv im Roman?
Die ideale Landschaft fungiert als arkadisches Zwischenreich, in dem sich die Figuren fernab der Realität wähnen, was die Tragik des Geschehens verstärkt.
Wie wird die Figur des „Mittler“ in der Arbeit analysiert?
Die Figur wird mithilfe beider Methoden untersucht, um zu zeigen, wie unterschiedlich sein Handeln ikonographisch oder sozialgeschichtlich gedeutet werden kann.
- Citar trabajo
- M.A. Marga Marczyk (Autor), 2000, J. W. von Goethe: Wahlverwandtschaften - Ikonographischer vs. sozialgeschichtlicher Interpretationsansatz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32999