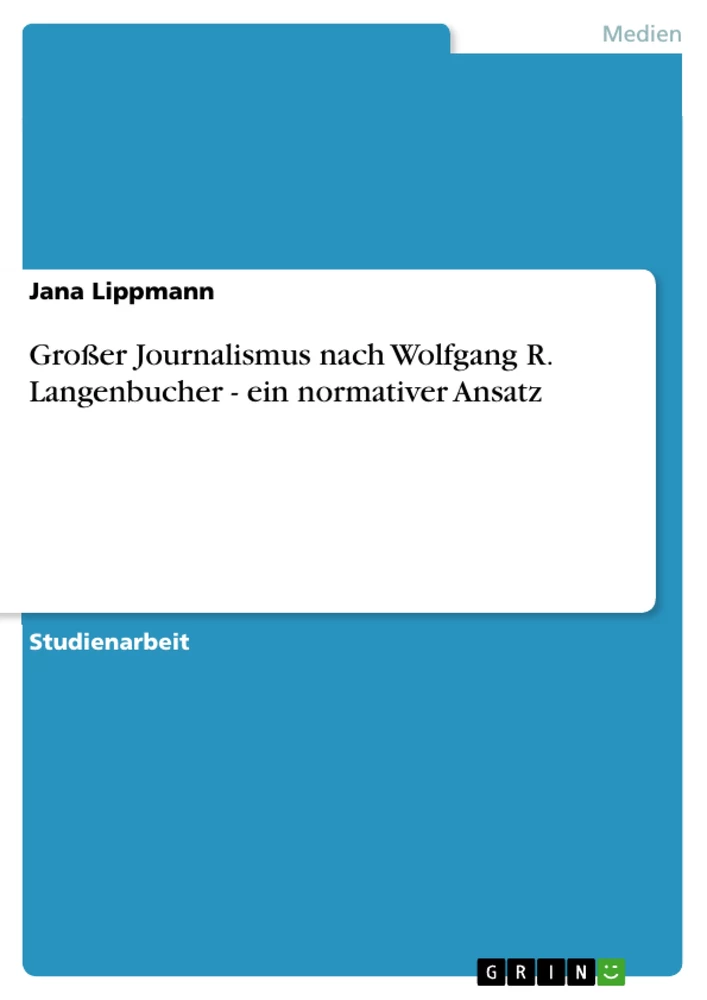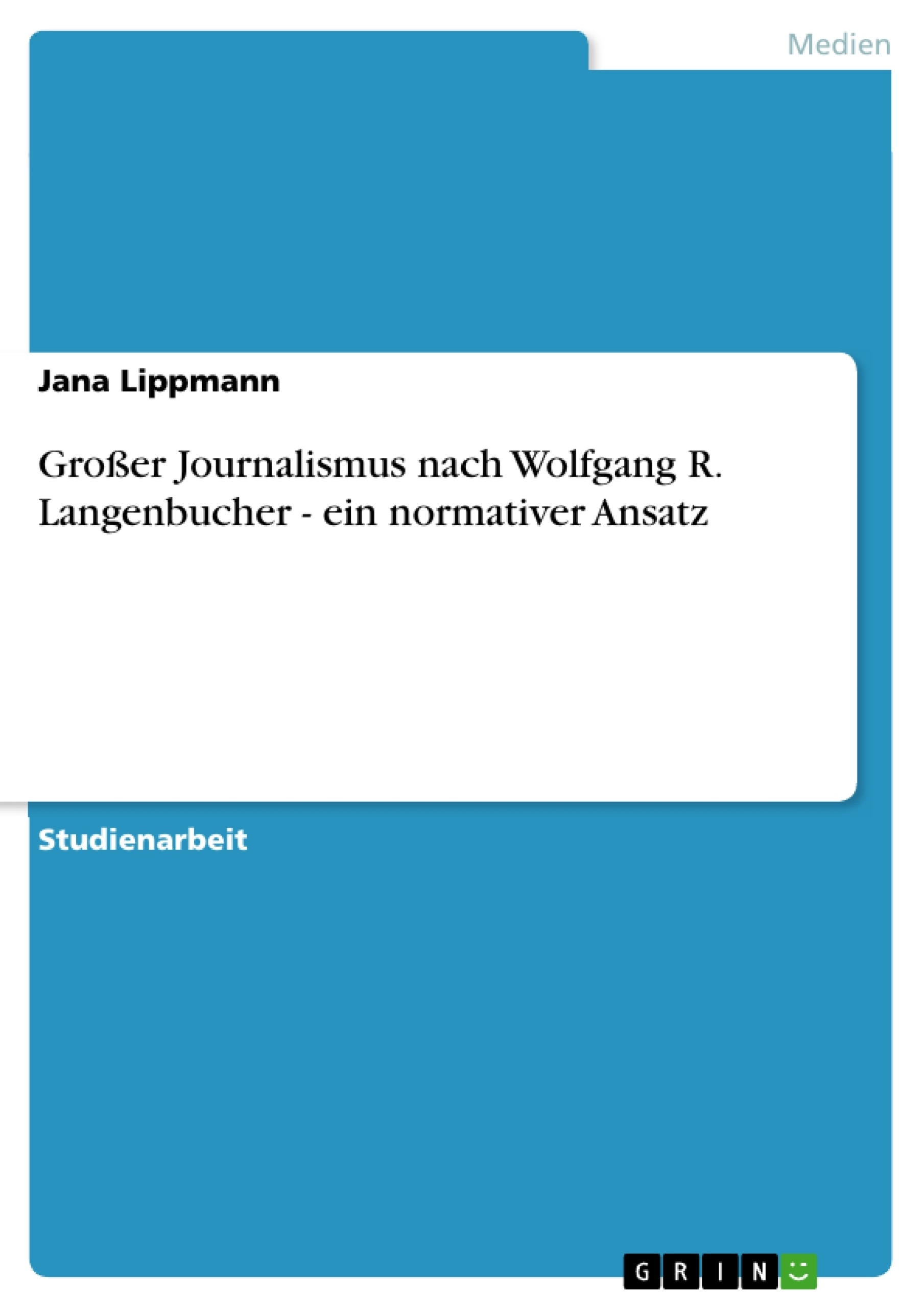Einleitung
Vor etwa drei Jahren erschien ein kleines Buch unter dem Titel: „Als das Schreiben noch geholfen hat“ – ein Sachbüchlein, das jenen Themen gewidmet ist, „die den Journalisten am meisten beschäftigen: das Verhältnis zwischen Journalismus und Politik, zwischen Medien und Kirche und über das Selbstverständnis der Medienmacher“ . Der Titel scheint an eine goldene Vorzeit zu erinnern, als Schriftsteller und (im hier zu betrachtenden Kontext) vor allem Journalisten durch ihr Wirken noch etwas an den gesellschaftlichen Gegebenheiten verändern konnten. Es sei beispielsweise an die 48er Revolution erinnert, als die an eine Hofberichterstattung gewöhnten Vertreter der politischen Klasse ihr Verständnis von medialer Kontrolle unter dem Aufbegehren einer kritischen Öffentlichkeit ändern mußten. Nicht zuletzt dem Druck der oppositionellen Presse ist es zu verdanken, daß bereits in den Grundrechten des deutschen Volkes, die 1848 durch das Paulskirchenparlament verkündet wurden, erstmals eine garantierte Pressefreiheit verankert wurde. Es folgte ein Jahrhundert des Kampfes zwischen Unterdrückung und Freiheit, in dem immer wieder die Presse zum Sprachrohr der oppositionellen Kräfte wurde. Wie sehr die Regierenden damals die Macht der Schreiber fürchteten, zeigt beispielsweise ein Ausspruch des französischen Feldherren Napoleon, der sagte: „Wenn ich der Presse die Zügel locker ließe, würde ich keine drei Monate im Besitz der Macht bleiben“ . Diese Befürchtung charakterisiert ein ganzes Jahrhundert des Verhältnisses zwischen Presse und Regierenden.
Heute erscheint die seitens des Staates garantierte Pressefreiheit als Selbstverständlichkeit. Gerade aus den erst 50 Jahre zurückliegenden Ereignissen heraus, wäre ein Grundgesetz ohne die in Artikel 5 verankerte Pressefreiheit undenkbar. „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten...“ heißt es dort, doch „Rechte ohne Ressourcen sind ein grausamer Scherz“ .
[...]
_____
1 Fleischhacker, Michael, Pirker Hoerst: Als das Schreiben noch geholfen hat, Köln, 1998.
2 Ebd., S. 9.
3 Hier zitiert nach: Jipp, Karl-Ernst: Medien, Mächte, Meinungen. Eine Sammlung von Zitaten über Medien und Gesellschaft,[...]
4 Rappaport, Anatol, hier zitieret nach: Funiok, Rüdiger, Schmälzle Udo F., Werth, Christoph H. (Hrsg.): Medienethik – die Frage der Verantwortung, Bonn 1999, S. 9.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Radikaldemokratischer Wandel der Öffentlichkeit und erwachende Risikosensibilität
- Handlungskonsequenzen für den Journalismus
- Mangel an journalistischer Qualität und Anklage einer fehlenden Forschungstradition
- Notwendiger Wandel zu einem großen und autonomen Journalismus
- Schlußbetrachtungen
- Literaturverzeichnis
- Anlage: Handout zum Referat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel des Journalismus in einer sich verändernden Gesellschaft. Sie analysiert die Auswirkungen der radikaldemokratischen Veränderungen der Öffentlichkeit auf den Journalismus und untersucht die damit verbundenen Herausforderungen für die Medienlandschaft. Im Vordergrund stehen die Auswirkungen der erwachenden Risikosensibilität auf die journalistische Arbeit und die Frage nach der notwendigen Entwicklung eines "großen" und autonomen Journalismus.
- Der Wandel der Öffentlichkeit und die Rolle des Journalismus
- Die Bedeutung der Risikosensibilität für den Journalismus
- Der Mangel an journalistischer Qualität
- Die Notwendigkeit eines autonomen Journalismus
- Der normativer Ansatz des Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Problematik des Journalismus in einer sich wandelnden Gesellschaft. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Journalismus und Politik, Medien und Kirche sowie dem Selbstverständnis der Medienmacher in den Mittelpunkt.
- Radikaldemokratischer Wandel der Öffentlichkeit und erwachende Risikosensibilität: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des radikaldemokratischen Wandels der Öffentlichkeit auf den Journalismus. Es beleuchtet die Bedeutung der erwachenden Risikosensibilität und ihre Auswirkungen auf die journalistische Arbeit.
- Handlungskonsequenzen für den Journalismus: In diesem Kapitel werden die Handlungskonsequenzen für den Journalismus im Kontext der sich verändernden Öffentlichkeit und der erwachenden Risikosensibilität analysiert.
- Mangel an journalistischer Qualität und Anklage einer fehlenden Forschungstradition: Das Kapitel befasst sich mit dem Mangel an journalistischer Qualität und analysiert die Ursachen für diese Entwicklung. Es wirft einen kritischen Blick auf die Forschungstradition im Bereich des Journalismus.
- Notwendiger Wandel zu einem großen und autonomen Journalismus: Dieses Kapitel argumentiert für einen Wandel des Journalismus hin zu einem größeren und autonomen Modell. Es beschreibt die notwendigen Voraussetzungen für eine solche Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen des Journalismus in der modernen Gesellschaft. Im Fokus stehen die Begriffe "radikaldemokratischer Wandel der Öffentlichkeit", "Risikosensibilität", "journalistische Qualität", "autonomer Journalismus" und "normativer Ansatz".
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Wolfgang R. Langenbucher unter „großem Journalismus“?
Es handelt sich um einen normativen Ansatz, der einen autonomen, qualitätsvollen Journalismus fordert, der seiner gesellschaftlichen Kontrollfunktion gerecht wird.
Wie hat sich die Öffentlichkeit radikaldemokratisch gewandelt?
Der Wandel beschreibt eine zunehmende Beteiligung und eine erwachende Risikosensibilität der Bürger, die höhere Anforderungen an die mediale Berichterstattung stellt.
Warum wird ein Mangel an journalistischer Qualität beklagt?
Kritiker bemängeln, dass Ressourcen fehlen und die Forschungstradition im Journalismus nicht ausreicht, um den komplexen Anforderungen der modernen Gesellschaft zu begegnen.
Welche Rolle spielt Artikel 5 des Grundgesetzes für Journalisten?
Artikel 5 garantiert die Pressefreiheit, doch die Arbeit betont, dass bloße Rechte ohne die nötigen wirtschaftlichen und personellen Ressourcen („Scherz“) nicht ausreichen.
Was bedeutet „Risikosensibilität“ im journalistischen Kontext?
Es bezeichnet die wachsende Aufmerksamkeit der Gesellschaft für potenzielle Gefahren und Krisen, auf die der Journalismus mit fundierter Analyse reagieren muss.
Warum ist ein autonomer Journalismus heute so wichtig?
Autonomie schützt Journalisten vor politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme und ermöglicht es ihnen, als unabhängiges Sprachrohr der Opposition oder Kritik zu fungieren.
- Quote paper
- Jana Lippmann (Author), 2001, Großer Journalismus nach Wolfgang R. Langenbucher - ein normativer Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3302