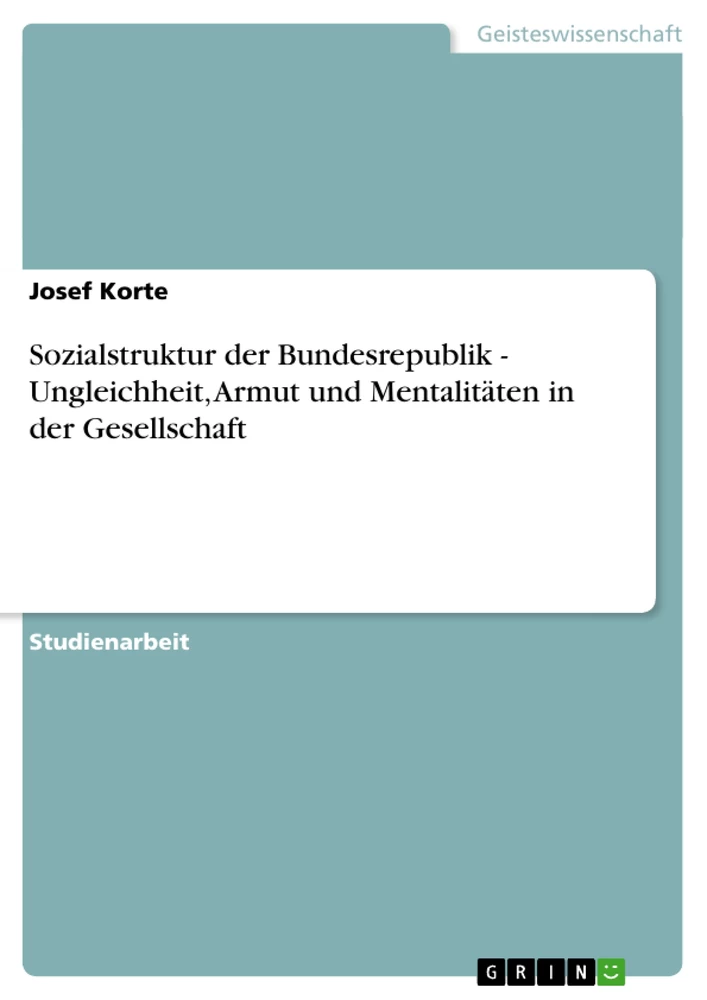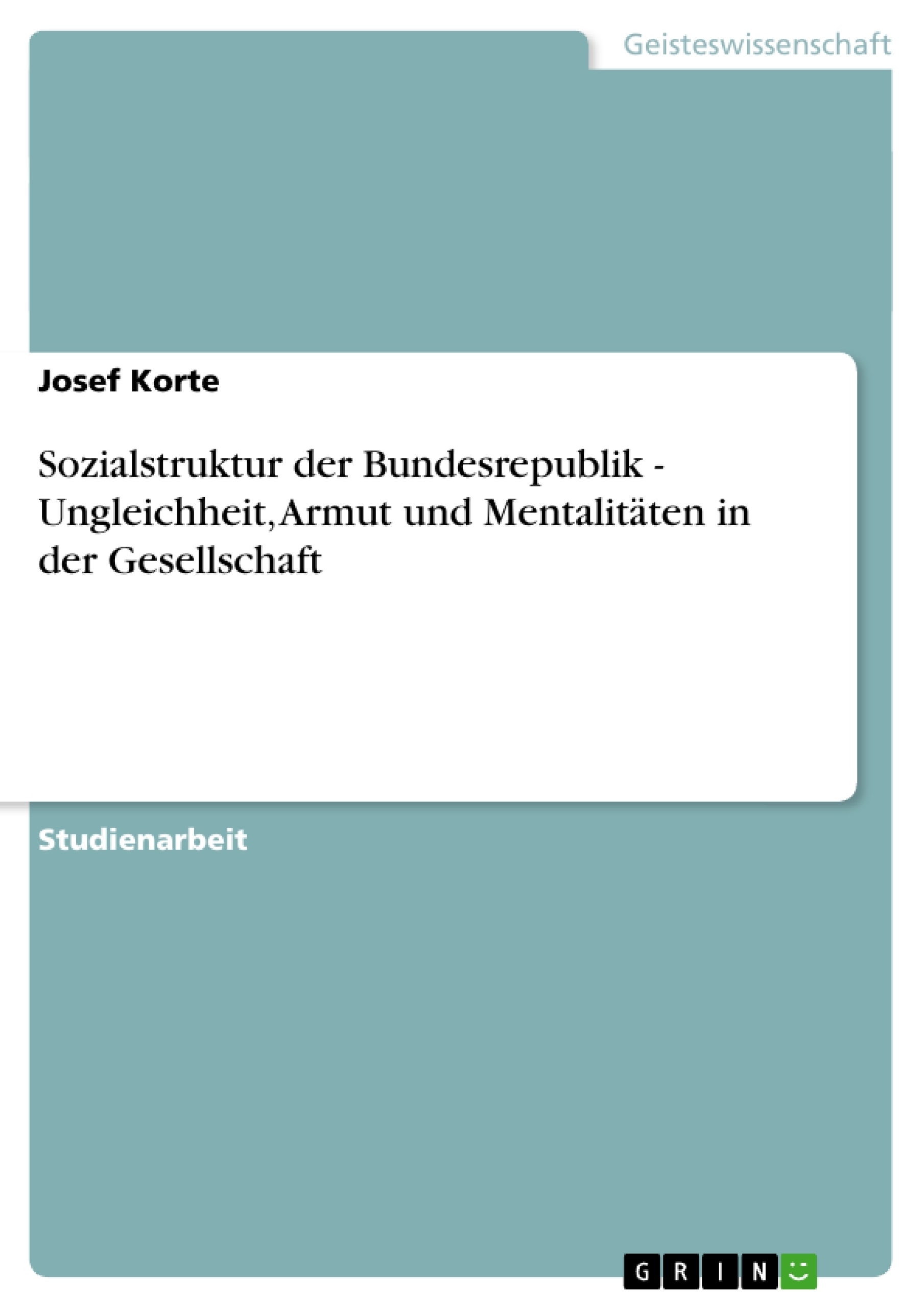Elementar für das Verständnis von „sozialer Ungleichheit“ ist zunächst einmal die Tatsache, dass der Begriff der „sozialen Ungleichheit“ von den Begriffen der „natürlichen Unterschiedlichkeit“ bzw. „natürlichen Verschiedenartigkeit“ unbedingt zu trennen ist. Der französische Aufklärungsphilosoph Jean-Jacques Rousseau liefert hier mit seiner Unterscheidung von zwei Formen der Ungleichheit einen entscheidenden Hinweis. Auf der einen Seite steht die natürliche und physisch bedingte Verschiedenartigkeit, die sich beispielsweise in Hautfarbe, Körperkraft und Alter ausdrückt, und auf der anderen Seite die „moralische oder politische Ungleichheit“ (Rousseau, vgl. Schäfers, Sozialstruktur und sozialer Wandel in Deutschland, S.231). Bei dieser zweiten Form - der „sozialen“ Ungleichheit - handelt es sich dagegen nach soziologischem Verständnis um gesellschaftlich verankerte Ungleichheit, deren Differenzierungen auf Dauer gestellte Begünstigungen oder Benachteiligungen für die jeweiligen sozialen Gruppen mit sich bringen. Praktisch manifestiert sich diese Form der Ungleichheit im Zugang zu verfügbaren und erstrebenswerten Gütern wie z. B. den Besitz von Produktionsmitteln oder der Bildung.
Die erstgenannte Form der Ungleichheit, die physisch bedingte, sollte daher nicht mit der sozialen Ungleichheit verwechselt werden und vor allem nicht als Legitimation der sozialen Ungleichheit dienen. Allerdings lässt sich beobachten, dass all zu oft soziale Ungleichheit auf den physischen Unterschieden konstruiert wird, man denke hier an das Beispiel des Rassismus.
Im engeren Sinne lässt sich die soziale Ungleichheit in einem Gesellschaftsmodell über- und untereinander in der Vertikalen abbilden. Bei diesem hierarchischen Ungleichheitsgefüge kann man von einem „Klassen-“ bzw. „Schichtmodell“ sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Soziale Ungleichheit: Definition und Abgrenzung
- Klassen- und Schichtmodelle
- Das Klassenmodell nach Marx
- Schichtungsanalyse und die Entwicklung in der Bundesrepublik
- Soziale Lagen und Milieus
- Kritik an Schichtmodellen und die Entstehung neuer Ungleichheitsfaktoren
- Das Milieukonzept und die SINUS-Studie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Zwischenbericht analysiert den Themenkomplex soziale Ungleichheit, Armut und Mentalitäten in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, verschiedene soziologische Ansätze zur Erklärung sozialer Ungleichheit zu beleuchten und deren Anwendung auf den deutschen Kontext zu diskutieren.
- Definition und Abgrenzung sozialer Ungleichheit
- Entwicklung und Kritik von Klassen- und Schichtmodellen
- Etablierung neuer Ungleichheitsfaktoren und die Bedeutung von Milieus
- Analyse der deutschen Sozialstruktur anhand sozioökonomischer und kultureller Faktoren
- Die Rolle von Lebenschancen, -risiken und Mentalitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Soziale Ungleichheit: Definition und Abgrenzung: Der Bericht beginnt mit einer klaren Unterscheidung zwischen natürlicher Verschiedenheit und sozialer Ungleichheit, basierend auf Rousseaus Unterscheidung zwischen physischer und moralischer Ungleichheit. Soziale Ungleichheit wird als gesellschaftlich verankerte Benachteiligung oder Begünstigung von sozialen Gruppen definiert, die sich im Zugang zu Gütern wie Produktionsmitteln oder Bildung manifestiert. Der Text warnt vor der Verwendung physischer Unterschiede, wie beispielsweise bei Rassismus, zur Legitimation sozialer Ungleichheit.
Klassen- und Schichtmodelle: Dieses Kapitel vergleicht das marxistische Klassenmodell, das soziale Klassen anhand ihrer Stellung im Produktionsprozess, Qualifikation und ökonomischen Verhältnissen definiert, mit der Schichtungsanalyse. Das Klassenmodell betont Konflikte zwischen Klassen, während die Schichtungsanalyse eine deskriptive Betrachtungsweise einnimmt. Der Bericht beleuchtet die Entwicklung der deutschen Sozialstruktur, beginnend mit der "Klassengesellschaft im Schmelztiegel" (Geiger) und der "nivellierten Mittelstandsgesellschaft" (Schelsky), wobei die Kritik an Schelskys Modell und die Rückkehr zu neomarxistischen Ansätzen im Kontext der 60er und 70er Jahre diskutiert wird. Die Auflösung harter Klassenstrukturen und das Fortbestehen sozialer Ungleichheiten werden als Konsens in der heutigen Soziologie dargestellt.
Soziale Lagen und Milieus: Dieses Kapitel kritisiert Schichtmodelle aufgrund ihrer Konzentration auf die sozioökonomische Dimension und der Vernachlässigung neuer, horizontaler Ungleichheitsfaktoren wie Alter oder Geschlecht. Die Modelle sozialer Lagen werden als Lösungsansatz vorgestellt, um horizontale Ungleichheiten zu berücksichtigen. Das Milieukonzept wird erläutert, das die Entkopplung objektiver sozioökonomischer Lebensbedingungen von subjektiven Verhaltensweisen und Werten betont. Der Individualisierungsprozess nach Beck und die zunehmende Bedeutung von Freizeit und Kultur werden als relevante Faktoren diskutiert, die zu einer feineren Ausdifferenzierung der Gesellschaft führen. Die Milieuanalyse berücksichtigt subjektive Indikatoren wie Werte und Verhaltensweisen und verknüpft sie mit sozioökonomischen Faktoren. Die SINUS-Studie wird als Beispiel für empirische Milieustudien genannt, die die west- und ostdeutsche Gesellschaft in verschiedene Milieus unterteilt.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Armut, Mentalitäten, Klassenmodell, Schichtmodell, Soziale Lage, Milieu, SINUS-Institut, soziale Mobilität, Individualisierung, ökonomische Faktoren, kulturelle Faktoren, Lebenschancen, Lebensrisiken, Bundesrepublik Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Zwischenbericht: Soziale Ungleichheit, Armut und Mentalitäten in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand des Zwischenberichts?
Der Zwischenbericht analysiert den Themenkomplex soziale Ungleichheit, Armut und Mentalitäten in der Bundesrepublik Deutschland. Er beleuchtet verschiedene soziologische Ansätze zur Erklärung sozialer Ungleichheit und deren Anwendung auf den deutschen Kontext.
Welche Themen werden im Zwischenbericht behandelt?
Der Bericht behandelt die Definition und Abgrenzung sozialer Ungleichheit, die Entwicklung und Kritik von Klassen- und Schichtmodellen, die Etablierung neuer Ungleichheitsfaktoren und die Bedeutung von Milieus, die Analyse der deutschen Sozialstruktur anhand sozioökonomischer und kultureller Faktoren sowie die Rolle von Lebenschancen, -risiken und Mentalitäten.
Welche soziologischen Ansätze werden im Bericht diskutiert?
Der Bericht vergleicht das marxistische Klassenmodell mit der Schichtungsanalyse. Er diskutiert die Entwicklung der deutschen Sozialstruktur von der "Klassengesellschaft im Schmelztiegel" bis zur "nivellierten Mittelstandsgesellschaft" und die Kritik an diesen Modellen. Weiterhin werden Modelle sozialer Lagen und das Milieukonzept, insbesondere im Kontext der SINUS-Studie, behandelt.
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen Klassen- und Schichtmodellen?
Das marxistische Klassenmodell definiert soziale Klassen anhand ihrer Stellung im Produktionsprozess, Qualifikation und ökonomischen Verhältnissen und betont Konflikte zwischen Klassen. Die Schichtungsanalyse hingegen nimmt eine deskriptive Betrachtungsweise ein. Der Bericht zeigt die Entwicklung von der Betonung harter Klassenstrukturen hin zur Anerkennung der Auflösung dieser Strukturen und dem gleichzeitigen Fortbestehen sozialer Ungleichheiten.
Warum wird die Kritik an Schichtmodellen im Bericht angesprochen?
Schichtmodelle werden kritisiert, weil sie sich auf die sozioökonomische Dimension konzentrieren und neue, horizontale Ungleichheitsfaktoren wie Alter oder Geschlecht vernachlässigen. Deshalb werden Modelle sozialer Lagen und das Milieukonzept als Lösungsansatz vorgestellt, um diese horizontalen Ungleichheiten zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielt das Milieukonzept im Bericht?
Das Milieukonzept betont die Entkopplung objektiver sozioökonomischer Lebensbedingungen von subjektiven Verhaltensweisen und Werten. Der Individualisierungsprozess und die zunehmende Bedeutung von Freizeit und Kultur werden als relevante Faktoren diskutiert, die zu einer feineren Ausdifferenzierung der Gesellschaft führen. Die Milieuanalyse verknüpft subjektive Indikatoren mit sozioökonomischen Faktoren. Die SINUS-Studie dient als Beispiel für empirische Milieustudien.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Bericht relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Soziale Ungleichheit, Armut, Mentalitäten, Klassenmodell, Schichtmodell, Soziale Lage, Milieu, SINUS-Institut, soziale Mobilität, Individualisierung, ökonomische Faktoren, kulturelle Faktoren, Lebenschancen, Lebensrisiken, Bundesrepublik Deutschland.
Wie ist der Bericht strukturiert?
Der Bericht enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Er beginnt mit einer Definition und Abgrenzung sozialer Ungleichheit und behandelt danach Klassen- und Schichtmodelle sowie soziale Lagen und Milieus.
Für wen ist dieser Zwischenbericht gedacht?
Der Zwischenbericht ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Bereich der sozialen Ungleichheit.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen könnten in den vollständigen Studien und Forschungsarbeiten enthalten sein, auf denen dieser Zwischenbericht basiert (diese sind hier nicht aufgeführt).
- Citar trabajo
- Josef Korte (Autor), 2003, Sozialstruktur der Bundesrepublik - Ungleichheit, Armut und Mentalitäten in der Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33024