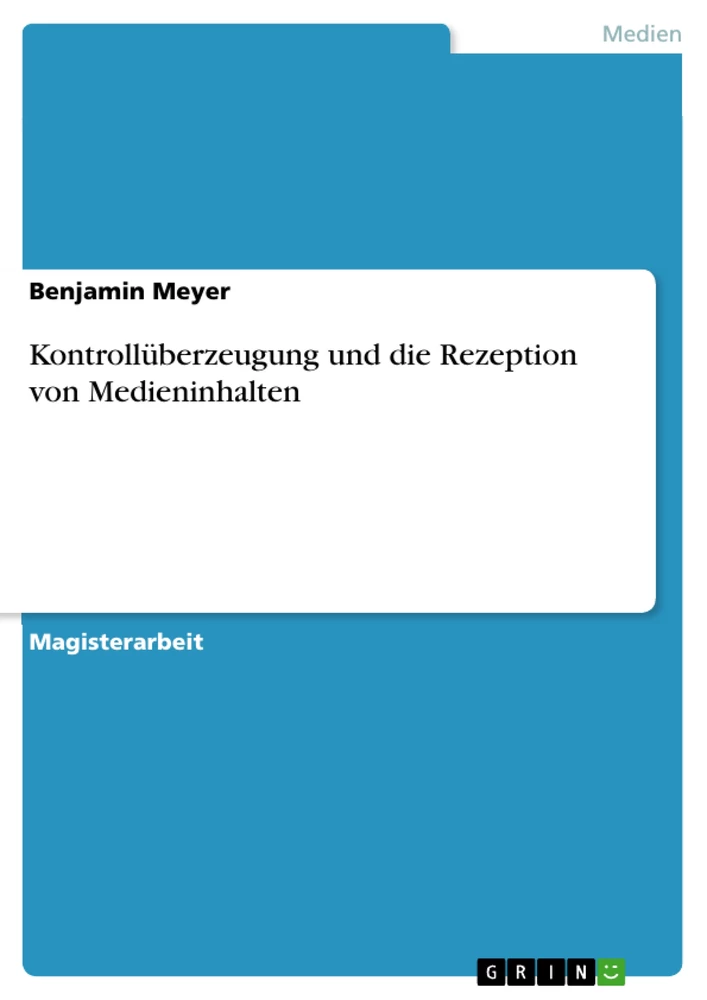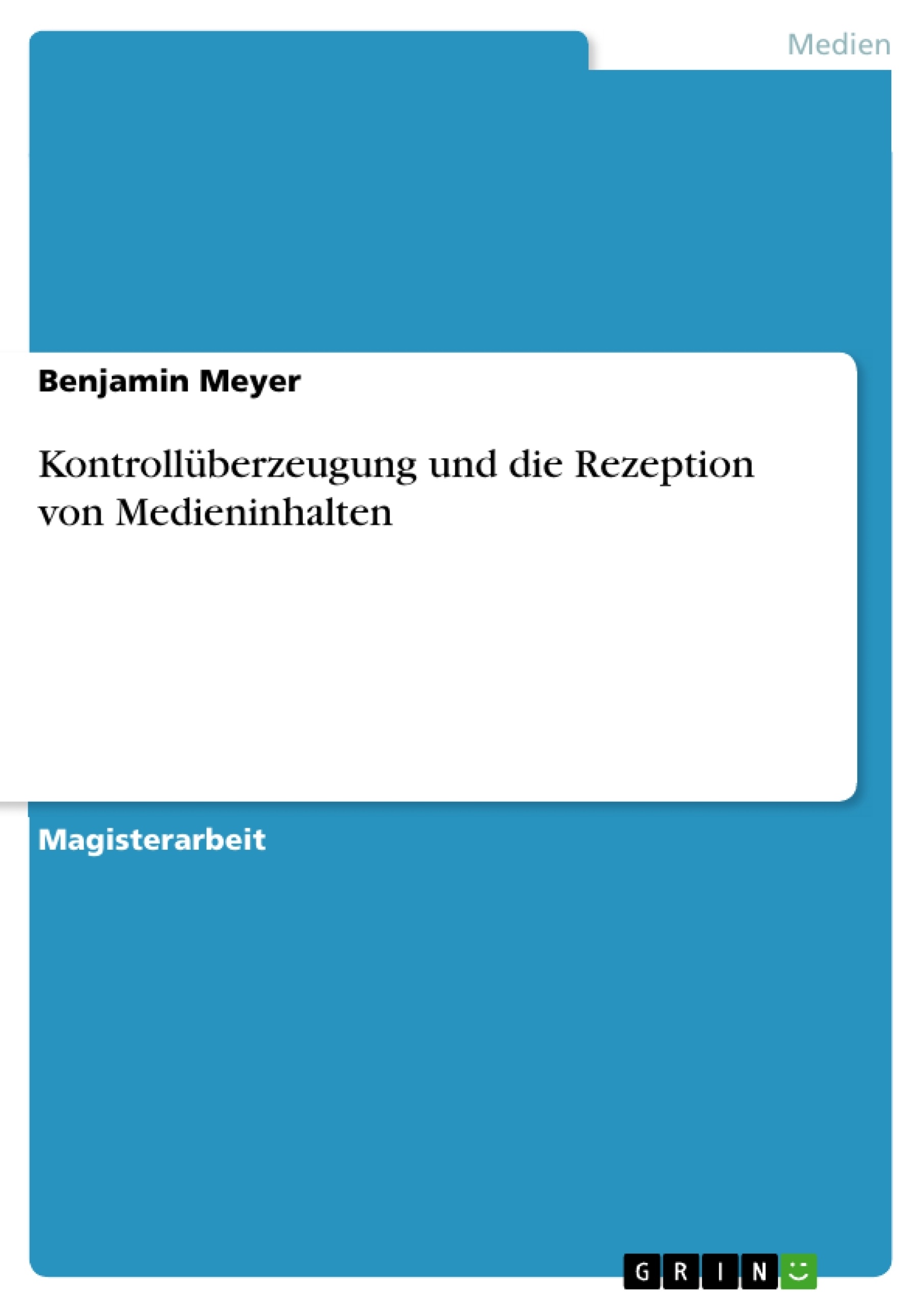Einleitung
Die vorliegende Arbeit siedelt sich im Bereich der Rezeptionsforschung in der Kommunikationswissenschaft an. Die Rezeptionsforschung richtet bei der Betrachtung von Prozessen
der Massenkommunikation ihren Blick vor allem auf die Rezipienten, die als aktiv handelnd angesehen werden. Aktiv ist der Rezipient einerseits hinsichtlich der Entscheidung, welchen Medienreizen er sich wie stark aussetzt, andererseits kann die Aktivität des Rezipienten auch in dem Sinne aufgefaßt werden, daß Medienrezeption an sich aktives soziales Handeln bedeutet.
Diese Vorstellung geht davon aus, daß Medienrezeption für das soziale System und die Persönlichkeit der Rezipienten von Bedeutung ist und eine soziale Interaktion darstellt.(1)
Eine Konsequenz dieser Betrachtung der Massenkommunikation ist die Erkenntnis, daß die Bedeutung, die durch Medieninhalte vermittelt wird, erst im Moment der Rezeption entstehen kann. Zwar lenken Medieninhalte die Art ihrer Interpretation, letztendlich konstruieren
die Rezipienten durch ihre individuelle Art der Rezeption aber selbst die Bedeutung dieser Inhalte. So existieren auf der Seite der Rezipienten zahlreiche soziale, kulturelle und psychische Dispositionen, die spezifische Rezeptionsstile nach sich ziehen. Vor allem der Einfluß sozialer Dispositionen auf die Rezeption von Medieninhalten wurde in der rezipientenorientierten
Forschung oftmals untersucht. In der Rezeptionsforschung besteht zwar Übereinstimmung hinsichtlich der Notwendigkeit, auch die Relevanz der psychischen Dispositionen zu erforschen, bisher liegen dazu jedoch nur wenige Untersuchungen vor.
Die vorliegende Arbeit möchte die Bedeutung eines Persönlichkeits-merkmals – der Kontrollüberzeugung – in ihrer Wirkung auf die Rezeption von Medieninhalten untersuchen. Die Art der Kontroll-überzeugung reflektiert bei Individuen entweder das Gefühl, selbst Kontrolle ausüben und Ereignisse bewirken zu können, oder das Empfinden von außen (wie durch Glück oder Schicksal) beeinflußt zu werden.
[...]
_____
1 Vgl. Will Teichert: ‘Fernsehen’ als soziales Handeln. Zur Situation der Rezipientenforschung: Ansätze und Kritik. In: Rundfunk und Fernsehen 20/4, 1972. S. 421.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundbegriffe der rezipientenorientierten Forschung
- Vom Publikum zum aktiven Rezipienten
- Audiences\" als Konstrukt
- Die Konzeption des aktiven Rezipienten
- Rezeption und Text
- Rezeption von Medieninhalten
- Motive für die Rezeption
- Das Wie\" der Rezeption
- Text und Polysemie des Textes
- Rezeption von Medieninhalten
- Fazit
- Vom Publikum zum aktiven Rezipienten
- Die Rezeptionsforschung
- Der Gegenstand der Rezeptionsforschung
- Ausgewählte Forschungsansätze
- Cultural Studies
- Die Geschlechterforschung
- Der rezipientenorientierte Ansatz
- Fazit
- Die Messung von Rezeption
- Rezipientenvariablen als dominante Wirkfaktoren
- Situative Faktoren
- Soziale Faktoren
- Lebensalter
- Soziales Geschlecht
- Lebensstil und Lebenswelt
- Psychische Faktoren
- Messung der Wahrnehmung von Medieninhalten
- Fazit
- Rezipientenvariablen als dominante Wirkfaktoren
- Das Konstrukt der Kontrollüberzeugung in der Rezeptionsforschung
- Das Konstrukt der Kontrollüberzeugung
- Die soziale Lerntheorie von Julian Rotter
- Bedeutung der Kontrollüberzeugung
- Messung der Kontrollüberzeugung
- Unterschiede zwischen internen und externen Kontrollüberzeugungen
- Die Bedeutung der Kontrollüberzeugung für die Rezeptionsforschung
- Die Kontrollüberzeugung in der Kommunikationswissenschaft
- Rolle der Kontrollüberzeugung bei der Rezeption von Medieninhalten
- Fazit
- Das Konstrukt der Kontrollüberzeugung
- Untersuchungsziel und Hypothesen
- Methode und Untersuchungsdesign
- Wahl der Methode
- Genereller Untersuchungsablauf
- Messung der Kontrollüberzeugung
- Darstellung der Befragtengruppe
- Bildung der Versuchsgruppe
- Untersuchungsdesign
- Befindlichkeitstest
- Auswahl der Fernsehausschnitte
- Nachrichten: ARD Tagesschau („Konjunkturprognose 1999\" und „Übernahmegerüchte zurückgewiesen“)
- Werbung: „VOLKSWAGENBANK direct“
- Spielfilmausschnitt 1: „Vampyr“
- Spielfilmausschnitt 2: Szene „Tischtennis“
- Spielfilmausschnitt 3: Szene „Abendessen“
- Fragebögen zur Fernsehnutzung, -bewertung und -rezeption
- Fragen zur Fernsehnutzung
- Fragen zur Fernsehbewertung
- Fragen zur Fernsehrezeption
- Reliabilität und Validität
- Versuchsdurchführung
- Ergebnisse
- Die Verteilung der Kontrollüberzeugung innerhalb der Befragtengruppe
- Ergebnisdarstellung des Hauptversuchs
- Erste Eindrücke bei der Versuchsdurchführung
- Fernsehnutzung und -bewertung (1. Fragebogen)
- Fernsehnutzung
- Einstellungen und Meinungen zum Fernsehen
- Rezeption der Nachrichtenbeiträge (2. Fragebogen)
- Rezeption der Werbung (3. Fragebogen)
- Rezeption von „Vampyr“ (4. Fragebogen)
- Rezeption der Szene „Tischtennis“ (5. Fragebogen)
- Rezeption der Szene „Abendessen“ (6. Fragebogen)
- Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Kontrollüberzeugung in der Rezeptionsforschung. Ziel ist es, den Einfluss dieses Persönlichkeitsmerkmals auf die Rezeption von Medieninhalten zu untersuchen.
- Die Rolle des aktiven Rezipienten in der Medienkommunikation
- Die Bedeutung der Rezeption für das soziale System und die Persönlichkeit des Rezipienten
- Die Relevanz psychischer Dispositionen für die Rezeption von Medieninhalten
- Das Konstrukt der Kontrollüberzeugung und seine theoretischen Grundlagen
- Der Einfluss der Kontrollüberzeugung auf die Rezeption von verschiedenen Medientypen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Relevanz der Rezeptionsforschung und die Bedeutung des aktiven Rezipienten. Sie stellt den Fokus der Arbeit auf die Kontrollüberzeugung und ihre Bedeutung für die Rezeption von Medieninhalten dar.
- Theoretische Grundbegriffe der rezipientenorientierten Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Konzepts des aktiven Rezipienten und die Rezeption von Medieninhalten in der Massenkommunikation. Es werden Motive für die Rezeption und die Bedeutung des „Wie\" der Rezeption erörtert.
- Die Rezeptionsforschung: Dieses Kapitel stellt die Rezeptionsforschung als Forschungsbereich vor und analysiert verschiedene Forschungsansätze, wie die Cultural Studies und die Geschlechterforschung, sowie den rezipientenorientierten Ansatz.
- Die Messung von Rezeption: Dieses Kapitel beleuchtet die Messung der Rezeption von Medieninhalten und konzentriert sich auf Rezipientenvariablen wie situative, soziale und psychische Faktoren, die einen Einfluss auf die Rezeption ausüben.
- Das Konstrukt der Kontrollüberzeugung in der Rezeptionsforschung: Dieses Kapitel definiert und erläutert das Konstrukt der Kontrollüberzeugung, beleuchtet die soziale Lerntheorie von Julian Rotter und beschreibt verschiedene Messmethoden. Es untersucht außerdem Unterschiede zwischen internen und externen Kontrollüberzeugungen und die Bedeutung der Kontrollüberzeugung für die Rezeptionsforschung.
- Untersuchungsziel und Hypothesen: Dieses Kapitel definiert das Untersuchungsziel der Arbeit und formuliert Hypothesen, die den Einfluss der Kontrollüberzeugung auf die Rezeption von Medieninhalten untersuchen.
- Methode und Untersuchungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die Wahl der Methode, den generellen Untersuchungsablauf, die Messung der Kontrollüberzeugung, die Darstellung der Befragtengruppe und das Untersuchungsdesign.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, einschließlich der Verteilung der Kontrollüberzeugung innerhalb der Befragtengruppe, der Ergebnisse des Hauptversuchs und der Analysen der Fernsehnutzung, -bewertung und -rezeption.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Rezeptionsforschung, Medieninhalte, Kontrollüberzeugung, Rezipienten, Medienrezeption, soziales Handeln, Persönlichkeitsmerkmale, Kommunikationswissenschaft, empirische Forschung, Fernsehnutzung, Fragebogenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Arbeit im Bereich der Rezeptionsforschung?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Persönlichkeitsmerkmals „Kontrollüberzeugung“ auf die Art und Weise, wie Rezipienten Medieninhalte wahrnehmen und verarbeiten.
Was versteht man unter dem Konstrukt der Kontrollüberzeugung?
Kontrollüberzeugung beschreibt, ob ein Individuum glaubt, Ereignisse durch eigenes Handeln kontrollieren zu können (interne Kontrolle) oder ob es sich von äußeren Faktoren wie Glück oder Schicksal abhängig fühlt (externe Kontrolle).
Warum wird der Rezipient als „aktiv“ bezeichnet?
Der Rezipient ist aktiv, weil er entscheidet, welchen Medienreizen er sich aussetzt, und weil er die Bedeutung der Inhalte durch seine individuelle Interpretation selbst konstruiert.
Welche Medientypen wurden in der empirischen Untersuchung verwendet?
In der Untersuchung wurden verschiedene Fernsehausschnitte analysiert, darunter Nachrichten (ARD Tagesschau), Werbung (Volkswagenbank) und verschiedene Spielfilmszenen (z. B. aus „Vampyr“).
Welche Rolle spielt die soziale Lerntheorie von Julian Rotter?
Die Theorie von Julian Rotter bildet die theoretische Grundlage für das Konstrukt der Kontrollüberzeugung, auf der die gesamte Untersuchung der Arbeit aufbaut.
Welche Faktoren beeinflussen laut der Arbeit die Medienrezeption?
Neben psychischen Dispositionen wie der Kontrollüberzeugung spielen auch situative Faktoren sowie soziale Variablen wie Alter, Geschlecht und Lebensstil eine entscheidende Rolle.
- Citar trabajo
- Benjamin Meyer (Autor), 1999, Kontrollüberzeugung und die Rezeption von Medieninhalten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/330