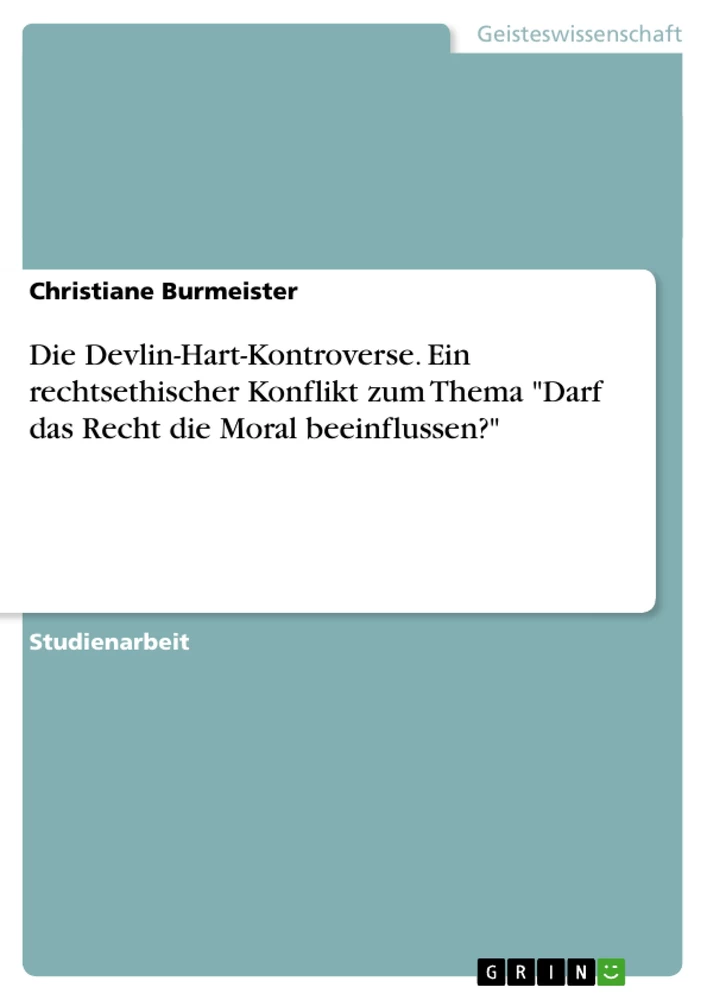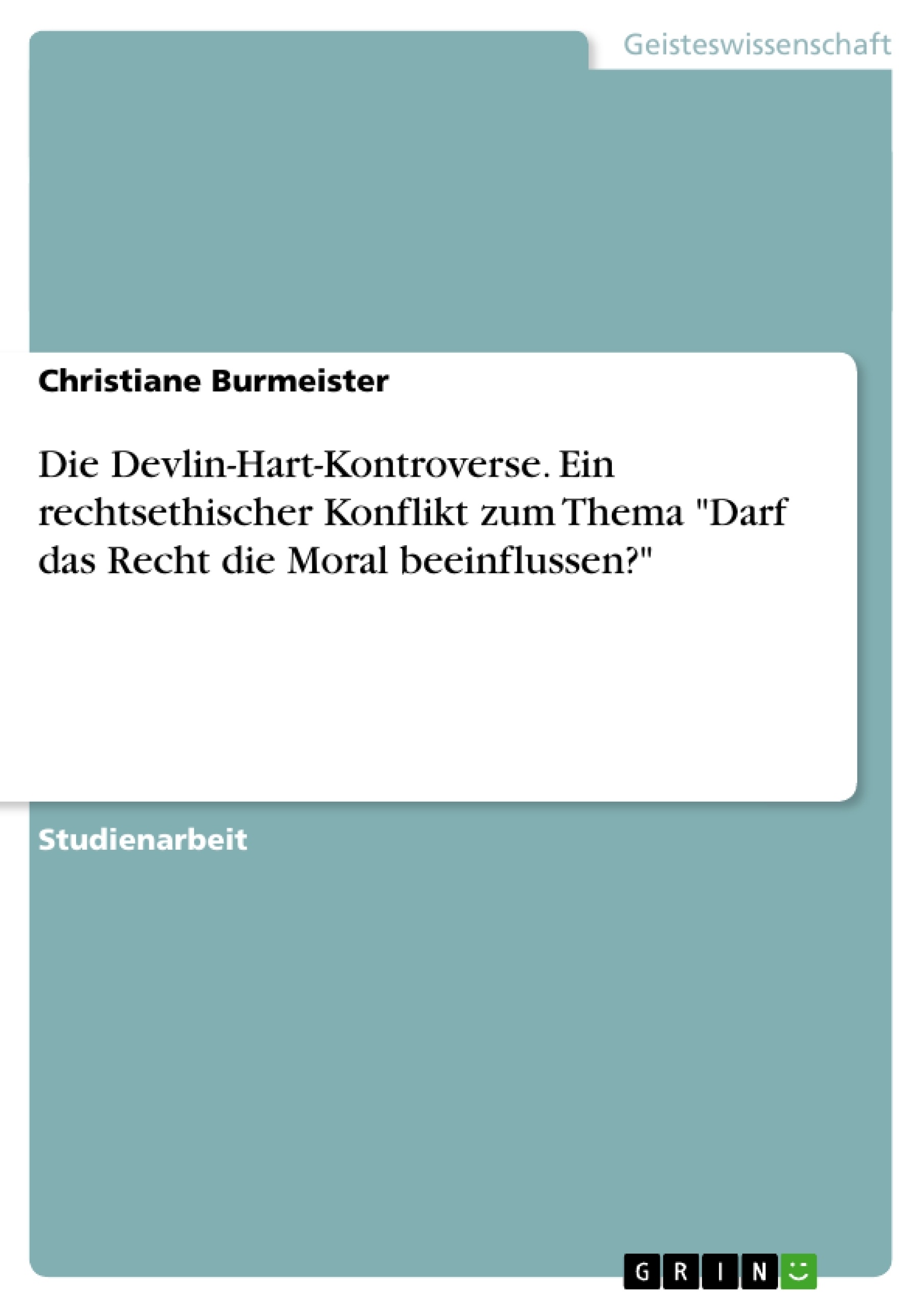Die stetige Veränderung der Gesellschaft ist untrennbar verbunden mit einer Anpassung und Modifizierung ihrer Werte und Normen. Tendenziell ist die Entwicklung von moralischen Prinzipien von Generation zu Generation auf stärkere Liberalisierung ihrer Inhalte ausgerichtet. Sie bietet somit Anlass zur Frage, ob sie der Integrität der Gesellschaft zum Schaden sei und Moral demzufolge durch das Recht gestärkt, bzw. durchgesetzt werden dürfe. Diese Frage zieht in ihrem Umfang eine Fülle anderer rechtsethischer Konflikte mit sich, wie zum Beispiel jene über die Grenzen des Machtbereichs von staatlich gesetztem Recht, die Trennung von privater und öffentlicher Moral oder die Begrenzung der Rechte des Individuums zum Schutz der Gesellschaft. Die wohl berühmteste Kontroverse zum Einfluss von Recht auf Moral entbrannte in den 1950er bzw. 60er Jahren zwischen dem Rechtspositivisten und Richter des Obersten Gerichts Großbritanniens Lord Patrick Devlin und dem Rechtsphilosophen Herbert Lionel Adolphus Hart anlässlich eines umstrittenen Berichts des 1954 vom britischen Parlament eingesetzten Wolfenden- Komitees. Seine Aufgabe war die Prüfung einiger skandalöser Rechtsurteile gegen Homosexuelle und Prostituierte. Konklusion seiner Arbeit und Kernaussage des Berichts war die Forderung, Homosexualität nicht länger als Verbrechen zu betrachten und einen gewissen Privatraum dem Einwirken des Rechts vorzuenthalten. Letztere gab den Ausschlag für eine Auseinandersetzung zwischen Befürwortern, allen voran Patrick Devlin und Gegnern, insbesondere H.L.A. Hart, der rechtsgestützten Moral, deren Gegenstand weniger die normative Beurteilung von Homosexualität als das Verhältnis von Moral, Recht und Gesellschaft war. Der wesentliche Streitpunkt dieser Debatte ist der Umgang mit moralisch strittigen Handlungen, die sich nicht unmittelbar auf andere auswirken und ihnen keinen ersichtlichen Schaden zufügen, so genannte victimless immoralities. Ihre Klassifizierung als Straftat ist auf den ersten Blick nicht zureichend begründbar, soll aber in der nachfolgenden Darstellung zweier ausgeprägter rechtsethischer Positionen näher betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Wolfenden Report und seine Vorgeschichte
- Patrick Devlin: The Enforcement of Morals
- Die Rolle der Moral für die Gesellschaft
- Die Festlegung von Moral und Unmoral
- H.L.A. Hart
- Devlin und Hart, gemessen am Schadensprinzip von John Stuart Mill
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Devlin-Hart-Kontroverse, eine rechtsethische Auseinandersetzung, die sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit das Recht die Moral beeinflussen darf. Die Arbeit analysiert die Argumente beider Seiten und untersucht, ob die rechtliche Durchsetzung von Moral gerechtfertigt ist, insbesondere im Hinblick auf „victimless immoralities“. Die Arbeit stellt die zentralen Positionen von Devlin und Hart gegenüber und untersucht ihre Argumentationslinien im Kontext des Schadensprinzips von John Stuart Mill.
- Das Verhältnis von Recht und Moral
- Die Grenzen des staatlichen Eingriffs in private Moral
- Die Frage der "victimless immoralities"
- Der Einfluss des Wolfenden Reports auf die Debatte
- Die Rolle der Moral für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Devlin-Hart-Kontroverse ein und stellt die zentrale Frage nach dem Einfluss von Recht auf Moral in den Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und der Entwicklung von moralischen Prinzipien.
- Der Wolfenden Report und seine Vorgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Wolfenden Reports, der die Empfehlung aussprach, homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen nicht länger als Straftat zu betrachten. Es werden die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie die zentralen Argumente des Reports dargestellt.
- Patrick Devlin: The Enforcement of Morals: Dieses Kapitel fokussiert auf die Kritik von Lord Patrick Devlin am Wolfenden Report. Es werden seine Argumente für die rechtliche Durchsetzung von Moral und die Bedeutung der Moral für die Integrität der Gesellschaft dargestellt.
- Die Rolle der Moral für die Gesellschaft: Devlin argumentiert, dass eine gemeinsame Moral für den Zusammenhalt der Gesellschaft unerlässlich ist und dass das Recht diese Moral schützen und durchsetzen sollte.
- Die Festlegung von Moral und Unmoral: Devlin erläutert, wie eine Gesellschaft Moral definiert und Grenzen zwischen moralisch vertretbarem und unvertretbarem Verhalten zieht.
- H.L.A. Hart: Dieses Kapitel präsentiert die Gegenposition von H.L.A. Hart, der den Einfluss des Rechts auf die Moral einschränkt und die Freiheit des Individuums betont.
- Devlin und Hart, gemessen am Schadensprinzip von John Stuart Mill: Dieses Kapitel vergleicht die Positionen von Devlin und Hart anhand des Schadensprinzips von John Stuart Mill und diskutiert die Frage, inwieweit staatliche Eingriffe in private Moral gerechtfertigt sind, wenn kein Schaden für Dritte entsteht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Seminararbeit sind: Devlin-Hart-Kontroverse, Rechtsethik, Moral, Recht, Gesellschaft, Wolfenden Report, Homosexualität, victimless immoralities, Schadensprinzip, John Stuart Mill, Rechtspositivismus, Rechtsphilosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Devlin-Hart-Kontroverse?
Es handelt sich um eine rechtsethische Debatte darüber, ob und inwieweit der Staat das Recht hat, moralische Vorstellungen durch Gesetze durchzusetzen, selbst wenn kein direkter Schaden für Dritte entsteht.
Welchen Einfluss hatte der Wolfenden-Report auf diese Debatte?
Der Report von 1954 empfahl, Homosexualität zwischen Erwachsenen im Privaten nicht mehr als Verbrechen zu betrachten. Dies löste den Streit zwischen Devlin (Befürworter rechtsgestützter Moral) und Hart (Gegner) aus.
Was versteht man unter „victimless immoralities“?
Damit sind Handlungen gemeint, die moralisch strittig sein mögen, aber anderen Personen keinen ersichtlichen Schaden zufügen, wie etwa privates sexuelles Verhalten zwischen einwilligenden Erwachsenen.
Wie argumentiert Lord Patrick Devlin für die Durchsetzung von Moral?
Devlin argumentiert, dass eine gemeinsame Moral das Fundament einer Gesellschaft ist. Wenn diese Moral zerfällt, sei die Integrität der Gesellschaft bedroht, weshalb das Recht sie schützen müsse.
Welche Rolle spielt das Schadensprinzip von John Stuart Mill in der Arbeit?
Das Schadensprinzip dient als Maßstab, um zu prüfen, ob staatliche Eingriffe gerechtfertigt sind. Hart stützt sich darauf, um die Freiheit des Individuums gegenüber moralisierenden Gesetzen zu verteidigen.
- Citation du texte
- Christiane Burmeister (Auteur), 2004, Die Devlin-Hart-Kontroverse. Ein rechtsethischer Konflikt zum Thema "Darf das Recht die Moral beeinflussen?", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33150