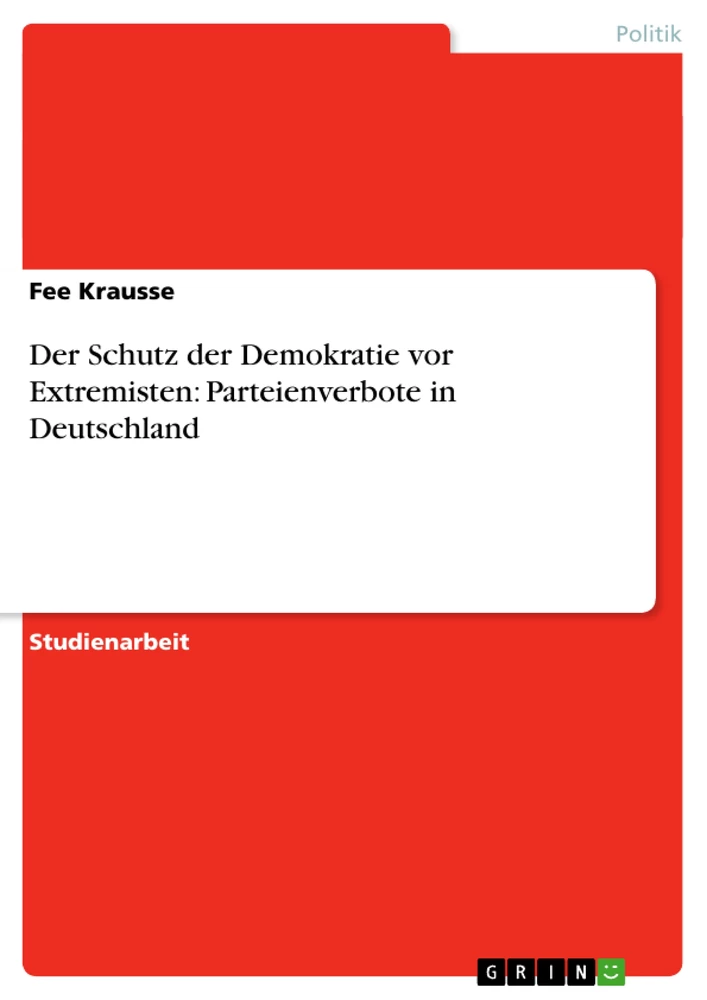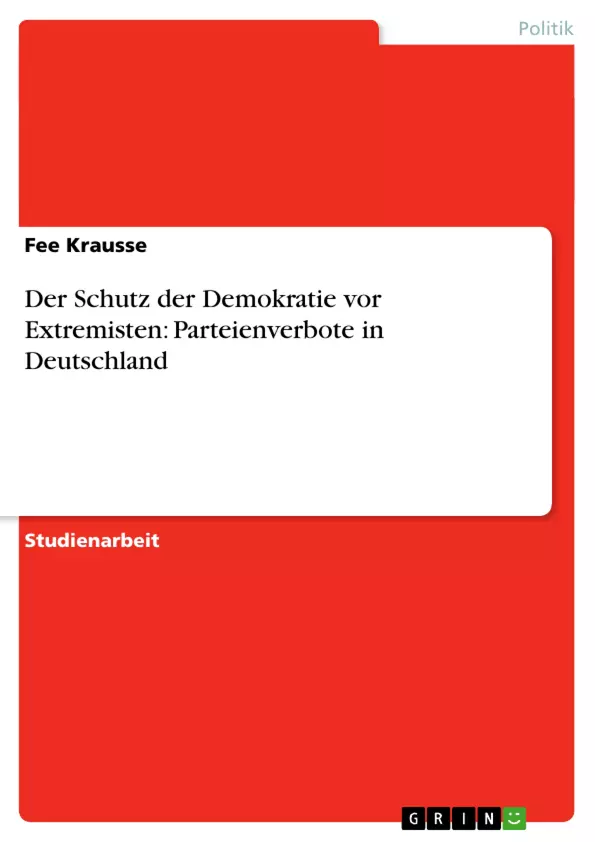Das Thema Parteienverbot erhielt neue Aktualität, als 2001 die Bundesregierung, der Bundesrat und der Bundestag kurz nacheinander einen Verbotsantrag gegen die NPD einreichten. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ein knappes halbes Jahr zurück liegt (18. März 2003), fiel in Bezug auf ein Verbot negativ aus: der Verbotsantrag wurde für unzulässig erklärt. In diesem Zusammenhang entstand eine heftige Diskussion hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit einer solchen Maßnahme.
Auf der einen Seite stehen die Befürworter des Parteienverbots, die trotz des demokratischen Grundrechts der Meinungsfreiheit daran festhalten, dass eine Vernichtungsideologie „kein schutzwürdiges Gedankengut“ (Buntenbach/ Wagner 2002, S.134) darstelle, auf der anderen Seite resümieren die Gegner, dass Meinungen durch ein Verbot nicht verändert würden, Organisationen sich im Untergrund schlechter verfolgen ließen und die Parteienvielfalt eingeschränkt würde. Während sich neonazistische Aktivitäten durch ein Verbot kaum unterbinden lassen, wird die entsprechende Partei zumindest vorerst zerschlagen und eine größere (Re-)Organisation verhindert. Es stellt sich die Frage, ob ein Parteienverbot heute überhaupt noch zeitgemäß ist.
Vor diesem Hintergrund müssen zunächst die Ursprünge des Parteienverbots und dessen Verankerung im Grundgesetz geklärt werden. Der seit dem KPD-Verbotsurteil verwendete Begriff „streitbare Demokratie“ umfasst neben dem Parteienverbot eine Reihe von Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung von Extremisten. Im Anschluss erörtert diese Arbeit die beiden „erfolgreichen“ Parteienverbotsverfahren: das SRP- und das KPD-Verbotsverfahren. In einer abschließenden Problematisierung werden Parteienverbote auf demokratietheoretischer, verfassungsrechtlicher und politisch-pragmatischer Ebene diskutiert, um der Antwort auf die Frage nach der Notwendigkeit des Parteienverbots in der heutigen Zeit näherzukommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Thema
- Streitbare Demokratie
- Das Konzept der streitbaren Demokratie
- Instrumente der streitbaren Demokratie
- Das Parteienverbot
- Parteienverbotsverfahren in den 50er Jahren
- Das SRP-Verbotsverfahren
- Das KPD-Verbotsverfahren
- Diskussion des Parteienverbots
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Frage der Parteienverbote in Deutschland im Kontext der "streitbaren Demokratie". Sie beleuchtet die Entwicklung und Anwendung des Instruments des Parteienverbots, insbesondere anhand der Verfahren gegen die SRP und die KPD. Die Arbeit zielt darauf ab, die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit des Parteienverbots im Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Demokratie und der Meinungsfreiheit zu diskutieren.
- Das Konzept der streitbaren Demokratie und ihre Anwendung in Deutschland
- Die historische Entwicklung und Anwendung von Parteienverboten
- Das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie, Meinungsfreiheit und dem Recht auf Selbstverteidigung
- Die Rechtmäßigkeit und Effektivität von Parteienverboten
- Die aktuelle Debatte um Parteienverbote und ihre Bedeutung für die deutsche Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung in das Thema: Die Einleitung stellt das Thema der Parteienverbote in den Kontext der aktuellen Diskussion über die NPD. Sie beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf das Parteienverbot und benennt die zentralen Fragen, die in der Arbeit behandelt werden.
- Streitbare Demokratie: Dieser Abschnitt erläutert das Konzept der "streitbaren Demokratie" und seine Entstehung im Kontext der Weimarer Republik. Es werden die zentralen Elemente der streitbaren Demokratie, wie die Abwehrbereitschaft und die Vorverlagerung, sowie die Bedeutung von Organisationsverboten und der Verwirkung von Grundrechten dargestellt.
- Parteienverbotsverfahren in den 50er Jahren: Hier werden die beiden "erfolgreichen" Parteienverbotsverfahren gegen die SRP und die KPD detailliert analysiert. Die Arbeit beleuchtet die jeweiligen Begründungen für die Verbote und die juristischen Hintergründe der Verfahren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der "streitbaren Demokratie", Parteienverbote, Extremismus, Demokratie, Meinungsfreiheit, Grundrechte, Verfassungsrecht, Recht auf Selbstverteidigung, Rechtsstaatlichkeit, Verfassungsschutz, NPD, KPD, SRP, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept der "streitbaren Demokratie"?
Es beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft der Demokratie, sich gegen ihre Feinde mit Präventivmaßnahmen zu wehren, um eine Selbstabschaffung wie in der Weimarer Republik zu verhindern.
Welche Parteien wurden in der Geschichte der BRD bereits verboten?
In den 1950er Jahren gab es zwei erfolgreiche Verbotsverfahren: gegen die rechtsextreme SRP (1952) und gegen die kommunistische KPD (1956).
Warum scheiterte das NPD-Verbotsverfahren 2003?
Das Bundesverfassungsgericht erklärte den Verbotsantrag für unzulässig, vor allem aufgrund der Präsenz von staatlichen V-Leuten in der Führungsebene der Partei, was eine faire Prozessführung verhinderte.
Welche Argumente sprechen gegen ein Parteienverbot?
Gegner argumentieren, dass Verbote Meinungen nicht ändern, Organisationen in den Untergrund drängen und die Parteienvielfalt sowie demokratische Grundrechte einschränken könnten.
Ist ein Parteienverbot heute noch zeitgemäß?
Diese Frage wird kontrovers diskutiert. Befürworter sehen darin einen notwendigen Schutz vor Vernichtungsideologien, während Kritiker auf politisch-pragmatische Lösungen und die Auseinandersetzung im Diskurs setzen.
- Citation du texte
- Fee Krausse (Auteur), 2003, Der Schutz der Demokratie vor Extremisten: Parteienverbote in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33257