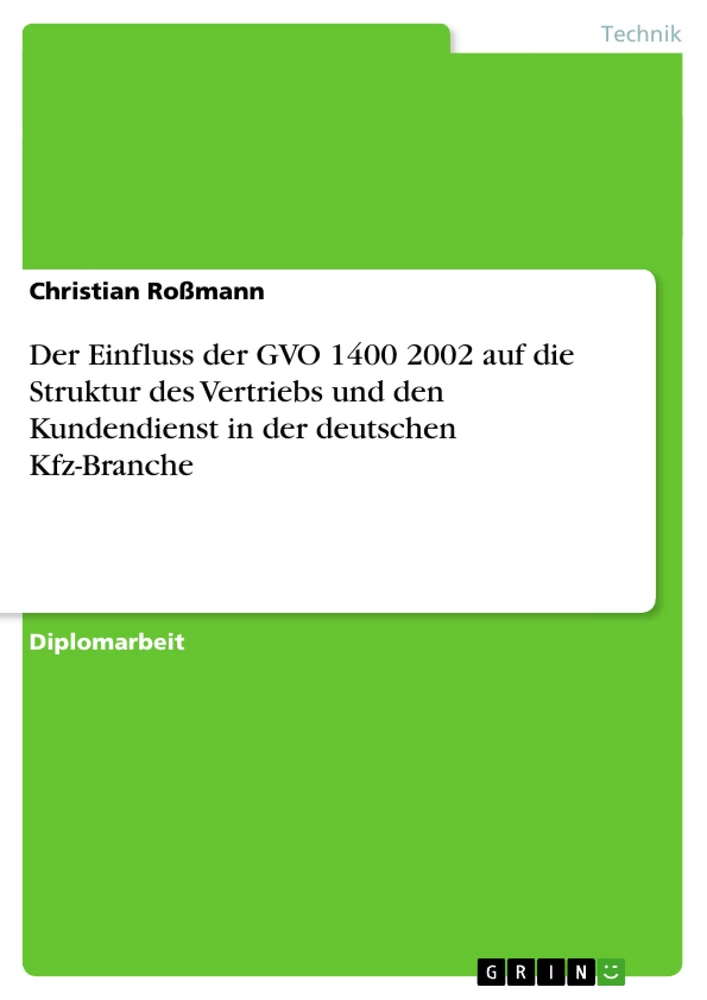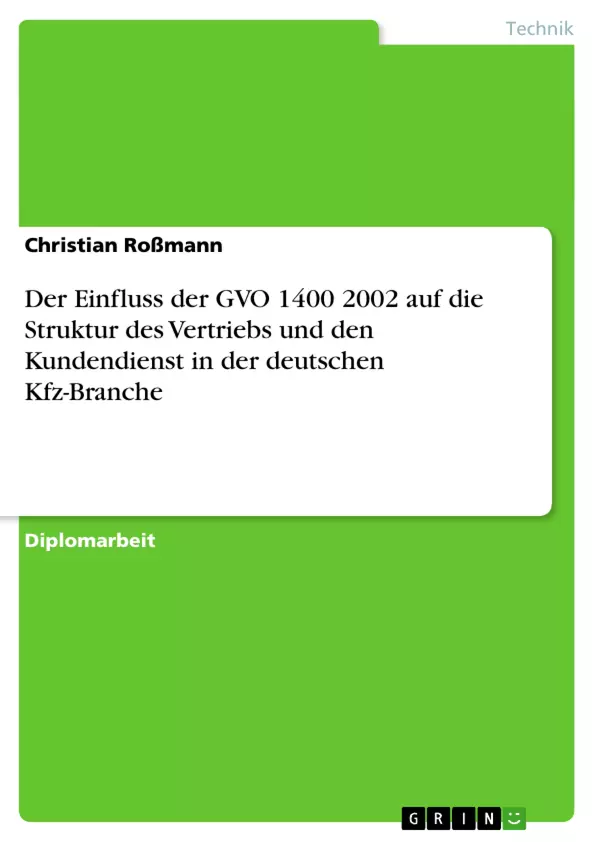Neue Kraftfahrzeuge (Kfz) werden in allen Ländern der Europäischen Union über ein selektives und exklusives Vertriebssystem abgesetzt. Dieses Vertriebssystem ist geprägt von vertikalen Vereinbarungen und Beschränkungen, die es den Kfz-Herstellern erlauben, die Qualität und Quantität ihrer Händlernetze selbst zu bestimmen. Das Absatzsystem steht somit nicht jedem Interessenten offen und entfalten dadurch eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung. Wettbewerbsbeschränkungen sind gemäß Art. 81 Abs. 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) aber grundsätzlich verboten. Dieses Verbot wird durch einen Erlaubnisvorbehalt in Art. 81 Abs. 3 EGV abgemildert, so dass Unternehmen oder ganze Branchen durch Einzel- oder Gruppenfreistellungen davon befreit werden können.
Mit der Verabschiedung der Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) 1400/2002 am 17.07.2002 wurde die kontrovers geführte Diskussion um die Verlängerung, Neugestaltung oder den Wegfall einer sektorspezifischen Gruppenfreistellung für die Kfz-Branche beendet. Die GVO 1400/2002 ist die dritte Kfz-GVO in Folge, allerdings beinhaltet sie umfangreiche Änderungen gegenüber der bis zum 30.09.2002 befristeten Kfz-GVO 1475/95. Gleichzeitig bestätigt sie aber die Notwendigkeit einer Kfz-spezifischen Freistellung von Art. 81 Abs. 1 EGV und erlaubt vertikale Vereinbarungen im Kfz-Handel, da diese „[...] die wirtschaftliche Effizienz innerhalb einer Produktions- oder Vertriebskette erhöhen, indem sie eine bessere Koordinierung zwischen den beteiligten Unternehmen ermöglichen.“
Die GVO 1400/2002 bietet den vom Neuwagenvertrieb, Kundendienst und Ersatzteilevertrieb betroffenen Akteuren und Institutionen Rechtssicherheit vom 01.10.2002 bis zum 31.05.2010. Dennoch verursacht die fundamentale Neustrukturierung der Kfz-GVO, die das „Grundgesetz für den Automobilhändler-Vertrag“ darstellt, viele Unsicherheiten für die Kfz-Branche. Diese Unsicherheiten resultieren vor allem aus dem Umstand, dass der präskriptive Effekt einer "Zwangsjacke" bezüglich des selektiven und exklusiven Neuwagenvertriebs und Kundendienstes, wie er durch die GVO 1475/95 erzeugt worden ist, zugunsten von Wahlmöglichkeiten in diesen Bereichen aufgehoben wurde. Die daraus resultierenden Chancen bieten aber insbesondere für deutsche Vertragshändler und freie Werkstätten zusätzliche, schlecht kalkulierbare Risiken mit häufig unmittelbaren existenziellen Folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Erklärung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
- Verwendete Abkürzungen
- 1 Einleitung
- 1.1 Die Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Grundlagen zur Bedeutung und Struktur des deutschen Kfz-Handels
- 2.1 Grundlegende Begriffsdefinitionen und Gestaltungsformen von Vertriebs- und Kundendienstsystemen
- 2.1.1 Die Absatzkanalstruktur
- 2.1.1.1 Vertikale Selektion
- 2.1.1.2 Horizontale Selektion
- 2.1.2 Struktur des "After-sale-Service"
- 2.1.2.1 Der Kundendienst bzw. Service
- 2.1.2.2 Der Ersatzteilevertrieb
- 2.2 Aufbau und Entwicklung des deutschen Kfz-Vertriebs
- 2.2.1 Ausprägungen und Stellenwert des Kfz-Vertriebs bis 1945
- 2.2.2 Der Vertrieb und Kundendienst nach dem zweiten Weltkrieg
- 2.3 Der selektive und exklusive Vertrieb über Vertragshändler
- 2.4 Wettbewerbsbeschränkende Wirkungen des selektiven und exklusiven Vertriebssystems
- 2.1 Grundlegende Begriffsdefinitionen und Gestaltungsformen von Vertriebs- und Kundendienstsystemen
- 3 Die Kongruenz des selektiven Vertriebs mit dem europäischen Kartellrecht
- 3.1 Der Kfz-Vertrieb vor dem Hintergrund des europäischen Kartellrechts
- 3.1.1 Das europäische Kartellrecht nach Art. 81 EGV
- 3.1.2 Die kartellrechtliche Bedrohung des Kfz-Vertriebssystems
- 3.2 Die BMW-Einzelfreistellung
- 3.3 Die Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung 123/85
- 3.3.1 Anwendung und Struktur der GVO 123/85
- 3.3.2 Ausgewählte Regelungen der GVO 123/85
- 3.3.2.1 Fachhandelsbindungen
- 3.3.2.2 Konkurrenzverbote
- 3.3.2.3 Das Vertragsgebiet
- 3.3.2.4 Schutz der unabhängigen Werkstätten, Wiederverkäufer und der Verbraucher
- 3.3.2.5 Diskriminierungsverbote
- 3.3.2.6 Mindestlaufzeiten und Kündigungsfristen
- 3.3.2.7 Der Entzug der Gruppenfreistellung
- 3.3.3 Kritikpunkte und Problemfelder der GVO 123/85
- 3.4 Die Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung 1475/95
- 3.4.1 Aufbau und Struktur der GVO 1475/95
- 3.4.2 Ausgewählte Änderungen und Neuerungen sowie praktische Probleme der GVO 1475/95
- 3.4.2.1 Größere Unabhängigkeit und Schutz der Vertragshändler vor den Kfz-Herstellern
- 3.4.2.2 Mehr Wettbewerb im Kundendienstbereich
- 3.4.2.3 Förderung des grenzübergreifenden Vertriebs
- 3.4.3 Verfahren gegen die Kfz-Hersteller wegen Verstößen gegen die GVO 1475/95
- 3.4.4 Fazit zum Status quo der GVO 1475/95
- 3.4.4.1 Wirksamer Intrabrand-Wettbewerb und Interbrand-Wettbewerb
- 3.4.4.2 Verbesserung der Rahmenbedingungen für Endkunden
- 3.4.4.3 Die Stärkung der Unabhängigkeit der Händler und Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- 3.4.4.4 Der Schutz des Wettbewerbs im Kundendienstbereich durch eine Stärkung der Teilelieferanten und der freien Werkstätten
- 4 Aktuelle Entwicklungen des Kfz-Vertriebs und der Paradigmenwechsel durch die GVO 1400/2002
- 4.1 Die strukturelle Ausgangssituation vor der Verabschiedung der neuen Kfz-GVO
- 4.2 Die Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung 1400/2002
- 4.2.1 Die Intention der GVO 1400/2002
- 4.2.2 Aufbau und Struktur der GVO 1400/2002
- 4.2.3 Ausgewählte Neuregelungen der GVO 1400/2002
- 4.2.3.1 Der Vertrieb neuer Kfz
- 4.2.3.2 Die Wartung und Reparatur von Kfz
- 5 Denkbare Konsequenzen der GVO 1400/2002 für die deutsche Kfz-Branche
- 5.1 Anpassungsmaßnahmen der Automobilhersteller
- 5.1.1 Die Wahl des Vertriebssystems und der Absatzstruktur
- 5.1.2 Veränderungen in der Kundendienststruktur
- 5.1.3 Die Bereitstellung technischer Informationen
- 5.1.4 Preisharmonisierung durch die neue GVO
- 5.1.5 Nichtanwendbarkeit der Verordnung
- 5.2 Folgen für die (bisherigen) Vertragshändler
- 5.2.1 Die Wahlmöglichkeiten für etablierte Vertragshändler
- 5.2.2 Problembereiche des zukünftigen Kfz-Vertriebs für die Vertragshändler
- 5.2.3 Chancen für die Vertragshändler
- 5.3 Transformationsprozesse im Kundendienst-Sektor
- 5.3.1 Autorisierung zur Vertragswerkstatt: Chance oder Risiko?
- 5.3.2 Kundendienstpotenziale für Vertragswerkstätten
- 5.3.3 Der Wettbewerb durch "Unabhängige Marktbeteiligte"
- 5.4 Der Einfluss auf den Ersatzteilevertrieb
- 5.4.1 Die Vertriebspotenziale der Teilelieferanten
- 5.4.2 Die Vertriebspotenziale der Kfz-Hersteller
- 5.5 Konsequenzen für die Verbraucher
- 5.5.1 Der Neuwagenkauf
- 5.5.2 Der Kundendienst
- 5.1 Anpassungsmaßnahmen der Automobilhersteller
- 6 Schlussbemerkung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert den Einfluss der GVO 1400/2002 auf die Struktur des Vertriebs und den Kundendienst in der deutschen Kfz-Branche. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der neuen Verordnung auf die Beziehungen zwischen Automobilherstellern, Vertragshändlern, freien Werkstätten und Verbrauchern. Dabei werden die Veränderungen im Vertriebssystem, der Kundendienststruktur und den Ersatzteilmärkten im Detail beleuchtet.
- Die Entwicklung des deutschen Kfz-Vertriebs und die Rolle des selektiven und exklusiven Vertriebs
- Die Bedeutung des europäischen Kartellrechts für den Kfz-Vertrieb und die Regulierung durch GVOs
- Die Inhalte und Auswirkungen der GVO 1400/2002 auf die Akteure der Kfz-Branche
- Die Anpassungsmaßnahmen der Automobilhersteller, Vertragshändler und freien Werkstätten
- Die Folgen für den Verbraucher und die Auswirkungen auf den Wettbewerb im Kundendienstbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und den Gang der Untersuchung darstellt. Anschließend werden die Grundlagen zur Bedeutung und Struktur des deutschen Kfz-Handels erörtert, wobei die verschiedenen Begriffsdefinitionen und Gestaltungsformen von Vertriebs- und Kundendienstsystemen beleuchtet werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung des deutschen Kfz-Vertriebs und den wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen des selektiven und exklusiven Vertriebssystems.
Im dritten Kapitel wird die Kongruenz des selektiven Vertriebs mit dem europäischen Kartellrecht untersucht, indem das europäische Kartellrecht nach Art. 81 EGV und die kartellrechtliche Bedrohung des Kfz-Vertriebssystems analysiert werden. Des Weiteren werden die BMW-Einzelfreistellung und die Kfz-Gruppenfreistellungsverordnungen 123/85 und 1475/95 im Detail betrachtet, wobei die jeweiligen Regelungen, Kritikpunkte und Problemfelder beleuchtet werden.
Das vierte Kapitel widmet sich den aktuellen Entwicklungen des Kfz-Vertriebs und dem Paradigmenwechsel durch die GVO 1400/2002. Die strukturelle Ausgangssituation vor der Verabschiedung der neuen Verordnung wird dargestellt, und die Intention, der Aufbau und die Struktur der GVO 1400/2002 werden erläutert.
Im fünften Kapitel werden die denkbaren Konsequenzen der GVO 1400/2002 für die deutsche Kfz-Branche diskutiert. Hierbei werden die Anpassungsmaßnahmen der Automobilhersteller, die Folgen für die Vertragshändler, die Transformationsprozesse im Kundendienst-Sektor und der Einfluss auf den Ersatzteilevertrieb beleuchtet. Des Weiteren werden die Konsequenzen für die Verbraucher in Bezug auf den Neuwagenkauf und den Kundendienst analysiert.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Themen des deutschen Kfz-Vertriebs, dem selektiven und exklusiven Vertrieb, dem europäischen Kartellrecht, den GVOs 123/85, 1475/95 und 1400/2002, den Auswirkungen der GVO 1400/2002 auf die Kfz-Branche, den Anpassungsmaßnahmen der Automobilhersteller, den Folgen für die Vertragshändler, den Transformationsprozessen im Kundendienst-Sektor, dem Einfluss auf den Ersatzteilevertrieb und den Konsequenzen für die Verbraucher.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die GVO 1400/2002 in der Kfz-Branche?
Es ist eine Gruppenfreistellungsverordnung der EU, die vertikale Vereinbarungen im Kfz-Handel und Kundendienst regelt und vom Kartellverbot befreit.
Wie beeinflusst die Verordnung den Neuwagenvertrieb?
Sie hob die strikte Bindung von Verkauf und Werkstatt auf und ermöglichte Händlern mehr Wahlmöglichkeiten zwischen selektivem und exklusivem Vertrieb.
Welche Auswirkungen hat die GVO auf freie Werkstätten?
Die Verordnung stärkte unabhängige Werkstätten, indem sie den Zugang zu technischen Informationen und Original-Ersatzteilen erleichterte.
Was bedeutet die GVO 1400/2002 für den Verbraucher?
Ziel war mehr Wettbewerb, was zu einer größeren Auswahl bei Werkstätten, besseren Preisen beim Neuwagenkauf und grenzüberschreitendem Handel führen sollte.
Warum wird von einem "Paradigmenwechsel" gesprochen?
Weil die GVO 1400/2002 die zuvor sehr starren Strukturen der GVO 1475/95 durch flexiblere, marktorientierte Wahlmöglichkeiten ersetzte.
Welche Risiken entstanden für Vertragshändler?
Durch den Wegfall des Gebietsschutzes und die Öffnung des Kundendienstes stieg der Wettbewerbsdruck massiv an, was für viele Betriebe existenzbedrohend war.
- 3.1 Der Kfz-Vertrieb vor dem Hintergrund des europäischen Kartellrechts
- Quote paper
- Christian Roßmann (Author), 2003, Der Einfluss der GVO 1400 2002 auf die Struktur des Vertriebs und den Kundendienst in der deutschen Kfz-Branche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33288