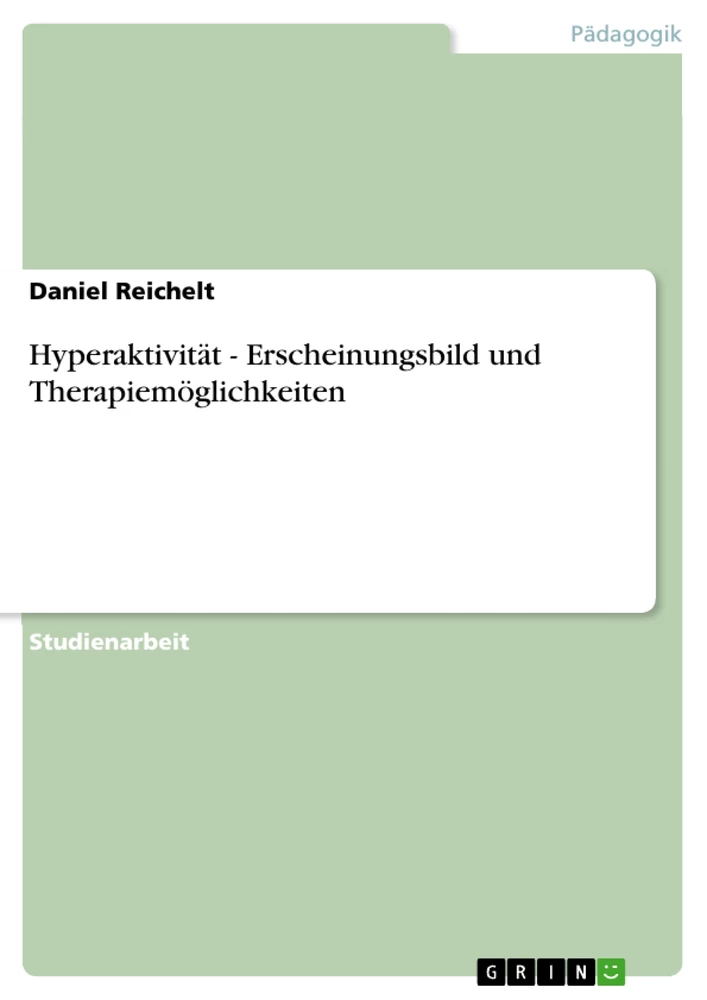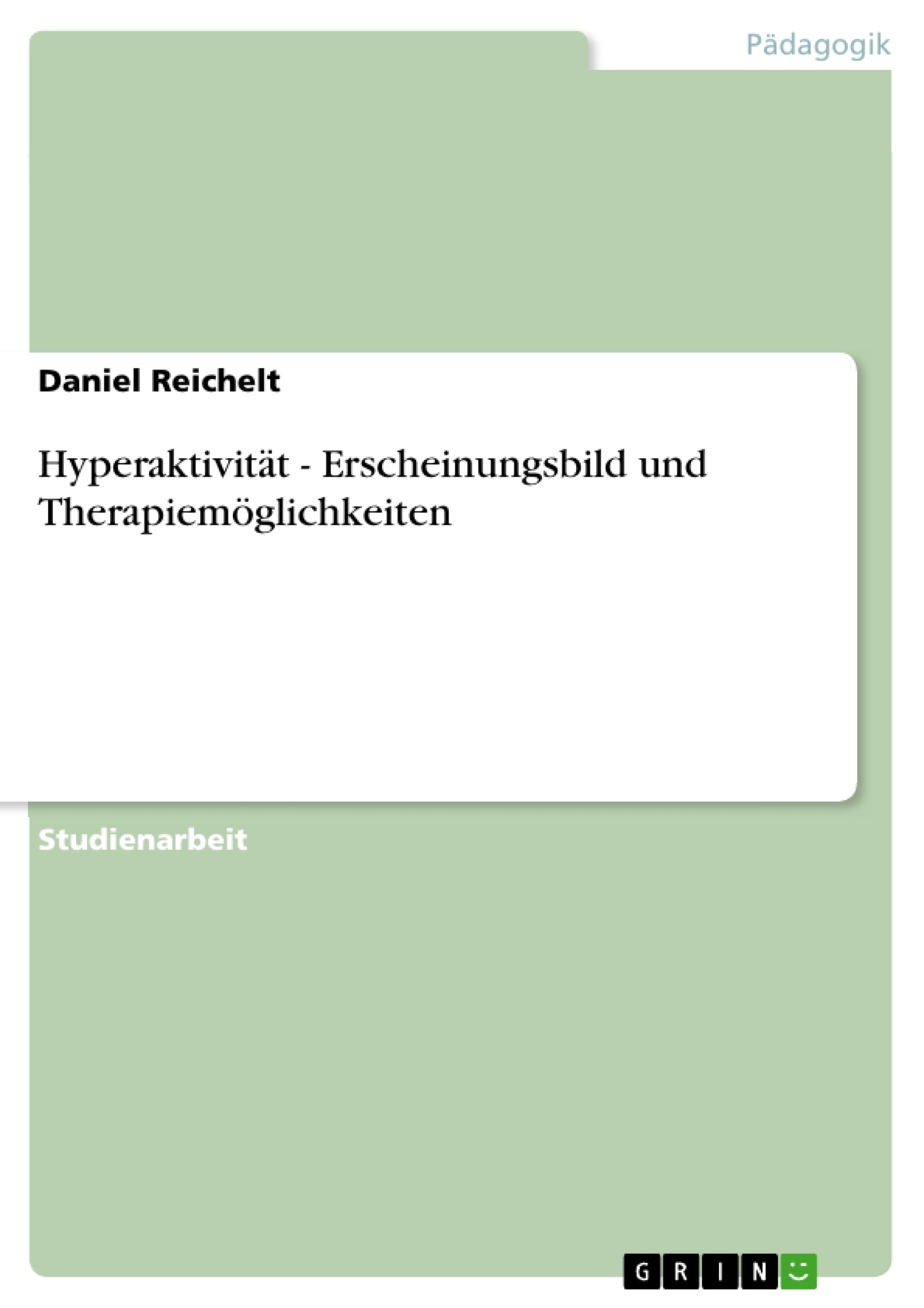"Die Lehrerin der dritten Grundschulklasse kommt mit dem acht Jahre alten Philipp überhaupt nicht zurecht. Währen des Unterrichts kann dieser keine Minute still sitzen, wie die anderen zuhören, sich melden, in Ruhe seinen Arbeitsauftrag erledigen. Philipp ist immer in Bewegung. Er wechselt ständig seine Sitzposition, oft kniet er auf dem Stuhl, manchmal fällt er vor lauter zappeln herunter.
Sei Tisch ist ein wahres Chaos, weil er es nicht schafft, Ordnung zu halten. Immer wieder läuft er von seinem Platz weg, zur Lehrerin nach vorn, zu anderen Kindern hin, womit Konflikte vorprogrammiert sind. Er kann sich kaum einige Augenblicke auf eine Arbeit konzentrieren, schon wird er wieder durch irgend etwas abgelenkt und in Bewegung versetzt. Besonders im Sportunterricht und in der Pause gibt es immer wieder Zusammenstöße mit anderen Schülern, weil er sich in seinem Bewegungsdrang nicht bremsen lässt und andere übersieht.
Die Mitschüler halten Philipp für verrückt. Die Lehrerin ist deshalb so verzweifelt, weil ihre Erziehungsmittel, die bei anderen Kindern erfolgreich sind, bei Philipp versagen. Er scheint weder durch Ermahnung, Zurechtweisungen, Strafen, noch durch positive Zuwendungen beeinflußbar zu sein. In Gesprächen beteuert er, sich zu bessern, sich zusammenzunehmen; ein Versprechen, das gerade fünf Minuten durchhält...." (Rausch/Schlegel S.2)
Ein solches unruhiges, unkonzentriertes Verhalten wird unter dem Begriff der Hyperaktivität zusammengefasst. Die vielfältigen Variationen der Hyperaktivität erfordern eine differenzierte Betrachtung. Das Erscheinungsbild wird in dieser Arbeit differenziert dargestellt, woran sich Diagnose- und Therapiemöglichkeiten anschließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fallbeispiel
- 2. Begriffserklärung
- 3. Erscheinungsbild
- 3.1. Übertriebener Tätigkeitsdrang
- 3.2. Konzentrationsschwierigkeiten
- 3.3. In Anspruch nehmendes Verhalten und Mangel an Zärtlichkeit
- 3.4. Impulsivität
- 3.5. Wahrnehmungs- und Lernschwierigkeiten
- 3.6. Koordinationsschwierigkeiten
- 3.7. Widerspenstiges und herrschsüchtiges Verhalten
- 4. Vorkommen
- 5. Diagnose
- 5.1. Klassifikationssysteme
- 5.2. Medizinische Diagnostik
- 5.3. Psychologisch Diagnostik
- 6. Erklärungsmodelle
- 7. Intervention
- 7.1. Medizinische Ansätze
- 7.1.1. Stimulantien
- 7.1.2. Neuroleptika
- 7.1.3. Antidepressivika
- 7.2. Diät
- 7.2.1. Feingolds Hypothese
- 7.2.2. Phosphat-Hypothese
- 7.2.3. Allergie-Hypothese
- 7.3. Psychologisch Ansätze
- 7.1. Medizinische Ansätze
- 8. Möglichkeiten der Lehrer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen der Hyperaktivität umfassend zu beschreiben und zu erläutern. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte, von der Definition und dem Erscheinungsbild bis hin zu Diagnose- und Interventionsmöglichkeiten.
- Definition und Begriffsklärung von Hyperaktivität
- Vielfältige Erscheinungsformen und Symptome
- Diagnosemethoden und -ansätze
- Erklärungsmodelle für Hyperaktivität
- Interventionen und therapeutische Möglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fallbeispiel: Die Arbeit beginnt mit dem Fallbeispiel des achtjährigen Philipp, der durch extreme Unruhe, Konzentrationsstörungen und impulsivem Verhalten auffällt. Dieses Beispiel dient als anschauliche Einführung in das Thema Hyperaktivität und veranschaulicht die Herausforderungen, die mit diesem Syndrom verbunden sind, sowohl für das betroffene Kind als auch für sein Umfeld (Lehrer, Mitschüler).
2. Begriffserklärung: Dieses Kapitel klärt den Begriff "Hyperaktivität" und seine Synonyme, wie das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS). Es wird auf die unterschiedlichen Bezeichnungen und die damit verbundenen wissenschaftlichen Perspektiven eingegangen, welche die Vielfältigkeit der Erklärungsansätze verdeutlichen.
3. Erscheinungsbild: Hier werden die verschiedenen Erscheinungsformen der Hyperaktivität detailliert beschrieben. Es werden Aspekte wie übertriebener Bewegungsdrang, Konzentrationsschwierigkeiten, impulsives Verhalten, Wahrnehmungs- und Lernschwierigkeiten, Koordinationsprobleme und ein oft widerspenstiges Verhalten beleuchtet. Diese Beschreibung bietet ein umfassendes Bild der Symptomatik und ihrer Auswirkungen auf den Alltag betroffener Kinder.
4. Vorkommen: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Häufigkeit des Auftretens von Hyperaktivität. (Anmerkung: Der gelieferte Text enthält keine weiteren Details zu diesem Kapitel. Eine detaillierte Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
5. Diagnose: Das Kapitel "Diagnose" beschreibt die verschiedenen Methoden zur Erkennung von Hyperaktivität. Es werden Klassifikationssysteme, medizinische und psychologische Diagnostik-Verfahren erläutert. Der Fokus liegt auf der Differenzierung und der Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung, um eine korrekte Diagnose zu stellen.
6. Erklärungsmodelle: (Anmerkung: Der gelieferte Text enthält keine Informationen zu diesem Kapitel. Eine detaillierte Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
7. Intervention: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Interventionsmöglichkeiten bei Hyperaktivität. Medizinische Ansätze wie die Anwendung von Stimulantien, Neuroleptika und Antidepressivika werden ebenso behandelt wie diätetische Maßnahmen (Feingold-Hypothese, Phosphat-Hypothese, Allergie-Hypothese) und psychologische Ansätze. Die Zusammenfassung hebt die Vielschichtigkeit der Therapie hervor und zeigt die verschiedenen Möglichkeiten auf, die je nach individuellem Bedarf eingesetzt werden können.
8. Möglichkeiten der Lehrer: (Anmerkung: Der gelieferte Text enthält keine Informationen zu diesem Kapitel. Eine detaillierte Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Schlüsselwörter
Hyperaktivität, Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Impulsivität, Diagnose, Intervention, Therapie, Stimulantien, Diät.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Hyperaktivität: Ein umfassender Überblick"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Hyperaktivität. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die behandelten Aspekte reichen von Fallbeispielen und Begriffserklärungen über das Erscheinungsbild und das Vorkommen von Hyperaktivität bis hin zu Diagnosemethoden, Erklärungsmodellen und Interventionsmöglichkeiten (medizinische, diätetische und psychologische Ansätze).
Welche Kapitel sind im Dokument enthalten?
Das Dokument ist in acht Kapitel gegliedert: 1. Fallbeispiel, 2. Begriffserklärung, 3. Erscheinungsbild, 4. Vorkommen, 5. Diagnose, 6. Erklärungsmodelle, 7. Intervention und 8. Möglichkeiten der Lehrer. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Was wird im Kapitel "Fallbeispiel" behandelt?
Das Kapitel "Fallbeispiel" beschreibt den Fall des achtjährigen Philipp, der durch extreme Unruhe, Konzentrationsstörungen und impulsives Verhalten auffällt. Es dient als anschauliche Einführung in das Thema und veranschaulicht die Herausforderungen, die mit Hyperaktivität verbunden sind.
Was wird im Kapitel "Begriffserklärung" erläutert?
Das Kapitel "Begriffserklärung" klärt den Begriff "Hyperaktivität" und seine Synonyme, wie das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS). Es beleuchtet unterschiedliche Bezeichnungen und wissenschaftliche Perspektiven.
Welche Erscheinungsformen von Hyperaktivität werden beschrieben?
Das Kapitel "Erscheinungsbild" beschreibt detailliert verschiedene Erscheinungsformen: übertriebener Bewegungsdrang, Konzentrationsschwierigkeiten, impulsives Verhalten, Wahrnehmungs- und Lernschwierigkeiten, Koordinationsprobleme und widerspenstiges Verhalten.
Wie wird Hyperaktivität diagnostiziert?
Das Kapitel "Diagnose" beschreibt verschiedene Methoden zur Erkennung von Hyperaktivität, einschließlich Klassifikationssysteme, medizinischer und psychologischer Diagnostik-Verfahren. Der Fokus liegt auf der umfassenden Betrachtung für eine korrekte Diagnose.
Welche Interventionsmöglichkeiten werden vorgestellt?
Das Kapitel "Intervention" behandelt verschiedene Interventionsmöglichkeiten: medizinische Ansätze (Stimulantien, Neuroleptika, Antidepressivika), diätetische Maßnahmen (Feingold-Hypothese, Phosphat-Hypothese, Allergie-Hypothese) und psychologische Ansätze.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Thema?
Die Schlüsselwörter umfassen: Hyperaktivität, Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Impulsivität, Diagnose, Intervention, Therapie, Stimulantien und Diät.
Welche Informationen fehlen in der Zusammenfassung?
Die Zusammenfassungen der Kapitel 4 (Vorkommen), 6 (Erklärungsmodelle) und 8 (Möglichkeiten der Lehrer) sind unvollständig, da der zugrunde liegende Text keine ausreichenden Details enthielt.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Hyperaktivität.
- Quote paper
- Daniel Reichelt (Author), 2000, Hyperaktivität - Erscheinungsbild und Therapiemöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3329