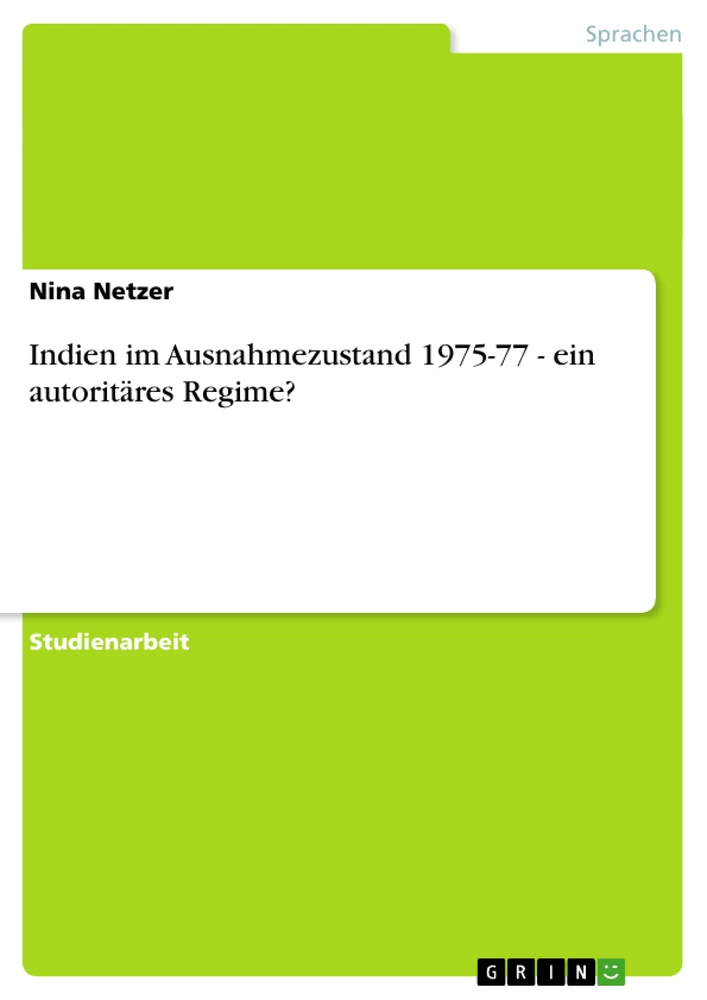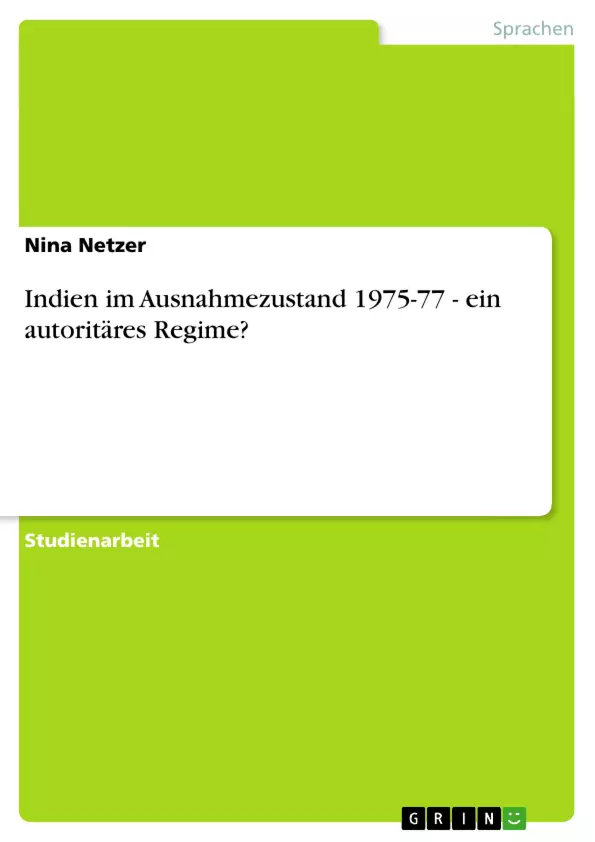Das politische System Indiens ist mit mehr als 650 Millionen Wählern die zahlenmäßig größte Demokratie weltweit. Allein dieser Aspekt führt dazu, dass die Untersuchung dieses Systems ein spannendes und lohnendes Thema darstellt. Ein weiterer Punkt findet sich in der gesellschaftlichen Pluralität und der regionalen Vielfalt: aus dieser ergibt sich eine Fülle verschiedener Interessen, die sich in der großen Zahl politischer Parteien und Interessensgruppen widerspiegelt und in diesem Umfang in kaum einem anderen Land vorzufinden ist.
Gleichzeitig stellt diese gesellschaftliche Pluralität eine große Herausforderung an die Demokratie dar, nicht zuletzt weil sich aus ihr Probleme wie Armut, Analphabetismus und die Schwierigkeit einer hierarchischen Gesellschaftsordnung ergeben, die der Demokratie häufig Grenzen setzen. 1
Nicht zuletzt deshalb sagen Kritiker seit dem Bestehen der indischen Demokratie ihr Ende voraus, da „eine große Zahl wichtiger Indikatoren des Umfeldes nicht unbedingt als demokratieförderlich angesehen werden können.“ 2 Erschwerend kommt hinzu, dass die „Anfälligkeit nachkolonialer Staaten der ‚Dritten Welt’ für diktatorische Regierungsformen“ 3 bekannt ist, und so sahen viele Wissenschaftler den Beweis für den Untergang der indischen Demokratie, als Indira Gandhi 1975 den Ausnahmezustand 4 ausrief. Doch entgegen aller Skepsis hat sich die indische Demokratie bewährt:
„The democratic system in India not only survived [...] the emergency but emerged stronger.“ 5
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Indien zur Zeit des Ausnahmezustandes von 1975-77 ein autoritäres Regime war. Dazu werde ich in Teil 2 zunächst klären, wie die Möglichkeit des Emergency in der indischen Verfassung geregelt ist, um daraufhin zu beschreiben, wie diese konstitutionelle Grundlage 1975 genutzt wurde, um den Notstand auszurufen. Einen bedeutenden Teil wird die Beschreibung der Emergency-Maßnahmen und deren Auswirkungen einnehmen. Teil 3 behandelt das Kernthema der Arbeit. Zunächst soll durch einen Abriss der politikwissenschaftlichen Debatte über die Herrschaftsformen Demokratie und Autokratie eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Indien und der Emergency
- Ausnahmezustand in der indischen Verfassung
- Indira Gandhis Ausnahmezustand 1975-77
- Indien zur Zeit des Emergency – ein autoritäres Regime?
- Autokratie und Demokratie in der Politikwissenschaft
- Wolfgang Merkels Herrschaftstypologie
- Einordnung des indischen Emergency-Falls
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob Indien während des Ausnahmezustandes von 1975 bis 1977 als autoritäres Regime einzustufen ist. Die Analyse basiert auf der Untersuchung der verfassungsrechtlichen Grundlagen des Ausnahmezustandes in Indien, der konkreten Maßnahmen Indira Gandhis und einer politikwissenschaftlichen Einordnung des Falls mithilfe der Herrschaftstypologie von Wolfgang Merkel.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen des Ausnahmezustandes in Indien
- Indira Gandhis Maßnahmen während des Emergency (1975-1977)
- Politikwissenschaftliche Definitionen von Autokratie und Demokratie
- Anwendung von Merkels Herrschaftstypologie auf den indischen Fall
- Bewertung der indischen Demokratie während des Emergency
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die indische Demokratie als die zahlenmäßig größte Demokratie der Welt vor und hebt deren Herausforderungen aufgrund gesellschaftlicher Pluralität und regionaler Vielfalt hervor. Sie erwähnt kritische Stimmen, die das Ende der indischen Demokratie prophezeiten, insbesondere im Kontext des Ausnahmezustandes von 1975-77 unter Indira Gandhi. Die Arbeit untersucht, ob Indien während dieser Zeit ein autoritäres Regime war.
Indien und der Emergency: Dieses Kapitel beschreibt zunächst die verfassungsrechtlichen Regelungen zum Ausnahmezustand in Indien (Part 18, Art. 352), die auf die Kolonialzeit zurückgehen und dem Präsidenten weitreichende Befugnisse einräumen. Im Gegensatz zu anderen Ländern sind diese Befugnisse in der indischen Verfassung explizit festgelegt. Im zweiten Teil beschreibt das Kapitel Indira Gandhis Ausnahmezustand von 1975-77, der mit der Proklamation durch den Präsidenten begann. Es werden die wirtschaftlichen und sozialen Probleme ("Pre-Emergency-Crisis") der vorhergehenden Jahre beleuchtet, die zu Unruhen führten und als Rechtfertigung für Gandhis Handeln teilweise angeführt werden.
Indien zur Zeit des Emergency – ein autoritäres Regime?: Dieses Kapitel analysiert, ob Indien während des Ausnahmezustandes ein autoritäres Regime war. Es beginnt mit einem Abriss der politikwissenschaftlichen Debatte über Autokratie und Demokratie und verwendet die Herrschaftstypologie von Wolfgang Merkel zur Einordnung des indischen Falls. Dieses Kapitel, welches das Kernstück der Arbeit darstellt, untersucht die konkreten Auswirkungen der Maßnahmen während des Ausnahmezustands und deren Konsequenzen für die Funktionsfähigkeit der indischen Demokratie.
Schlüsselwörter
Indien, Ausnahmezustand (Emergency), Indira Gandhi, autoritäres Regime, Demokratie, Verfassung, Wolfgang Merkel, Herrschaftstypologie, Machtkonzentration, Grundrechte, wirtschaftliche Krise, soziale Unruhen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse des indischen Ausnahmezustandes (1975-1977)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob Indien während des Ausnahmezustandes (Emergency) von 1975 bis 1977 als autoritäres Regime einzustufen ist. Die Analyse basiert auf der Untersuchung der verfassungsrechtlichen Grundlagen des Ausnahmezustandes, der konkreten Maßnahmen Indira Gandhis und einer politikwissenschaftlichen Einordnung mithilfe der Herrschaftstypologie von Wolfgang Merkel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Ausnahmezustandes in Indien, Indira Gandhis Maßnahmen während des Emergency (1975-1977), politikwissenschaftliche Definitionen von Autokratie und Demokratie, die Anwendung von Merkels Herrschaftstypologie auf den indischen Fall und eine Bewertung der indischen Demokratie während des Emergency.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über Indien und den Emergency (inkl. der verfassungsrechtlichen Grundlagen und Gandhis Maßnahmen), ein Kapitel zur Analyse, ob Indien während des Emergency ein autoritäres Regime darstellte (inkl. der Anwendung von Merkels Herrschaftstypologie), und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt die indische Verfassung?
Die Arbeit untersucht die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Ausnahmezustandes in Indien (Part 18, Art. 352), die dem Präsidenten weitreichende Befugnisse einräumen. Diese Befugnisse werden im Kontext des Emergency und ihrer Anwendung durch Indira Gandhi analysiert.
Welche Rolle spielt Wolfgang Merkels Herrschaftstypologie?
Merkels Herrschaftstypologie dient als analytisches Werkzeug, um den indischen Ausnahmezustand zu klassifizieren und zu beurteilen, inwieweit die Merkmale eines autoritären Regimes erfüllt waren. Die Arbeit wendet dieses Modell auf die konkreten Maßnahmen und Folgen des Emergency an.
Welche Schlussfolgerung wird angestrebt?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine fundierte Antwort auf die Frage zu geben, ob Indien während des Emergency von 1975 bis 1977 als autoritäres Regime einzustufen ist, basierend auf einer verfassungsrechtlichen, politischen und politikwissenschaftlichen Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Indien, Ausnahmezustand (Emergency), Indira Gandhi, autoritäres Regime, Demokratie, Verfassung, Wolfgang Merkel, Herrschaftstypologie, Machtkonzentration, Grundrechte, wirtschaftliche Krise, soziale Unruhen.
Was sind die wirtschaftlichen und sozialen Hintergründe des Emergency?
Die Arbeit beleuchtet die wirtschaftlichen und sozialen Probleme ("Pre-Emergency-Crisis") vor dem Ausnahmezustand, die zu Unruhen führten und teilweise als Rechtfertigung für Indira Gandhis Handeln angeführt werden.
- Quote paper
- Nina Netzer (Author), 2004, Indien im Ausnahmezustand 1975-77 - ein autoritäres Regime?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33401