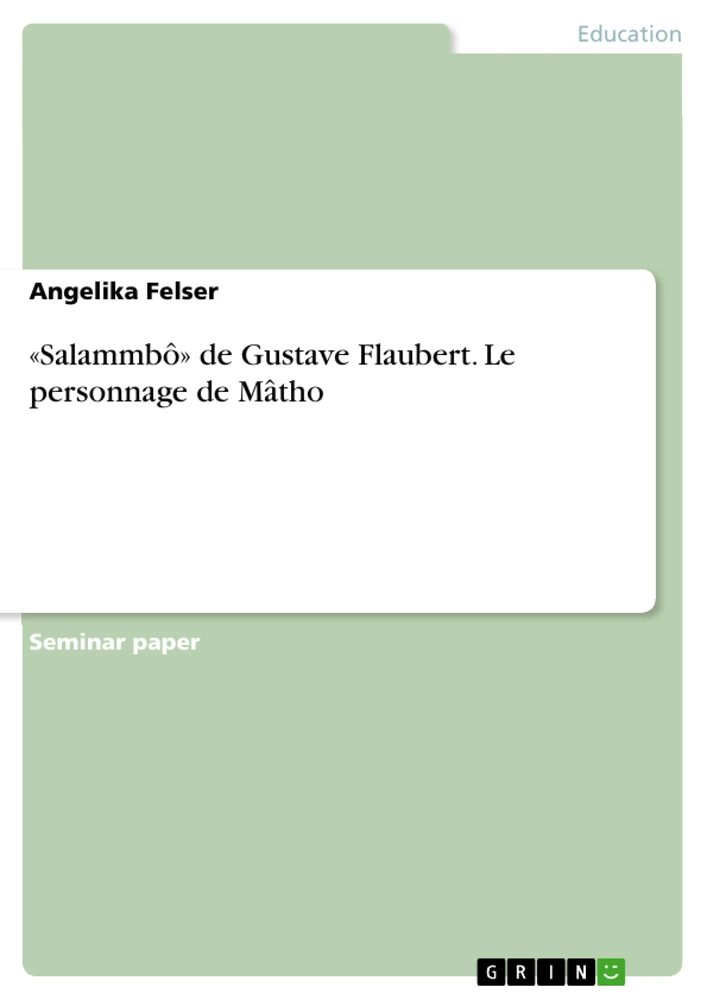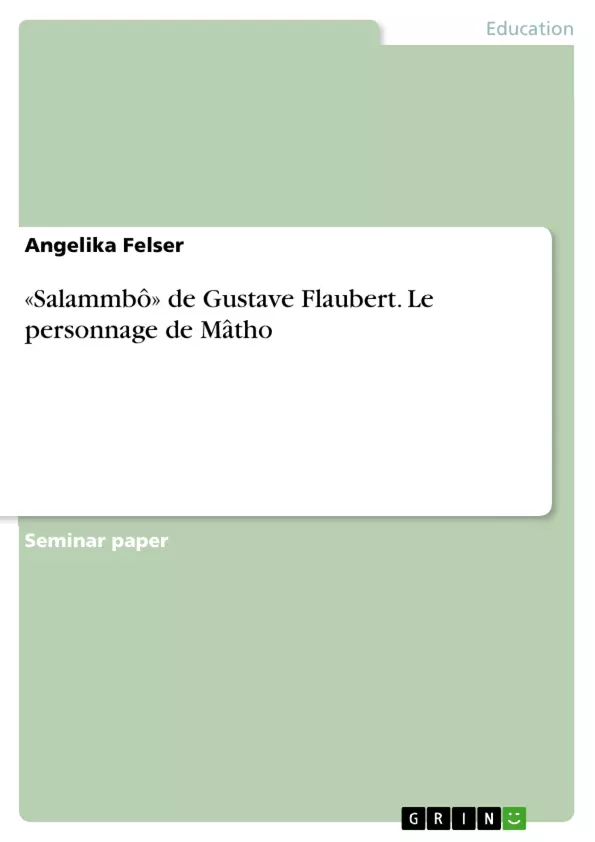Si l’on ne considère pas l’œuvre de Salammbô sous l’angle politique mais du côté poétique, on s’aperçoit qu’elle est au service du désir (c.f. l’expression de Flaubert: «convoitise de l’infini»). Ce n’est pas seulement un désir d’argent, de pouvoir, de jouissance de toutes sortes, mais aussi un désir de savoir qui est également celui de l’auteur. Flaubert veut connaître et comprendre son temps ainsi que le passé et les hommes de ce passé. Il s’est notamment penché, pour écrire Salammbô, sur le mode de la pensée humaine. Pour cela, Flaubert a tenté de rassembler toutes les pratiques mentales humaines, toutes les mentalités correspondant à des imaginaires humains différents pour faire de cet inventaire un éventail toujours représentatif de l’homme quel que soit l’époque où il vit. Pour lui, toutes les pratiques mentales connues (surtout les convoitises archaïques comme par exemple la volonté de posséder d’autres territoires…) sont toujours présentes virtuellement dans la pensée humaine. D’après Flaubert, malgré l’évolution des mœurs, la cruauté humaine et la barbarie irrationnelle sont enfouies en l’homme. Il en a une nostalgie violente qui peut resurgir à n’importe quelle occasion.
Dans Salammbô, Flaubert nous présente ce phénomène dans tout le livre, chez les Mercenaires aussi bien que chez les Carthaginois, mais en particulier à travers le personnage de Mâtho. Ce dernier ne pouvant atteindre ce qu’il désire le plus - Salammbô – déchaîne donc petit à petit sa nature primitive et féroce. Sa barbarie, qui augmente de plus en plus, le fait ressembler à certains moments au dieu Moloch, symbole ultime des qualités destructrices des hommes. Ainsi, Flaubert ayant joint l’image héroïque à l’image cosmique, nous démontre clairement son point de vue: il considère que les hommes qui ne sont pas raisonnables perdent de leur humanité et en deviennent moins humains.
Inhaltsverzeichnis
- I/ INTRODUCTION
- II/ MATHO: BARBARE UND GUERRIER
- III/ MATHO: DER LIEBHABER
- III.1. Der Liebhaber in der ersten Liebesszene
- III.2. Die Folgen der ersten Liebesszene
- III.3. Mâtho: Der Liebhaber in der zweiten Szene „unter dem Zelt“
- IV/ DER TOD DES LETZTEN DER BARBAREN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Figur Mâthos im Roman "Salammbô" von Gustave Flaubert. Ziel ist es, Mâthos Entwicklung vom brutalen Barbaren zum leidenschaftlichen Liebhaber zu analysieren und seine Bedeutung für die Handlung und die thematischen Schwerpunkte des Romans zu beleuchten.
- Die Darstellung von Barbarei und Zivilisation im Konflikt
- Die Macht des Begehrens und seine zerstörerischen Folgen
- Die Ambivalenz der Figur Mâtho: zwischen animalischer Brutalität und leidenschaftlicher Liebe
- Die Rolle der Religion und des sakralen Objekts im Roman
- Die Verbindung von individueller Tragödie und historischem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
I/ INTRODUCTION: Die Einleitung beleuchtet Flauberts poetische Betrachtungsweise von "Salammbô", die sich auf den "Begierde des Unendlichen" konzentriert. Es geht nicht nur um materielle Begierden, sondern auch um den Wissensdurst Flauberts, der die menschliche Psyche in all ihren Facetten, insbesondere die archaischen Begierden und die stets präsente Möglichkeit der menschlichen Grausamkeit und Barbarei, ergründen will. Mâtho wird als Beispiel für diese menschliche Natur im Roman vorgestellt, wobei seine Entwicklung von der unbändigen Begierde nach Salammbô getrieben wird und ihn zu barbarischen Handlungen treibt, die ihn mit dem Gott Moloch in Verbindung bringen.
II/ MATHO: BARBARE UND GUERRIER: Mâthos erster Auftritt wird als brutal und gewalttätig beschrieben. Er erscheint zunächst anonym inmitten der mercenarischen Krieger nach dem karthagischen Sieg über Rom. Seine gewaltige Statur, sein Aussehen und seine Taten betonen seine Stärke und Virilität. Ein Zwischenfall, bei dem er Narr' Havas angreift, zeigt seine ungezügelte Wut und körperliche Überlegenheit. Flauberts Beschreibung unterstreicht Mâthos animalische Kraft, die ihn mit mythischen Figuren wie Herkules verbindet.
III/ MATHO: DER LIEBHABER: Mâthos ungezügelte Natur wird durch seine leidenschaftliche Liebe zu Salammbô gemildert. Diese Liebe führt zu einer Veränderung seiner Persönlichkeit. Aus dem unbezwingbaren Krieger wird ein melancholischer, von Sehnsucht geplagter Mann. Sein Wunsch, Salammbô zu besitzen, wird als Triebkraft dargestellt, der seine barbarische Seite wiederbelebt und einen Konflikt zwischen seiner wilden Natur und der zivilisierten Welt von Karthago erzeugt. Seine Begierde nach Salammbô wird symbolisch mit dem Wunsch verbunden, in Karthago einzudringen, was gleichzeitig den Wunsch nach Vereinigung mit der Kultur Karthagos darstellt.
III.1. Der Liebhaber in der ersten Liebesszene: Dieser Abschnitt beschreibt Mâthos Weg, die Distanz zwischen ihm und Salammbô zu überwinden. Der Schleier der Göttin Tanit, der gleichzeitig ein Symbol Karthagos darstellt, wird zum Instrument seiner Annäherung. Der Schleier löst eine physische und psychische Verwandlung in Mâtho aus; er gewinnt an Selbstvertrauen und seiner Kraft wird ein fast göttlicher Charakter zugeschrieben.
Schlüsselwörter
Salammbô, Gustave Flaubert, Mâtho, Barbarei, Zivilisation, Begierde, Liebe, Gewalt, Karthago, Religion, Tanit, menschliche Natur, archaische Begierden.
Häufig gestellte Fragen zu "Salammbô": Mâthos Entwicklung vom Barbaren zum Liebhaber
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur Mâthos im Roman "Salammbô" von Gustave Flaubert. Der Fokus liegt auf Mâthos Entwicklung vom brutalen Barbaren zum leidenschaftlichen Liebhaber und seiner Bedeutung für die Handlung und die zentralen Themen des Romans.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Barbarei und Zivilisation, die Macht des Begehrens und seine zerstörerischen Folgen, die Ambivalenz von Mâthos zwischen animalischer Brutalität und leidenschaftlicher Liebe, die Rolle der Religion und des sakralen Objekts (Tanit) im Roman, sowie die Verbindung von individueller Tragödie und historischem Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Mâtho als Barbar und Krieger, Mâtho als Liebhaber (unterteilt in die erste und zweite Liebesszene), und ein Kapitel zum Tod des letzten Barbaren. Zusätzlich enthält sie eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselwörter.
Wie wird Mâtho in den einzelnen Kapiteln dargestellt?
Kapitel II beschreibt Mâthos ersten Auftritt als brutalen und gewalttätigen Barbaren, der durch Stärke und Virilität charakterisiert ist. Kapitel III zeigt seine Entwicklung zum Liebhaber Salammbôs, wobei seine leidenschaftliche Liebe zu einer Veränderung seiner Persönlichkeit führt, jedoch auch seine barbarische Seite wiederbelebt. Die Unterkapitel III.1 und III.2 analysieren seine erste und zweite Liebesszene im Detail.
Welche Rolle spielt die Religion im Roman und in Mâthos Entwicklung?
Die Religion, insbesondere die Göttin Tanit und der Schleier als sakrales Objekt, spielt eine wichtige Rolle. Der Schleier der Tanit fungiert als Instrument in Mâthos Annäherung an Salammbô und löst in ihm eine physische und psychische Verwandlung aus. Die Verbindung Mâthos mit dem Gott Moloch wird ebenfalls thematisiert.
Welche Bedeutung hat Mâthos Entwicklung für die Gesamtinterpretation des Romans?
Mâthos Entwicklung verdeutlicht Flauberts Interesse an der menschlichen Psyche in all ihren Facetten, insbesondere an archaischen Begierden und der Möglichkeit menschlicher Grausamkeit und Barbarei. Er dient als Beispiel für die menschliche Natur, die von unbändiger Begierde getrieben wird und zu barbarischen Handlungen führen kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Salammbô, Gustave Flaubert, Mâtho, Barbarei, Zivilisation, Begierde, Liebe, Gewalt, Karthago, Religion, Tanit, menschliche Natur, archaische Begierden.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist die Analyse von Mâthos Entwicklung vom brutalen Barbaren zum leidenschaftlichen Liebhaber und die Erforschung seiner Bedeutung für die thematischen Schwerpunkte und die Handlung von Flauberts "Salammbô".
- Citation du texte
- Angelika Felser (Auteur), 1994, «Salammbô» de Gustave Flaubert. Le personnage de Mâtho, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334101