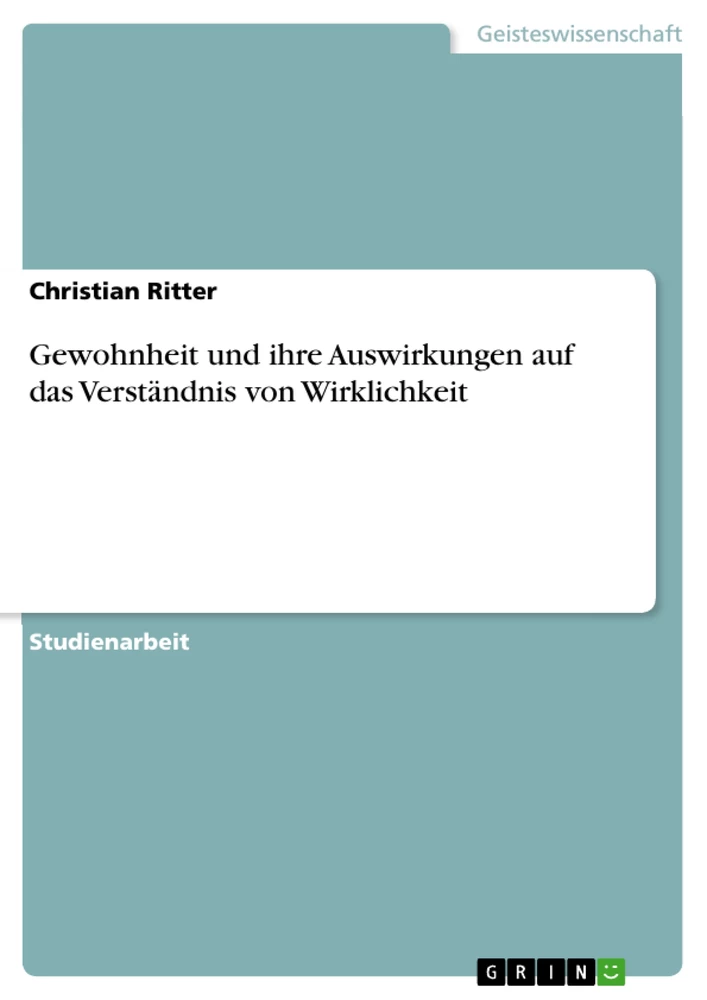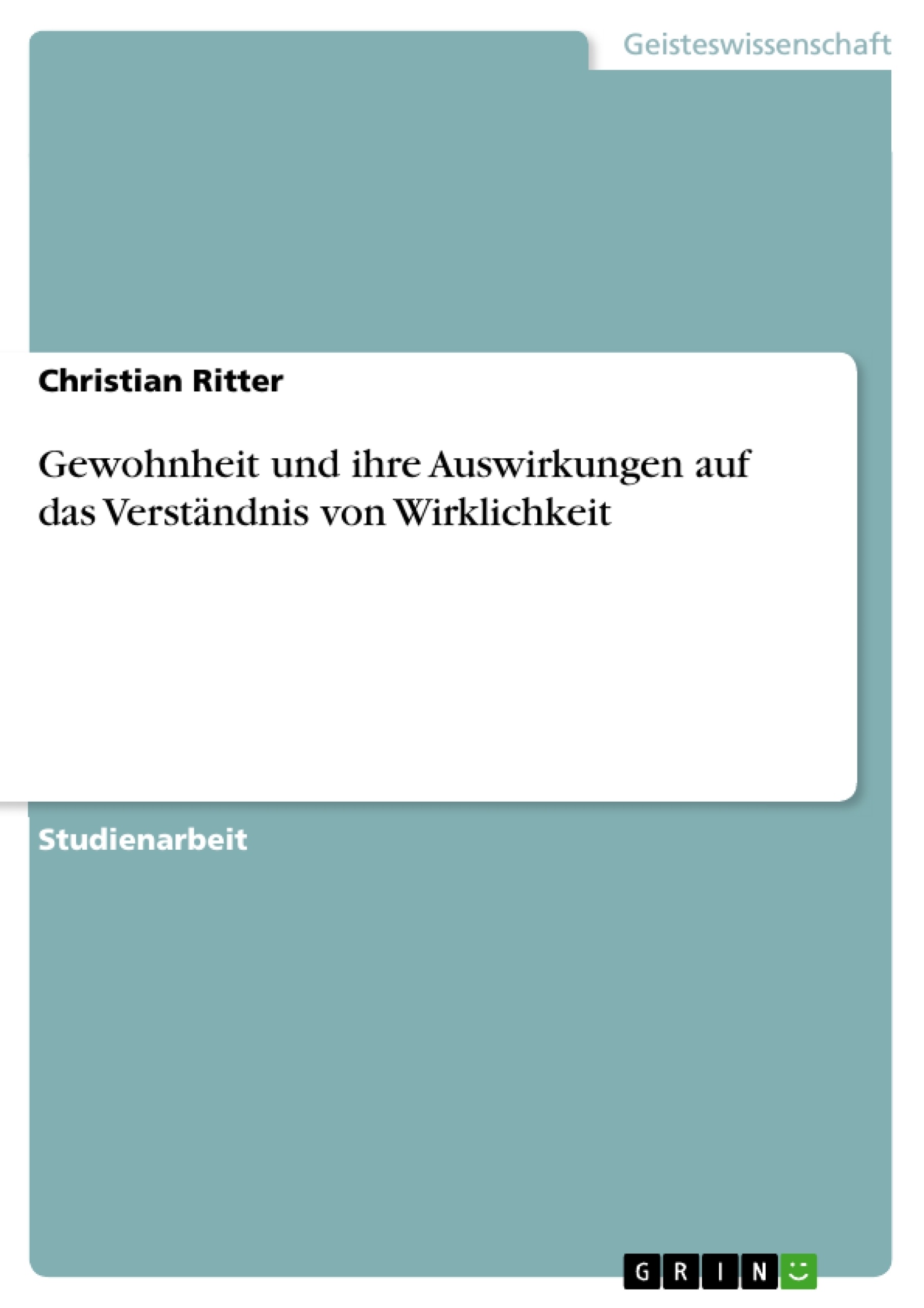Einleitung
Methode der Herangehensweise
Wie kann das Phänomen Gewohnheit beschrieben werden ?
Im folgenden soll versucht werden, eine Beschreibung der Gewohnheit zu liefern. Gewohnheit als sich teils offen, teils verdeckt zeigende Eigenart menschlichen Begreifens und Handelns ist behaftet mit Eigenschaften, die jede für sich vielfältig interpretiert werden können, hier werden diese Eigenschaften als Verweis auf unbewußte psychoökonomische Mechanismen verstanden. Übergreifende einer jeden Gewohnheit anhaftende Eigenschaften sind dabei von nebenrangigen zu scheiden. Um ein Wesen von Gewohnheit beschreiben zu können, soll hier im Besonderen dem Verweischarakter der wahrgenommenen Eigenschaften Rechnung getragen werden. Das heißt, daß dem wahrnehmbaren Eindruck nachgegangen werden soll, ohne ihn zu rechtfertigen oder zu verneinen und, daß sich anbietendende Interpretationsformen zur Artikulation kommen können. Die verschiedenen Deutungsmuster für das Vorhandene sollten als jede für sich verständliche Zugangsart zum Phänomen wahrgenommen werden, ohne jedoch dabei der Illusion anheimzufallen, damit eine erschöpfende Beschreibung bewerkstelligt zu haben.
Das der Wirklichkeit anhaftende Bild des Wirklichseins muß nicht mit rethorischen Stilmitteln untermauert werden. Es geht darum, den Eigenschaften inclusive der ihnen anhaftenden Interpretationsmöglichkeiten gerecht zu werden, ohne sich ihren suggestiven, versichernden Wirkungen auszuliefern. Z.B. soll, um beim Thema zu bleiben, der sich dem aufmerksamen Betrachter eventuell aufdrängende Eindruck von Verdrängungsmechanismen der Gewohnheit hier nebensächlich bleiben. Diese Eigenschaft steht bei der Identifikation der Problematik sicherlich im Vordergrund, man weiß, wovon man redet, wenn ein mit solchen Assoziationen behafteter Begriff auch als solcher der Kommunikation wegen identifiziert wird, jedoch sollte das eine eingehendere Betrachtung desselben nicht unmöglich machen. Gewohnheit besteht ja nicht nur aus Verdrängung und die zur Identifikation eines Gegenstandes herangezogenen Konstituierenden beschreiben nicht immer das Wesen dieser Sache, sondern das der Kommunikation dienliche Wesen dieser Sache, obwohl das immer wieder in Vergessenheit gerät und das eine für das andere gehalten wird. Deshalb will der Autor sich dabei nicht darauf beschränken, den verdrängenden Effekt von Gewohnheit als den Schlüssel zu ihrem Wesen zu beschreiben und davon ausgehend Rückschlüsse auf ihre Beschaffenheit zuzulassen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Methode der Herangehensweise
- 2. Gewohnheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Gewohnheit und ihre Auswirkungen auf unser Verständnis von Wirklichkeit. Ziel ist es, eine Beschreibung der Gewohnheit zu liefern und deren Eigenschaften als Verweis auf unbewusste psychoökonomische Mechanismen zu verstehen.
- Beschreibung der Gewohnheit als menschliches Begreifen und Handeln
- Untersuchung der übergreifenden Eigenschaften von Gewohnheiten
- Der Verweischarakter wahrgenommener Eigenschaften und deren Interpretation
- Das Verhältnis zwischen Bewußtsein und Wirklichkeit im Kontext von Gewohnheit
- Die Rolle von Gewohnheit bei der Konstruktion von Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung - Methode der Herangehensweise: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Herangehensweise an das Thema Gewohnheit. Es wird betont, dass Gewohnheit ein komplexes Phänomen ist, das vielschichtig interpretiert werden kann. Der Autor wählt einen Ansatz, der den wahrnehmbaren Eindrücken folgt, ohne diese zu rechtfertigen oder zu verneinen. Verschiedene Interpretationsmöglichkeiten werden als gleichwertige Zugangsarten zum Phänomen betrachtet. Es wird betont, dass das Ziel nicht darin besteht, ein endgültiges Bild der Wirklichkeit zu schaffen, sondern den Eigenschaften der Gewohnheit und ihren Interpretationsmöglichkeiten gerecht zu werden, ohne den suggestiven Wirkungen zu erliegen. Der Autor distanziert sich von einer einseitigen Fokussierung auf Verdrängungsmechanismen als Schlüssel zum Wesen der Gewohnheit und bezieht sich auf Kant und van der Leeuw, um die Problematik der unbewussten Identifikation von Gegenstand und Konstituierenden zu beleuchten. Das Kapitel legt den Grundstein für eine differenzierte Betrachtungsweise, die das Verhältnis zwischen Bewußtsein und Wirklichkeit in den Mittelpunkt stellt.
2. Gewohnheit: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Auszug unvollständig ist) beginnt mit der Betrachtung der Etablierung und Veränderung von Gewohnheiten. Es wird angedeutet, dass das Verständnis von Gewohnheit eng mit dem kognitiven Vermögen des Menschen verbunden ist. Die Arbeit postuliert ein komplexes Wechselspiel zwischen dem Bewußtsein und der Wirklichkeit, in dem Gewohnheit eine zentrale Rolle spielt. Es wird angedeutet, dass die Entwicklung des kognitiven Apparates in der Rekonstruktion von Wirklichkeit eine Rolle spielt, und dass eine Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt durch konstituierende Mittler geschaffen wird. Die Frage, ob das Innen oder Außen die Wahrnehmung strukturiert, wird offen gelassen, es wird ein Zusammenspiel beider betont. Der Text deutet an, dass Gewohnheit nicht als isolierter Faktor betrachtet werden kann, sondern meist mit anderen Motiven in Verbindung steht.
Schlüsselwörter
Gewohnheit, Wirklichkeit, Erkenntnis, Bewußtsein, Kognition, Wahrnehmung, Rekonstruktion, psychoökonomische Mechanismen, van der Leeuw, Kant.
Häufig gestellte Fragen zu: Untersuchung des Phänomens der Gewohnheit
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der Gewohnheit und deren Auswirkungen auf unser Verständnis von Wirklichkeit. Im Fokus steht die Beschreibung der Gewohnheit und das Verständnis ihrer Eigenschaften als Verweis auf unbewusste psychoökonomische Mechanismen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Beschreibung der Gewohnheit als menschliches Begreifen und Handeln, Untersuchung der übergreifenden Eigenschaften von Gewohnheiten, der Verweischarakter wahrgenommener Eigenschaften und deren Interpretation, das Verhältnis zwischen Bewußtsein und Wirklichkeit im Kontext von Gewohnheit, und die Rolle von Gewohnheit bei der Konstruktion von Wirklichkeit.
Welche Methode wird angewendet?
Die Herangehensweise ist geprägt von einer differenzierten Betrachtungsweise, die dem wahrnehmbaren Eindruck folgt, ohne diese zu rechtfertigen oder zu verneinen. Verschiedene Interpretationsmöglichkeiten werden als gleichwertig betrachtet. Der Fokus liegt nicht auf der Schaffung eines endgültigen Bildes der Wirklichkeit, sondern auf der Gerechtigkeit den Eigenschaften der Gewohnheit und ihren Interpretationsmöglichkeiten.
Wie wird das Verhältnis von Bewußtsein und Wirklichkeit betrachtet?
Die Arbeit postuliert ein komplexes Wechselspiel zwischen Bewußtsein und Wirklichkeit, in dem Gewohnheit eine zentrale Rolle spielt. Die Frage, ob das Innen oder Außen die Wahrnehmung strukturiert, wird offen gelassen; ein Zusammenspiel beider wird betont.
Welche Rolle spielen Kant und van der Leeuw?
Kant und van der Leeuw werden im Zusammenhang mit der Problematik der unbewussten Identifikation von Gegenstand und Konstituierenden erwähnt, um die Komplexität des Themas zu beleuchten und eine einseitige Fokussierung auf Verdrängungsmechanismen zu vermeiden.
Was ist der Inhalt des ersten Kapitels?
Das erste Kapitel beschreibt die Herangehensweise an das Thema Gewohnheit und betont dessen Komplexität und Vielschichtigkeit. Es werden verschiedene Interpretationsmöglichkeiten als gleichwertige Zugangsarten betrachtet und der Fokus auf eine differenzierte Betrachtung des Verhältnisses zwischen Bewußtsein und Wirklichkeit gelegt.
Was ist der Inhalt des zweiten Kapitels (Auszug)?
Das zweite Kapitel (unvollständig im Auszug) behandelt die Etablierung und Veränderung von Gewohnheiten und deren enge Verbindung zum kognitiven Vermögen des Menschen. Es wird ein komplexes Wechselspiel zwischen Bewußtsein und Wirklichkeit postuliert, in dem Gewohnheit eine zentrale Rolle spielt, und die Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt durch konstituierende Mittler thematisiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Gewohnheit, Wirklichkeit, Erkenntnis, Bewußtsein, Kognition, Wahrnehmung, Rekonstruktion, psychoökonomische Mechanismen, van der Leeuw, Kant.
- Citation du texte
- Christian Ritter (Auteur), 2000, Gewohnheit und ihre Auswirkungen auf das Verständnis von Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3341