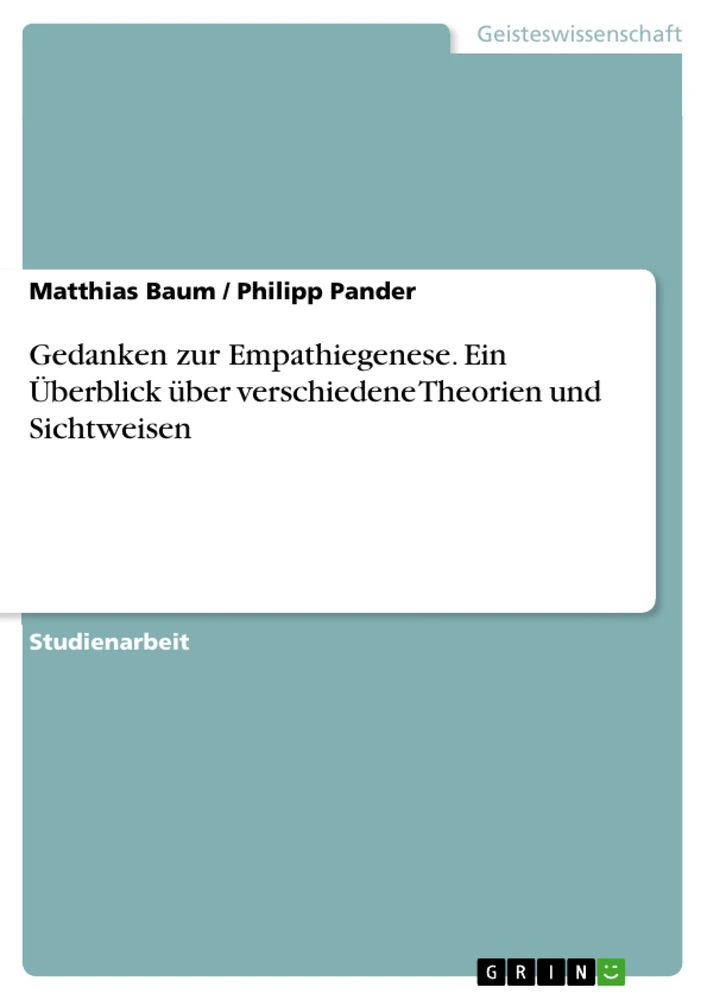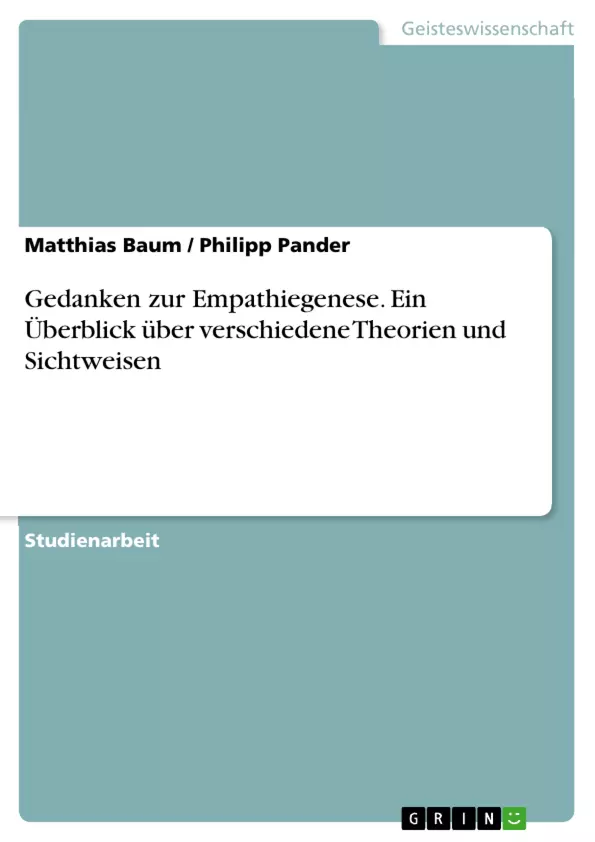Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, unterschiedliche Perspektiven der Empathiegenese zu beleuchten und gegenüberzustellen. Dabei wird nach einer kurzen Definition des Begriffes Empathie auf einzelne Theorien aus akademischer Psychologie und Psychoanalyse sowie auf neurologische Faktoren eingegangen und ihr möglicher Zusammenhang diskutiert.
Abschließend wird versucht, einen Ausblick auf eine mögliche integrative Sichtweise zugeben. Hierbei wird der Empathiebegriff nach Bischof-Köhler, aufgrund seiner hohen Differenziertheit und Kompatibilität mit Ansätzen aus anderen Schulen, als Ausgangspunkt gewählt. Bindungstheoretische Einflüsse auf die Empathiegenese und der Einfluss von Spiegelneuronen werden dargestellt und diskutiert. Aus der psychoanalytischen Tradition wird besonders auf eine objektbeziehungs-theoretische Perspektive eingegangen. Auch die möglichen Vorteile und Schwierigkeiten einer integrativen Sicht auf die Empathiegenese werden kurz diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen von Empathie
- Empathie und Gefühlsansteckung
- Empathie und Selbstobjektivierung
- Ausdrucksvermittelte Empathie vs. Situationsvermittelte Empathie
- Empathie und Selbstkonzept
- (Nicht-)Zusammenhang von Empathie und Spiegelneuronen
- Empathie und Bindung
- Psychoanalytische Überlegungen und eine objektbeziehungstheoretische Perspektive der Empathie
- Empathie als projektiv-identifikatorischer Prozess
- Empathie und das Konzept der Mentalisierung
- Ein möglicher Ansatz zur Integration verschiedener Perspektiven der Empathiegenese?
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Empathiegenese, also der Entwicklung von Empathie. Sie untersucht verschiedene Perspektiven auf die Entstehung von Empathie und stellt diese gegenüber. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl psychologische als auch psychoanalytische Theorien sowie neurologische Faktoren.
- Definitionen von Empathie und ihre unterschiedlichen Ansätze
- Der Einfluss von Gefühlsansteckung und Selbstobjektivierung auf die Empathieentwicklung
- Die Rolle von Spiegelneuronen und Bindungstheorie in der Empathiegenese
- Psychoanalytische Perspektiven auf Empathie, insbesondere die objektbeziehungstheoretische Perspektive
- Eine integrative Sichtweise auf die Empathiegenese
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in das Thema der Empathie ein und erläutert die Bedeutung des Begriffs für verschiedene Wissenschaftsdisziplinen. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Empathiekonzepte und ihre verschiedenen Definitionen aus psychologischer und psychoanalytischer Sicht.
- Das zweite Kapitel widmet sich verschiedenen Theorien der Empathie und diskutiert, wie diese die Entstehung von Empathie erklären. Es werden dabei Konzepte wie Gefühlsansteckung, Selbstobjektivierung, Perspektivenübernahme und Selbstkonzept beleuchtet.
- Das dritte Kapitel erörtert die Rolle von Spiegelneuronen in der Empathiegenese. Es wird untersucht, ob und wie diese Nervenzellen am Prozess der Empathie beteiligt sind.
- Das vierte Kapitel fokussiert auf die Bedeutung von Bindung für die Entwicklung von Empathie. Es wird analysiert, wie die Qualität der frühen Bindungserfahrungen die spätere Empathiefähigkeit beeinflusst.
- Das fünfte Kapitel beleuchtet psychoanalytische Perspektiven auf Empathie. Es wird insbesondere die objektbeziehungstheoretische Sichtweise auf Empathie als ein projektiv-identifikatorischer Prozess erläutert.
Schlüsselwörter
Empathiegenese, Empathie, Gefühlsansteckung, Selbstobjektivierung, Spiegelneuronen, Bindungstheorie, Objektbeziehungstheorie, Mentalisierung, Integrative Sichtweise, Psychoanalytische Perspektive, Psychologische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Empathiegenese?
Empathiegenese bezeichnet die Entstehung und Entwicklung von Empathie im menschlichen Individuum unter Berücksichtigung verschiedener psychologischer und biologischer Faktoren.
Welche Rolle spielen Spiegelneuronen bei der Empathie?
Spiegelneuronen werden als neurologische Faktoren diskutiert, die möglicherweise am Prozess der Empathie beteiligt sind, wobei ihr genauer Zusammenhang in der Forschung noch debattiert wird.
Wie beeinflusst die Bindungstheorie die Entwicklung von Empathie?
Die Qualität der frühen Bindungserfahrungen hat einen signifikanten Einfluss auf die spätere Empathiefähigkeit eines Menschen.
Was ist der Unterschied zwischen Gefühlsansteckung und Empathie?
Gefühlsansteckung ist ein eher reflexartiger Prozess, während Empathie oft eine differenziertere Selbstobjektivierung und Perspektivenübernahme voraussetzt.
Welchen Ansatz verfolgt die psychoanalytische Perspektive?
Die Psychoanalyse betrachtet Empathie insbesondere aus einer objektbeziehungstheoretischen Sicht, oft als projektiv-identifikatorischen Prozess oder im Kontext der Mentalisierung.
Was kennzeichnet den Empathiebegriff nach Bischof-Köhler?
Er zeichnet sich durch eine hohe Differenziertheit aus und dient als Ausgangspunkt für eine integrative Sichtweise, die mit verschiedenen psychologischen Schulen kompatibel ist.
- Citation du texte
- B. Sc. Matthias Baum (Auteur), Philipp Pander (Auteur), 2016, Gedanken zur Empathiegenese. Ein Überblick über verschiedene Theorien und Sichtweisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334369